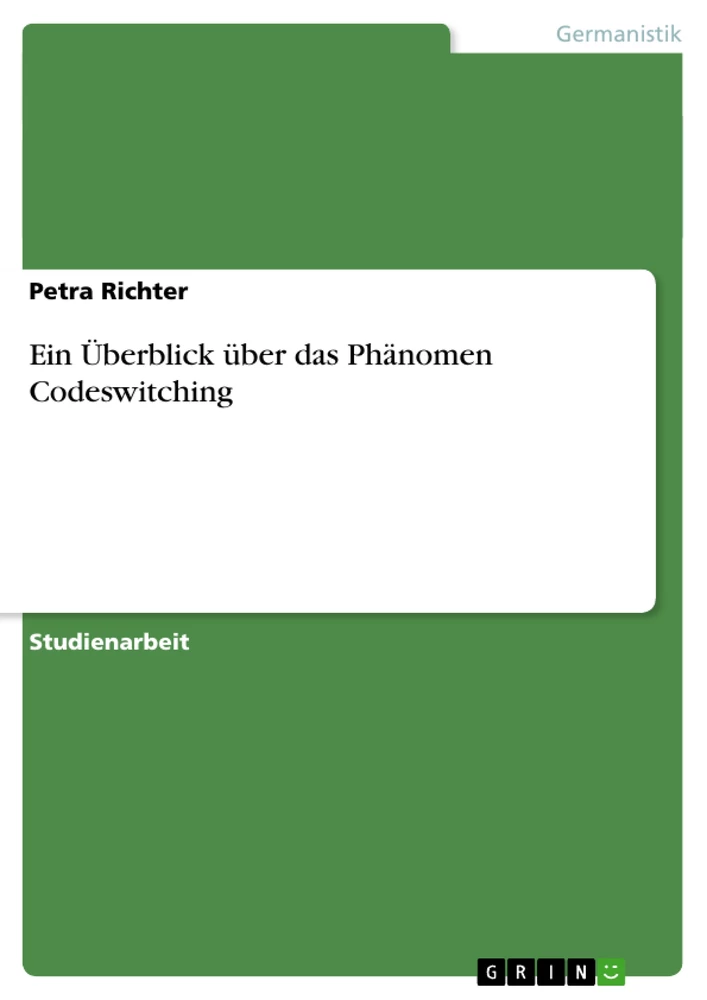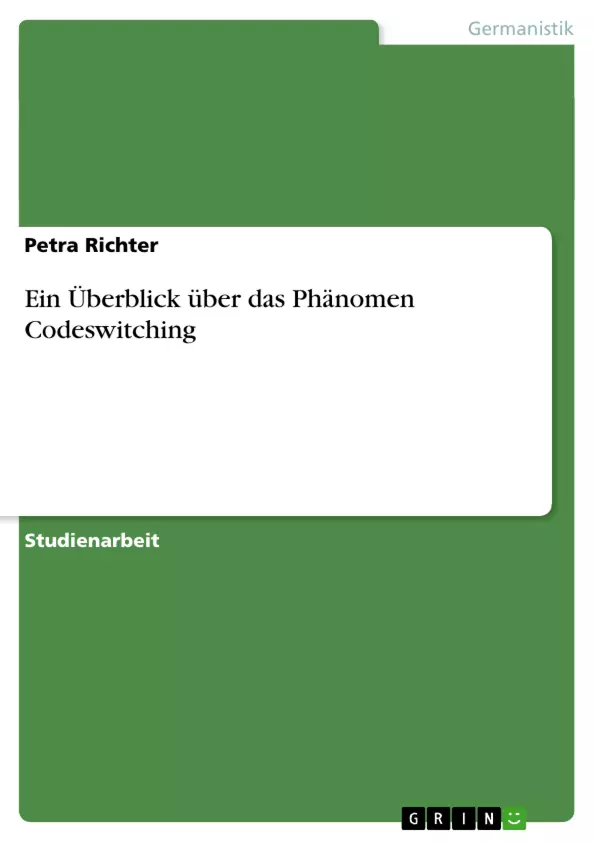Diese Ausarbeitung soll nun einen Überblick über dieses Phänomen, welches Codeswitching genannt wird, geben. Zunächst wird das Codeswitching mit seinen Strukturen und Regeln näher erläutert. Anhand eines Beispielsatzes, in dem zwischen der griechischen und deutschen Sprache gewechselt wird, sollen die Grundlagen der Analyse des Codeswitching erklärt werden. Bevor dieser Satz jedoch analysiert wird, erkläre ich zunächst die griechische Grammatik, um den darauf folgenden Beispielsatz verständlich zu machen. Abschließend fasse ich meine Ergebnisse und Bedeutung der Thematik zusammen.
Inhaltsverzeichnis
- 0. Einleitung
- 1. Definition Code-switching
- 2. Beispiel für Code-switching
- 2.1 Einführung in die Griechische Grammatik
- 2.2 Satzanalyse
- 2.2.1 Glossierung
- 2.2.2 Klammermodell
- 3. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit verfolgt das Ziel, das Phänomen des Code-switchings zu erläutern und anhand eines Beispielsatzes zu analysieren. Der Fokus liegt auf der Definition von Code-switching, der Erläuterung verschiedener Strukturen und der Anwendung der Analysemethoden. Die griechische Grammatik wird als Grundlage für die Analyse des Beispielsatzes eingeführt.
- Definition und Strukturen des Code-switchings
- Analysemethoden für Code-switching
- Einführung in die griechische Grammatik
- Analyse eines griechischen/deutschen Beispielsatzes
- Funktion und Motivation von Code-switching
Zusammenfassung der Kapitel
0. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik des Code-switchings ein, motiviert durch die steigende Migration und den daraus resultierenden Bilingualismus in Deutschland. Sie skizziert den Aufbau der Arbeit: Definition von Code-switching, Analyse eines Beispielsatzes (griechisch/deutsch) nach Erläuterung grundlegender griechischer Grammatik und abschließendes Fazit.
1. Definition Code-switching: Dieses Kapitel definiert Code-switching als die Verwendung mindestens zweier Varietäten innerhalb derselben Interaktion, häufig in mehrsprachigen Gesellschaften. Es werden verschiedene Strukturen des Code-switchings unterschieden (intersential und intrasential switching nach Myers-Scotton) und unterschiedliche Ansätze zur Bestimmung, was als Code-switching zählt, diskutiert (z.B. die Unterscheidung zwischen Code-switching und Ad-hoc-Entlehnungen). Das Matrix Language Frame Model von Myers-Scotton wird vorgestellt, welches die Rolle der Matrixsprache bei der morphosyntaktischen Struktur des Code-switchings beschreibt. Schließlich werden soziolinguistische und psycholinguistische Motivationsfaktoren für Code-switching erörtert.
2. Beispiel für Code-switching: Dieses Kapitel bereitet die Analyse eines konkreten Beispielsatzes vor, indem es zunächst die relevanten Aspekte der griechischen Grammatik erläutert. Es werden die Unterschiede zwischen griechischer und deutscher Grammatik in Bezug auf Personalpronomen, Verbkonjugation, Adjektivdeklination und Satzstruktur herausgestellt. Besonderheiten der griechischen Lokalrelationen und die Abwesenheit des Infinitivs werden ebenfalls thematisiert. Dieses Kapitel legt den sprachlichen und grammatikalischen Grundstein für die anschließende Analyse des Beispielsatzes.
Schlüsselwörter
Code-switching, Bilingualismus, Mehrsprachigkeit, Griechisch, Deutsch, Sprachwissenschaft, Satzanalyse, Matrix Language Frame Model, inter-sential switching, intra-sential switching, soziolinguistische Motivation, psycholinguistische Motivation.
Häufig gestellte Fragen zum Dokument: Code-Switching Analyse
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert das Phänomen des Code-Switchings, wobei der Fokus auf der Definition, verschiedenen Strukturen und Analysemethoden liegt. Ein Beispielsatz im Griechisch-Deutschen wird detailliert untersucht.
Welche Ziele werden verfolgt?
Die Arbeit erläutert Code-Switching, analysiert ein Beispiel und vergleicht die Strukturen von Griechisch und Deutsch. Die griechische Grammatik dient als Grundlage für die Analyse.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Definition und Strukturen von Code-Switching (intersential und intrasential), Analysemethoden, griechische Grammatik (Personalpronomen, Verbkonjugation, Adjektivdeklination, Satzstruktur, Lokalrelationen), die Analyse eines griechischen/deutschen Beispielsatzes, sowie soziolinguistische und psycholinguistische Motivationsfaktoren.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, gefolgt von einer Definition von Code-Switching. Ein Kapitel widmet sich der Analyse eines Beispielsatzes, vorbereitet durch eine Einführung in die relevante griechische Grammatik. Die Arbeit schließt mit einem Fazit.
Was wird in der Einleitung erklärt?
Die Einleitung führt in das Thema Code-Switching ein, motiviert durch Migration und Bilingualismus. Sie beschreibt den Aufbau der Arbeit: Definition, Analyse eines Beispielsatzes und abschließendes Fazit.
Wie wird Code-Switching definiert?
Code-Switching wird definiert als die Verwendung mindestens zweier Varietäten innerhalb derselben Interaktion, häufig in mehrsprachigen Gesellschaften. Verschiedene Strukturen (intersential und intrasential nach Myers-Scotton) und Ansätze zur Bestimmung werden diskutiert. Das Matrix Language Frame Model von Myers-Scotton wird vorgestellt.
Wie wird der Beispielsatz analysiert?
Die Analyse des Beispielsatzes basiert auf der zuvor erklärten griechischen Grammatik. Unterschiede zwischen griechischer und deutscher Grammatik in Bezug auf Personalpronomen, Verbkonjugation, Adjektivdeklination und Satzstruktur werden herausgestellt. Besonderheiten der griechischen Lokalrelationen und die Abwesenheit des Infinitivs werden thematisiert.
Welche Analysemethoden werden verwendet?
Die Arbeit verwendet das Matrix Language Frame Model von Myers-Scotton und eine detaillierte grammatikalische Analyse des Beispielsatzes, um Code-Switching-Strukturen zu identifizieren und zu erklären.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Die relevanten Schlüsselwörter sind: Code-switching, Bilingualismus, Mehrsprachigkeit, Griechisch, Deutsch, Sprachwissenschaft, Satzanalyse, Matrix Language Frame Model, inter-sential switching, intra-sential switching, soziolinguistische Motivation, psycholinguistische Motivation.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist für Studierende der Sprachwissenschaft, Soziolinguistik und Mehrsprachigkeitsforschung relevant. Sie bietet einen umfassenden Einblick in die Analyse von Code-Switching.
- Citar trabajo
- Petra Richter (Autor), 2006, Ein Überblick über das Phänomen Codeswitching, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/180426