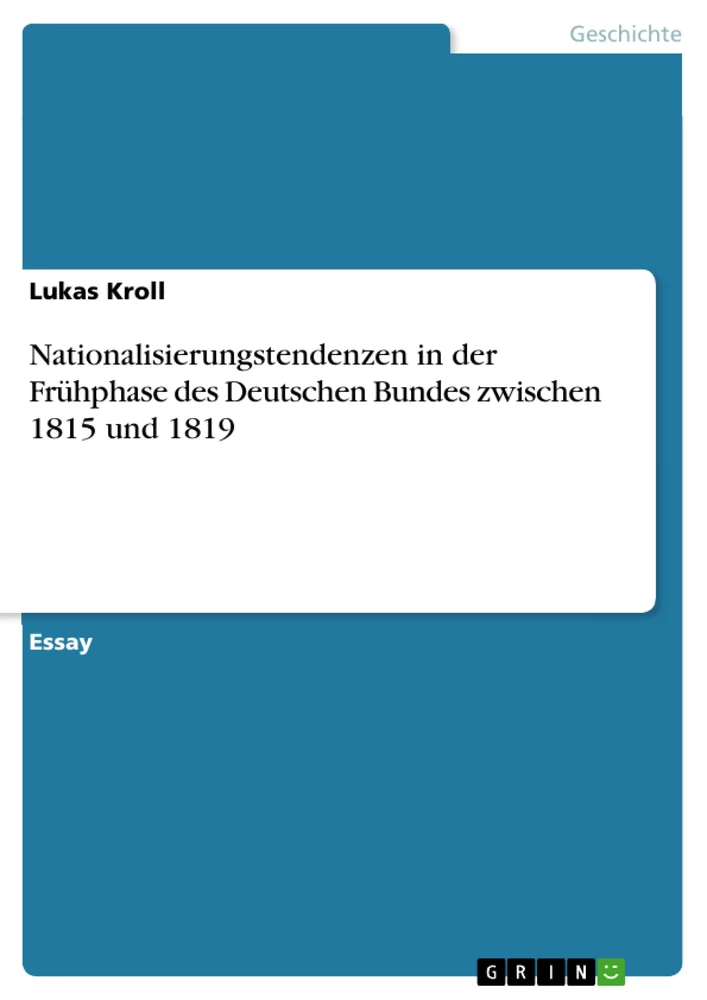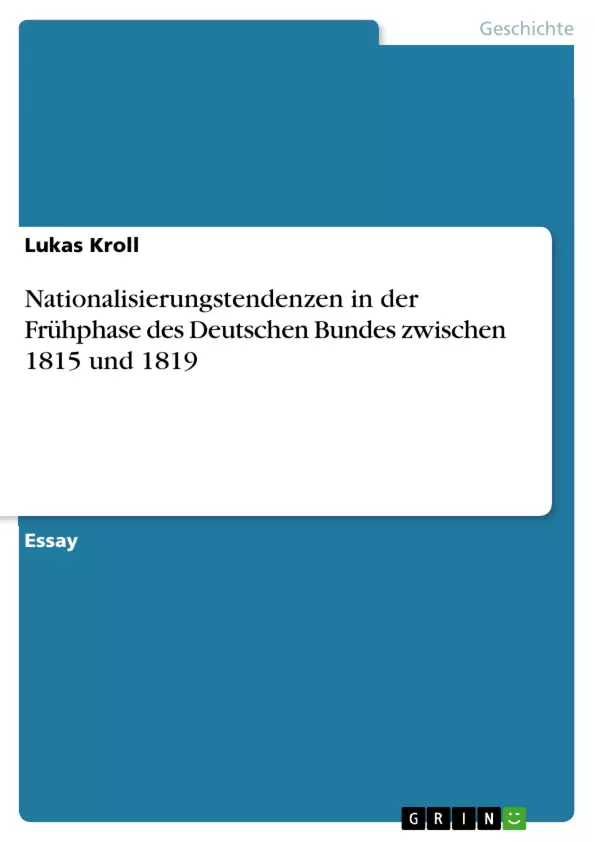Restauration und Nationalismus sind eher zwei zeitlich parallel stattfindende Prozess die in einer wechselseitigen Beziehung standen. Diese Beziehung soll Thema dieser Arbeit sein. Es geht dabei um die Nationalsierungstendenzen innerhalb der deutschen Territorien im Anschluss an den Wiener Kongress, der Blütezeit der Restauration. Anhand der Politik des Deutschen Bundes soll aufgezeigt werden inwiefern nationalistische Tendenzen der konservativ-restaurativen Politik der europäischen Großmächte standhalten konnten und in welchen Ausprägungen sie sich politisch manifestierten und gegebenenfalls realisieren ließen. Auf die Erläuterung und Beurteilung sonstiger nationaler oder gar nationalstaatlicher Tendenzen, zum Beispiel durch die Institution der Burschenschaften, wird an dieser Stelle verzichtet. Um sich im Kontext der Politik des Deutschen Bundes ein fundiertes Urteil erlauben zu können, sollte zunächst einmal die Funktion und Stellung des Deutschen Bundes resümiert werden, bevor sich auch der Frage nach dem Begriff und Verständnis von „Nation“ gewidmet wird.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Einstieg und Problematisierung
- Der deutsche Bund und der Begriff der „Nation“
- Hauptteil
- Nationalbewegung versus Deutscher Bund?
- Staatenbund oder Bundesstaat?
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die Nationalisierungstendenzen in den deutschen Territorien nach dem Wiener Kongress und während der Blütezeit der Restauration. Der Fokus liegt dabei auf der Analyse der Politik des Deutschen Bundes und der Frage, inwiefern nationalistische Tendenzen der konservativ-restaurativen Politik der europäischen Großmächte standhalten konnten.
- Der Deutsche Bund als Organisationsform der deutschen Staatenwelt
- Die Bedeutung des Begriffs „Nation“ im frühen 19. Jahrhundert
- Der Einfluss der Nationalbewegung auf die Politik des Deutschen Bundes
- Die Rolle des Gesandtschaftsrechts in der Dreiecksbeziehung zwischen Deutschem Bund, deutschen Staaten und europäischen Großmächten
- Die Frage nach der Funktionalität des Deutschen Bundes im Vergleich zu nationalen Einheitsbestrebungen
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Das erste Kapitel führt in die Thematik der Nationalisierungstendenzen im frühen Deutschen Bund ein. Es stellt die deutsche Einheit von 1989 als Ausgangspunkt für die Betrachtung von nationalistischen Bewegungen in der Geschichte Deutschlands dar. Der Fokus liegt dabei auf der Frage, ob die Kaiserkrönung von 1871 und die Errichtung des Deutschen Kaiserreichs als logische Folge des deutschen Willens zur nationalen Einheit betrachtet werden können oder ob die Restauration die entscheidende Rolle spielte.
Hauptteil
Nationalbewegung versus Deutscher Bund?
Der zweite Teil der Arbeit befasst sich mit dem Verhältnis zwischen der Nationalbewegung und dem Deutschen Bund. Es wird diskutiert, ob die Nationalbewegung dem Deutschen Bund mehr zutraute, als er leisten konnte oder ob sie ihn von vornherein als untaugliches Instrument für die Durchsetzung ihrer Ziele ansah. Der Abschnitt beleuchtet zudem die Rolle des Gesandtschaftsrechts und die Wahrnehmung des Deutschen Bundes im europäischen Ausland.
Staatenbund oder Bundesstaat?
Das Kapitel analysiert die Struktur des Deutschen Bundes und untersucht die Frage, ob es sich um einen Staatenbund oder einen Bundesstaat handelte. Es wird diskutiert, inwiefern die föderative Struktur des Bundes mit den nationalen Einheitsbestrebungen der Zeit vereinbar war.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den zentralen Begriffen der Nationalisierungstendenzen, des Deutschen Bundes, der Restauration und des Gesandtschaftsrechts. Weitere relevante Schlüsselwörter sind Nation, Nationalbewegung, Staatenbund, Bundesstaat und die Rolle der europäischen Großmächte.
- Citar trabajo
- Lukas Kroll (Autor), 2010, Nationalisierungstendenzen in der Frühphase des Deutschen Bundes zwischen 1815 und 1819, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/180536