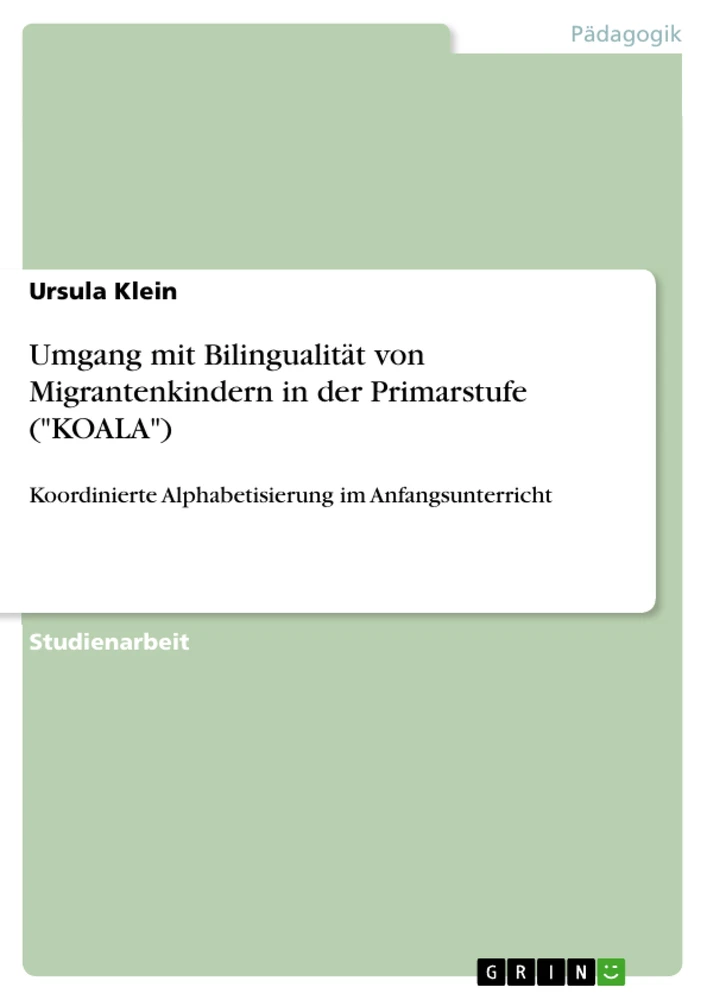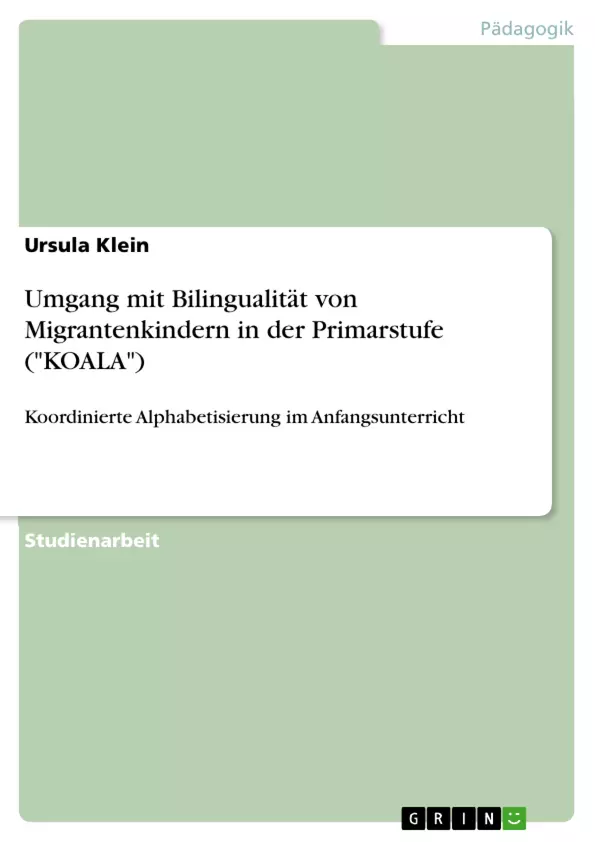Die Vergleichsstudien „Iglu“ und „Pisa“ brachten in den vergangenen
Jahren die Schwierigkeiten der Schüler und Schülerinnen mit Migrationshintergrund im deutschen Bildungssystem immer wieder in das Licht der Öffentlichkeit.Der durchschnittliche Bildungserfolg dieser Schüler liegt deutlich hinter den Ergebnissen der Vergleichsgruppe ohne Migrationshintergrund oder mit nur einem nicht in Deutschland geborenen Elternteil zurück. Die Sprachkompetenz bildet dabei eine entscheidende Hürde in der Bildungskarriere von Kindern aus Zuwandererfamilien
denn sprachliche Defizite wirken sich kumulativ auf andere Sachfächer aus.Ein Grund ist dabei auch der Umgang mit dem Thema Mehrsprachigkeit im deutschen Bildungssystem. Dieses geht vor dem Hintergrund der nationalstaatlichen Entwicklung immer noch von einer sprachlichen Homogenität aus. Das Konstrukt, alle Kinder sprechen bei Schuleintritt monolingual deutsch, erweist sich als überholt, schaut man sich den sprachlichen Habitus der vorhandenen
Schülerschaft an.Ging man früher davon aus, dass die Herkunftssprachen nach zwei Generationen in den Familien in den Hintergrund gedrängt wurden, ist dies heute nicht mehr der Fall, da durch neuere Kommunikationsmittel,günstigere Reisemöglichkeiten und modernere Medien der Kontakt mit der Herkunftssprache aktiver aufrecht erhalten werden kann.Vorhandene Mehrsprachigkeit wird jedoch häufig als Defizit empfunden.Dies ist vor allem dann der Fall, wenn es sich um Sprachkenntnisse mit geringerer gesellschaftlicher Anerkennung z.B. Türkisch in Kombination mit unzureichenden Deutschkenntnissen handelt. Auch vor dem Hintergrund des demographischen Wandels bedeutet diese Nichtanerkennung vorhandener mehrsprachlicher Kompetenzen Ressourcenverschwendung.
Bisherige Sprachlernkonzepte, die sich einseitig auf das Erlernen der Zweitsprache Deutsch beziehen, scheinen bisher nicht zum durchschlagenden Erfolg in dieser Problematik zu führen. Daher
geht es in dieser Hausarbeit darum, andere effektivere Möglichkeiten
zur Förderung des deutschen Spracherwerbs zu finden und dabei auch
die heterogene Sprachkompetenz der Schülerschaft nicht aus dem
Blick zu verlieren. Das Koala-Projekt scheint einen neuen Ansatz zu
verfolgen, in dem auch die Erstsprache Berücksichtigung und Akzeptanz
findet. Deshalb wird in der vorliegenden Arbeit untersucht, in wieweit das Koala-Projekt zur Förderung der deutschen Sprachkompetenz
in der Primarstufe geeignet ist.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Bilingualität
- 2.1 Definition
- 2.2 Formen der Bilingualität
- 3. Spracherwerb
- 3.1 Spracherwerb bei Migrantenkindern
- 3.2 Zusammenhang zwischen Erst- und Zweitsprachenerwerb
- 3.3 Geltungswert der Interdependenztheorie
- 4. Anforderung an den deutschen Sprachunterricht in der Primarstufe
- 5. Koordinierte Alphabetisierung im Anfangsunterricht (Koala)
- 5.1 Entstehung von KOALA
- 5.2 Funktionsweise des KOALA-Konzepts
- 6. Diskussion und Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit der Herausforderung, die Bilingualität von Migrantenkindern im deutschen Bildungssystem darstellt. Ziel ist es, die Rolle der Erstsprache bei der Förderung des deutschen Spracherwerbs in der Primarstufe zu analysieren und das KOALA-Projekt als einen Ansatzpunkt für eine effektivere Sprachförderung zu untersuchen.
- Definition von Bilingualität und ihre verschiedenen Erscheinungsformen
- Spracherwerb bei Migrantenkindern und der Zusammenhang zwischen Erst- und Zweitsprachenerwerb
- Die Bedeutung der Interdependenztheorie für den Spracherwerb
- Anforderungen an den deutschen Sprachunterricht in der Primarstufe
- Das KOALA-Projekt als Ansatzpunkt für eine integrative Sprachförderung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die die Problematik der Sprachkompetenz von Migrantenkindern im deutschen Bildungssystem beleuchtet und die Relevanz des Themas im Kontext von „Iglu“ und „Pisa“-Studien hervorhebt.
Kapitel 2 beschäftigt sich mit der Definition und den Formen von Bilingualität. Verschiedene wissenschaftliche Perspektiven werden beleuchtet, und es wird die Notwendigkeit einer umfassenden Definition von Bilingualität in diesem Kontext herausgestellt.
Kapitel 3 analysiert den Spracherwerb von Migrantenkindern und den Zusammenhang zwischen Erst- und Zweitsprachenerwerb. Die Interdependenzhypothese wird vorgestellt und ihre Relevanz für die Sprachförderung von Migrantenkindern diskutiert.
Kapitel 4 setzt sich mit den Anforderungen an den deutschen Sprachunterricht in der Primarstufe auseinander. Die Herausforderungen und Besonderheiten, die durch die zunehmende Heterogenität der Schülerschaft entstehen, werden betrachtet.
Kapitel 5 stellt das KOALA-Projekt vor, das die Vielfalt der Schülerschaft als Chance begreift und eine integrative Sprachförderung anstrebt. Der Entwicklungshintergrund von KOALA wird erläutert und die Funktionsweise des Konzepts wird im Detail dargestellt.
Schlüsselwörter
Bilingualität, Migrantenkinder, Spracherwerb, Interdependenz, KOALA-Projekt, integrative Sprachförderung, Primarstufe, Erstsprache, Zweitsprache, Heterogenität.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das KOALA-Projekt?
KOALA steht für "Koordinierte Alphabetisierung im Anfangsunterricht" und ist ein Konzept, das die Erstsprache von Migrantenkindern aktiv in den Unterricht einbezieht.
Warum wird Mehrsprachigkeit oft als Defizit gesehen?
Oft liegt der Fokus einseitig auf unzureichenden Deutschkenntnissen, während die Kompetenzen in der Herkunftssprache gesellschaftlich weniger anerkannt werden.
Was besagt die Interdependenztheorie?
Sie besagt, dass eine gut entwickelte Erstsprache den Erwerb der Zweitsprache (Deutsch) positiv beeinflusst und als Fundament dient.
Wie unterscheiden sich Iglu- und Pisa-Studien bei Migrantenkindern?
Diese Studien zeigen regelmäßig, dass Schüler mit Migrationshintergrund im deutschen Bildungssystem oft geringere Bildungserfolge erzielen, meist aufgrund sprachlicher Hürden.
Welche Anforderungen gibt es an den Sprachunterricht in der Primarstufe?
Der Unterricht muss die zunehmende sprachliche Heterogenität als Ressource nutzen, anstatt von einer monolingualen deutschen Schülerschaft auszugehen.
- Quote paper
- Ursula Klein (Author), 2011, Umgang mit Bilingualität von Migrantenkindern in der Primarstufe ("KOALA"), Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/180541