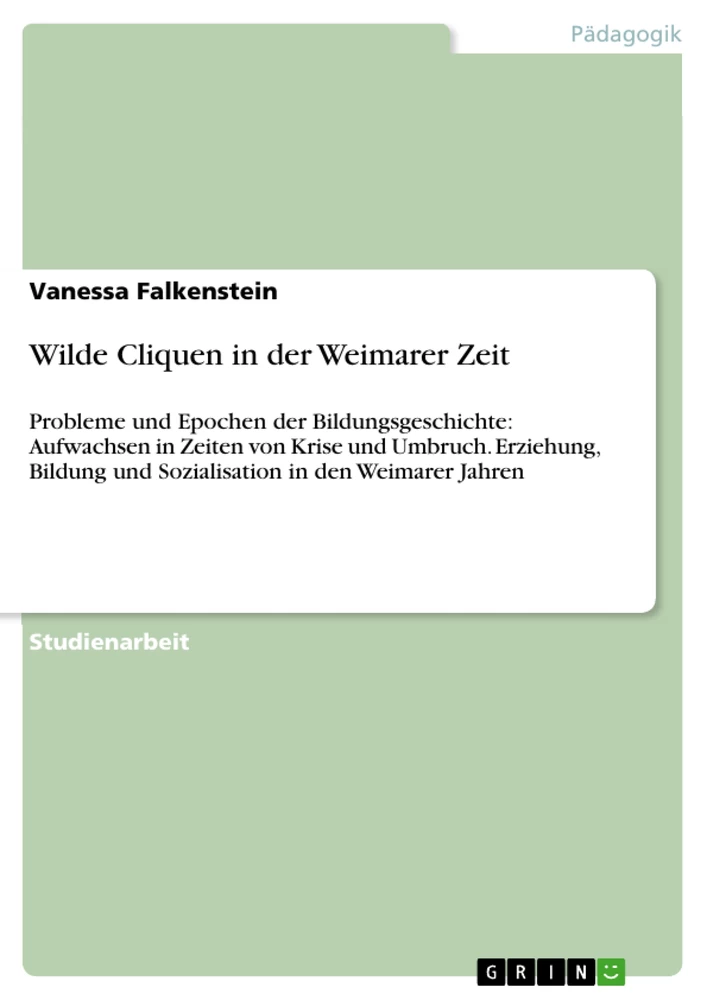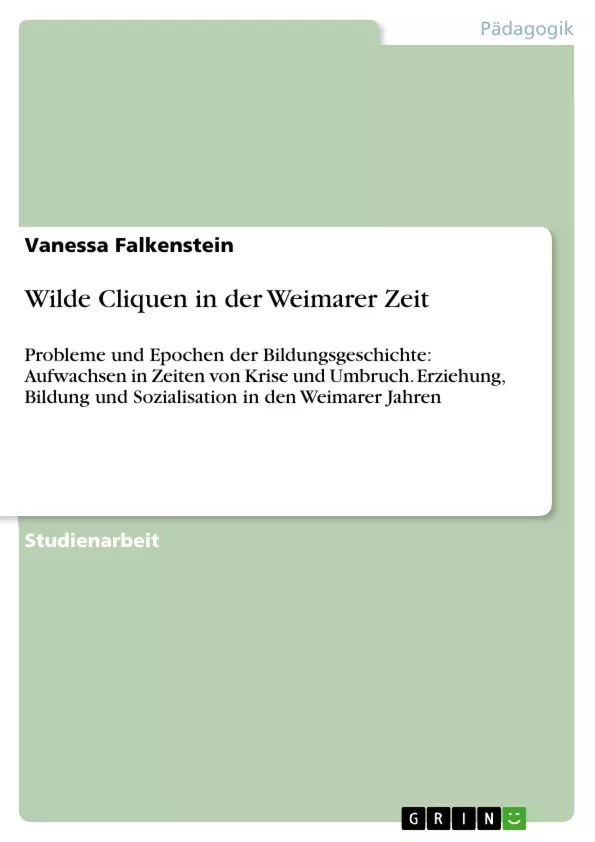„Penner nennen uns die Leute
Penner sind wir lange nicht,
denn wir haben noch ne Bleibe
Mutter Grün verläßt uns nicht.“
Dieses Lied verdeutlicht wie die Bevölkerung der Weimarer Zeit die Mitglieder der Wilden Cliquen wahrnahm. Die Wilden Cliquen waren zwar nur eine Minderheit in der Jugend der Unterschicht, wurden aber in der Öffentlichkeit als besonders charakteristisch und bedrohlich zugleich aufgefasst.
Wie sie entstanden, sich entwickelten und welche Ausprägungsformen sie annahmen, beschreibt diese Arbeit. Besonders eingegangen wird hierbei auf die Philosophie der Cliquen, auf die Mitglieder und deren Erscheinung, sowie auf Fahrten und Lieder. Die verschiedenen Regeln und Aufnahmeriten werden ebenfalls kurz thematisiert. Des Weiteren folgt ein Abschnitt über das Verhältnis der Wilden Cliquen zu anderen Jugendorganisationen der Weimarer Zeit. Abschließend werden die Wilden Cliquen speziell im Hinblick auf das Seminarthema zu den Aspekten Bildung, Erziehung und Sozialisation betrachtet, bevor zum Abschluss der Arbeit ein kurzes Fazit gezogen wird.
Die zeitgenössische Literatur stellt die Wilden Cliquen vor allem mit Hilfe von Interviews, Zeitungsberichten oder Dokumentationen, meist bezogen auf die Erscheinungen in der Reichshauptstadt Berlin, dar. Auf Grund dessen beschränken sich die Angaben in dieser Arbeit ebenfalls hauptsächlich auf die Stadt Berlin und weniger auf vergleichbare Erscheinungen in anderen Regionen, welche es jedoch trotzdem gegeben hat.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Entstehung und Entwicklung
- Mitglieder
- Philosophie
- Kleidung, Fahrten, Lieder
- Regeln und Riten
- Die Wilden Cliquen und andere Jugendorganisationen
- Sozialisation, Bildung und Erziehung in den Wilden Cliquen
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit den Wilden Cliquen in der Weimarer Zeit, einer Jugendkultur der Unterschicht, die in der öffentlichen Wahrnehmung als charakteristisch und bedrohlich wahrgenommen wurde. Die Arbeit untersucht die Entstehung und Entwicklung der Cliquen, beleuchtet deren Philosophie, Mitglieder, Erscheinungsbild, Fahrten, Lieder, Regeln und Aufnahmeriten, sowie das Verhältnis zu anderen Jugendorganisationen. Im Fokus steht die Analyse der Wilden Cliquen im Kontext von Bildung, Erziehung und Sozialisation.
- Entstehung und Entwicklung der Wilden Cliquen
- Philosophie und Ideologie der Cliquen
- Sozialisation und Bildung innerhalb der Cliquen
- Verhältnis der Cliquen zu anderen Jugendorganisationen
- Die Rolle der Cliquen im Kontext der Weimarer Republik
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung führt in das Thema der Wilden Cliquen in der Weimarer Zeit ein und beleuchtet die Wahrnehmung dieser Jugendkultur in der Öffentlichkeit. Sie skizziert den Aufbau der Arbeit und die Herangehensweise an die Thematik.
Entstehung und Entwicklung
Dieses Kapitel beleuchtet die Entstehung der Wilden Cliquen in Deutschland. Es werden verschiedene Theorien über ihre Ursprünge diskutiert, wie z.B. die Abspaltung von Wandervogelgruppen. Das Kapitel zeigt, wie sich die Cliquen in den 1910er und 1920er Jahren entwickelten und welche Faktoren zu ihrem Aufstieg beitrugen. Die Entstehung der „Ringe“ als Zusammenschluss von Cliquen und die Bedeutung der Krisenjahre der Weimarer Republik für die Ausbreitung der Cliquen werden ebenfalls beleuchtet.
Mitglieder
Dieses Kapitel beschreibt die Zusammensetzung der Wilden Cliquen, die vor allem aus Jugendlichen in der Pubertät oder kurz danach bestanden. Es werden die Lebensbedingungen der Mitglieder und ihre sozialen Hintergründe thematisiert.
Philosophie
Dieses Kapitel untersucht die Philosophie und Ideologie der Wilden Cliquen. Die Cliquen vertraten eine Gegenkultur, die sich von den traditionellen Werten und Normen der Gesellschaft abgrenzte. Es werden die wichtigsten Elemente dieser Philosophie beleuchtet und ihre Auswirkungen auf das Verhalten und die Lebensweise der Cliquenmitglieder dargestellt.
Kleidung, Fahrten, Lieder
Dieses Kapitel widmet sich dem Erscheinungsbild der Wilden Cliquen. Es beleuchtet ihre Kleidung, die sich als Ausdruck ihrer Rebellion und Gegenkultur verstehen ließ. Es wird außerdem auf die Bedeutung von Fahrten und Liedern für die Cliquen eingegangen und die Bedeutung dieser Elemente für die Identitätsbildung der Mitglieder erläutert.
Regeln und Riten
Dieses Kapitel befasst sich mit den Regeln und Riten der Wilden Cliquen. Die Cliquen entwickelten eigene Regeln und Rituale, die ihnen halfen, sich als Gruppe zu definieren und ihre soziale Ordnung zu etablieren. Es wird auf die Bedeutung dieser Regeln und Riten für die Integration der Mitglieder und die Abgrenzung von anderen Gruppen eingegangen.
Die Wilden Cliquen und andere Jugendorganisationen
Dieses Kapitel untersucht das Verhältnis der Wilden Cliquen zu anderen Jugendorganisationen der Weimarer Zeit, wie z.B. den Wandervogelgruppen und der Hitlerjugend. Es werden die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den Cliquen und anderen Jugendorganisationen aufgezeigt und die Rivalitäten und Konflikte zwischen ihnen analysiert.
Sozialisation, Bildung und Erziehung in den Wilden Cliquen
Dieses Kapitel untersucht die Rolle der Wilden Cliquen im Kontext von Sozialisation, Bildung und Erziehung. Es wird analysiert, wie die Cliquen die Jugendlichen in den Bereichen Bildung, Erziehung und Sozialisation prägten und welche Auswirkungen diese prägende Erfahrung auf das spätere Leben der Mitglieder hatte.
Schlüsselwörter
Wilden Cliquen, Weimarer Republik, Jugendkultur, Unterschicht, Bildung, Erziehung, Sozialisation, Gegenkultur, Rebellion, Rituale, Jugendorganisationen, Hitlerjugend, Wandervogel, Sozialisation, Lebensbedingungen.
Häufig gestellte Fragen
Wer waren die "Wilden Cliquen" in der Weimarer Republik?
Es waren informelle Jugendgruppen der städtischen Unterschicht, die eine Gegenkultur zu etablierten Jugendorganisationen bildeten und oft als bedrohlich wahrgenommen wurden.
Was war die Philosophie dieser Cliquen?
Ihre Philosophie basierte auf Freiheit, Rebellion gegen bürgerliche Normen und einem starken inneren Zusammenhalt, oft ausgedrückt durch eigene Lieder und Fahrten.
Warum wurden sie von der Öffentlichkeit als "Penner" bezeichnet?
Die Bezeichnung rührte von ihrem unangepassten Äußeren und ihrem Aufenthalt im öffentlichen Raum her, was von der bürgerlichen Gesellschaft als asozial missverstanden wurde.
Welche Rolle spielten Regeln und Riten?
Trotz ihres „wilden“ Images hatten viele Cliquen strenge Aufnahmeriten und interne Regeln, die die Loyalität und den Status innerhalb der Gruppe sicherten.
Wie standen die Cliquen zur Hitlerjugend?
Es bestand oft eine starke Rivalität; die Wilden Cliquen lehnten den militärischen Drill und die totale Vereinnahmung durch politische Organisationen meist ab.
- Citar trabajo
- Vanessa Falkenstein (Autor), 2010, Wilde Cliquen in der Weimarer Zeit, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/180566