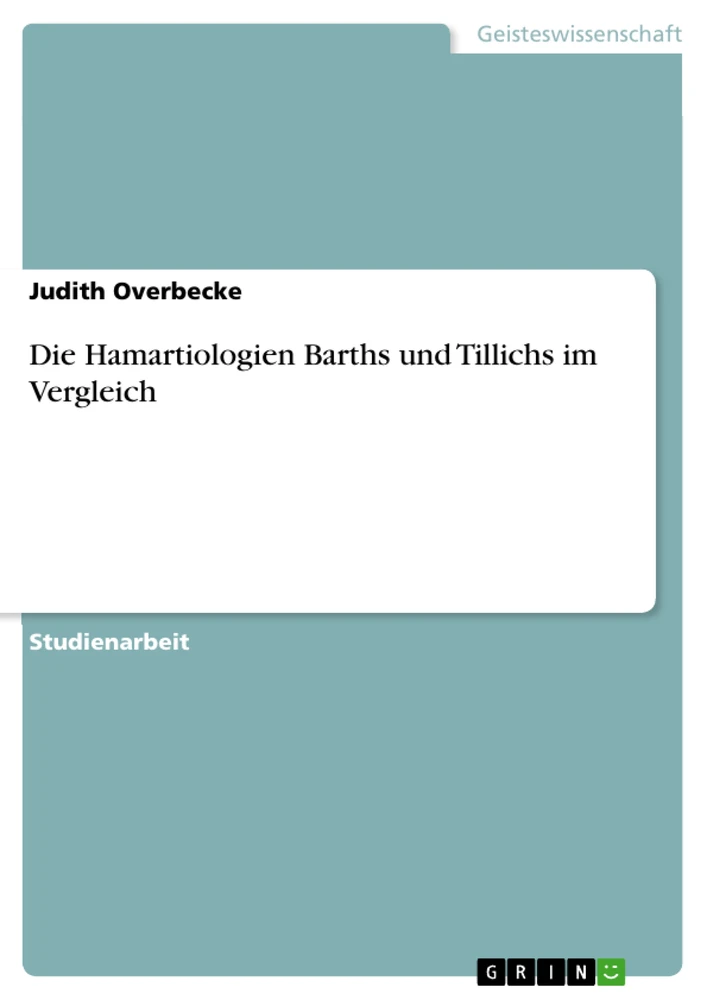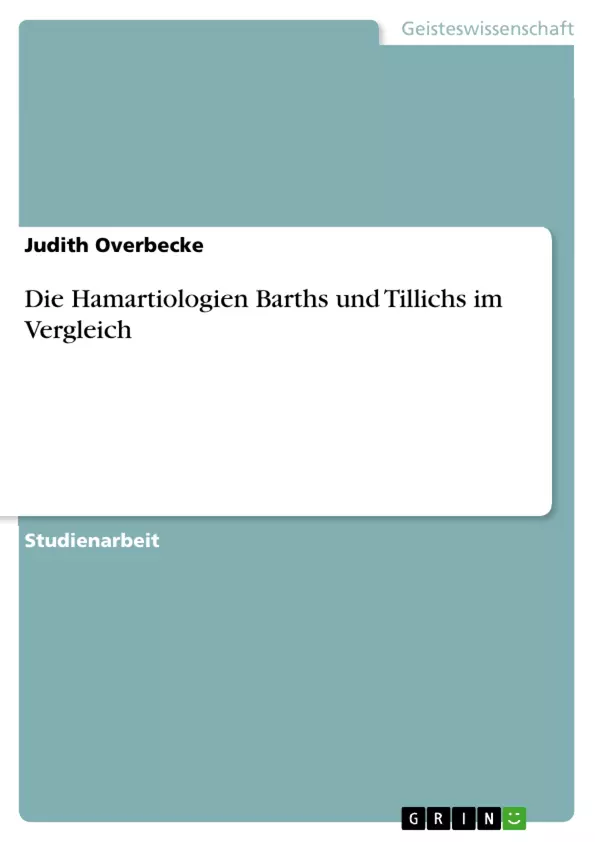Der französische Existentialist Jean Paul Sartre (1905-1980) beschreibt den Menschen als völlig freie Existenz, die sich auf ein selbstgesetztes Ziel hin entwerfen muss. Durch seinen freien Entwurf hat der Mensch die Möglichkeit, sein wahres Wesen, seine Essenz, zu verwirklichen. Die Essenz folgt aus der Existenz. Die menschliche Freiheit hat keine Grenze, nur die, die der Mensch sich durch Zielsetzung selbst gibt. Werte und Ideen werden nur durch Freiheit geschaffen, apriorisch oder ewig sind sie nicht. Es gibt auch keinen Gott.1
Ein gegensätzliches Menschenbild vertritt der evangelische Theologe Paul Tillich (1886-1965). Er sieht den Menschen als Gottes Ebenbild und geht vom einem vor-existentiellen Ideal des Menschen aus, der Essenz: Sie stellt einen vollkommenen, alle Potentialitäten involvierenden Zustand dar, in dem der Mensch noch in Einheit mit Gott ist. Tillich geht also von apriorischen Gegebenheiten aus. In der Existenz ist der Mensch von seinem essentiellen Wesen und Gott entfremdet und bleibt in der Welt immer hinter seiner Essenz zurück. Einen Freiheitsvollzug des Menschen innerhalb der existentiellen Entfremdung ohne Bezug zu Gott interpretiert Tillich als Sünde. Nicht-entfremdete Freiheit, die Einheit mit der Essenz ermöglicht, ist erst im Glauben, durch das Annehmen des Neuen Seins in Jesus Christus möglich.
Der reformierte Theologe Karl Barth (1886-1968) sieht den Menschen als wesenhaft zu einem ihm vorausgesetzten Gott gehörig. Freiheit hat der Mensch laut Barth nur, wenn er die Freiheit annimmt und umsetzt, die Gott ihm schenkt: Die Freiheit zum Bund mit Gott und dem Mitmenschen, in der Verantwortung vor Gott und im Gehorsam gegen ihn. Er kann sich nur auf Gott hin verwirklichen, ansonsten bleibt der Mensch der unfreie Mensch der Sünde.
Aus protestantischer Perspektive ist der Mensch Gottes Ebenbild aber bleibt ohne die göttliche Gnade, die er als Geschenk Gottes annehmen kann, die ihn rechtfertigt, immer unvollkommen und böse, also Sünder.
Sartres Freiheit wäre aus christlicher Perspektive missbrauchte Freiheit: Sie ist Ausdruck schamloser Selbstüberhebung des Menschen, der sich sündig von seinem eigentlichen Wesen und Gott abkehrt und sich selbst zum Gott macht.
[...]
Im Folgenden sollen die Hamartiologien Barths und Tillichs miteinander verglichen werden.Dabei soll besonders auf Barths und Tillichs Verständnis von Freiheit und damit zusammenhängender Sünde eingegangen werden. [...]
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- A. Fragestellung der Arbeit
- B. Barths und Tillichs Anliegen bei der Beschäftigung mit Sünde
- C. Quellen
- D. Vorgehensweise
- II. Hauptteil
- 1. Denkform und Methode
- 1.1 Barth: Wort-Gottes-Theologie
- 1.2 Paul Tillich: Methode der Korrelation
- 1.3 Vergleich
- 2. Dogmatischer Ort und Aufbau der Sündenlehre
- 3. Freiheit
- 4. Ist Sünde Folge von Freiheit?
- 1. Denkform und Methode
- III. Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit verfolgt das Ziel, die Hamartiologien Karl Barths und Paul Tillichs zu vergleichen und ihre Relevanz für das heutige Verständnis von Sünde zu untersuchen. Der Fokus liegt auf der Analyse der jeweiligen Konzepte von Freiheit und deren Zusammenhang mit dem Begriff der Sünde. Die Arbeit beleuchtet die Unterschiede und Gemeinsamkeiten beider Theologen in ihrer methodischen Vorgehensweise und ihren dogmatischen Einordnungen der Sündenlehre.
- Vergleich der Denkformen und Methoden Barths und Tillichs
- Analyse des dogmatischen Ortes und Aufbaus der jeweiligen Sündenlehren
- Untersuchung der Freiheitsbegriffe bei Barth und Tillich
- Klärung des Zusammenhangs von Freiheit und Sünde bei beiden Theologen
- Bewertung der Relevanz der Hamartiologien für das heutige Verständnis von Sünde
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitung: Die Einleitung stellt die zentrale Forschungsfrage nach der Relevanz der Hamartiologien Barths und Tillichs für die heutige Zeit. Sie kontrastiert zunächst die anthropologischen Positionen Sartres, Tillichs und Barths, um den Hintergrund des Vergleichs zu beleuchten. Die unterschiedlichen Auffassungen von Freiheit und deren Implikationen für das Verständnis von Sünde werden als Ausgangspunkt der folgenden Analyse etabliert. Die Arbeit erläutert kurz die Anliegen Barths und Tillichs bei der Beschäftigung mit Sünde, nennt die verwendeten Quellen und skizziert die Vorgehensweise des Vergleichs.
II. Hauptteil: Der Hauptteil gliedert sich in mehrere Abschnitte, die systematisch die Hamartiologien Barths und Tillichs vergleichen. Zuerst werden die Denkformen und Methoden beider Theologen analysiert, um ihre unterschiedlichen Zugänge zum Thema zu verstehen. Im Anschluss daran wird der dogmatische Ort und Aufbau ihrer jeweiligen Sündenlehren im Kontext ihrer Gesamtwerke untersucht. Ein zentraler Abschnitt beschäftigt sich mit den Freiheitsbegriffen beider Theologen und deren Beziehung zur Sünde. Schließlich wird die Frage diskutiert, inwieweit Sünde als Folge von Freiheit betrachtet werden kann und wie dies von Barth und Tillich jeweils beantwortet wird. Dieser Vergleich umfasst eine detaillierte Gegenüberstellung ihrer Konzepte von Sünde, einschließlich der jeweiligen Arten und Ausprägungen von Sünde und deren Ursachen.
Schlüsselwörter
Hamartiologie, Karl Barth, Paul Tillich, Freiheit, Sünde, Wort-Gottes-Theologie, Korrelation, Dogmatik, Systematische Theologie, Schöpfungslehre, Versöhnungslehre, Entfremdung, Gottes Ebenbild, menschliche Freiheit, Sündenfall, Erbsünde.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Vergleich der Hamartiologien Barths und Tillichs
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit vergleicht die Hamartiologien (Lehren von der Sünde) von Karl Barth und Paul Tillich und untersucht deren Relevanz für das heutige Verständnis von Sünde. Der Fokus liegt auf den Konzepten von Freiheit und deren Zusammenhang mit Sünde bei beiden Theologen.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt den Vergleich der Denkformen und Methoden von Barth und Tillich, die Analyse des dogmatischen Ortes und Aufbaus ihrer jeweiligen Sündenlehren, die Untersuchung der Freiheitsbegriffe bei beiden Theologen, die Klärung des Zusammenhangs von Freiheit und Sünde, und die Bewertung der Relevanz der Hamartiologien für das heutige Verständnis von Sünde.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, einen Hauptteil und einen Schluss. Die Einleitung stellt die Forschungsfrage und die Vorgehensweise vor. Der Hauptteil vergleicht systematisch die Hamartiologien Barths und Tillichs, analysiert deren Denkformen und Methoden, untersucht den dogmatischen Ort und Aufbau der Sündenlehren, die Freiheitsbegriffe und den Zusammenhang von Freiheit und Sünde. Der Schluss fasst die Ergebnisse zusammen.
Welche Methoden werden angewendet?
Die Arbeit verwendet eine vergleichende Methode, um die Hamartiologien Barths und Tillichs zu analysieren. Es werden die Denkformen und Methoden beider Theologen (Wort-Gottes-Theologie bei Barth, Korrelationsmethode bei Tillich) berücksichtigt und ihre dogmatischen Einordnungen der Sündenlehre untersucht.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant?
Schlüsselbegriffe sind Hamartiologie, Karl Barth, Paul Tillich, Freiheit, Sünde, Wort-Gottes-Theologie, Korrelation, Dogmatik, Systematische Theologie, Schöpfungslehre, Versöhnungslehre, Entfremdung, Gottes Ebenbild, menschliche Freiheit, Sündenfall, Erbsünde.
Was ist die zentrale Forschungsfrage?
Die zentrale Forschungsfrage ist die Relevanz der Hamartiologien Barths und Tillichs für das heutige Verständnis von Sünde. Die Arbeit untersucht, wie die unterschiedlichen Konzepte von Freiheit bei beiden Theologen das Verständnis von Sünde beeinflussen.
Welche Quellen werden verwendet?
Die Arbeit nennt die verwendeten Quellen in der Einleitung, jedoch wird die genaue Liste der Quellen im gegebenen Auszug nicht aufgeführt.
Welche Kapitel gibt es?
Die Arbeit ist in drei Hauptteile gegliedert: I. Einleitung (Fragestellung, Anliegen Barths und Tillichs, Quellen, Vorgehensweise), II. Hauptteil (Denkform und Methode, dogmatischer Ort und Aufbau der Sündenlehre, Freiheit, Sünde als Folge von Freiheit) und III. Schluss.
- Quote paper
- Judith Overbecke (Author), 2004, Die Hamartiologien Barths und Tillichs im Vergleich, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/180733