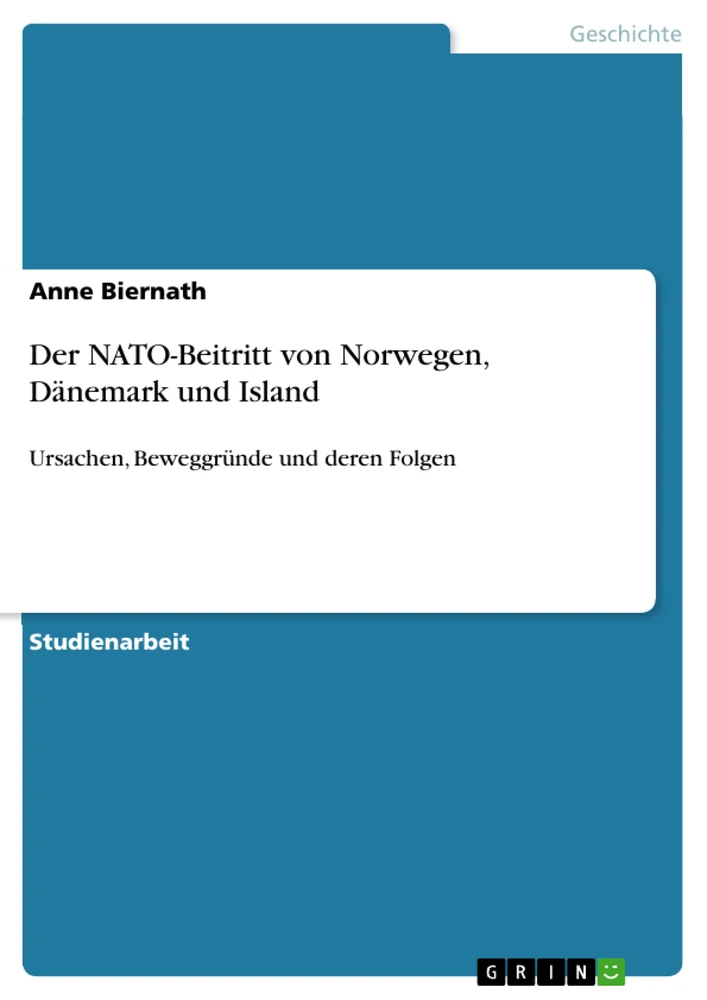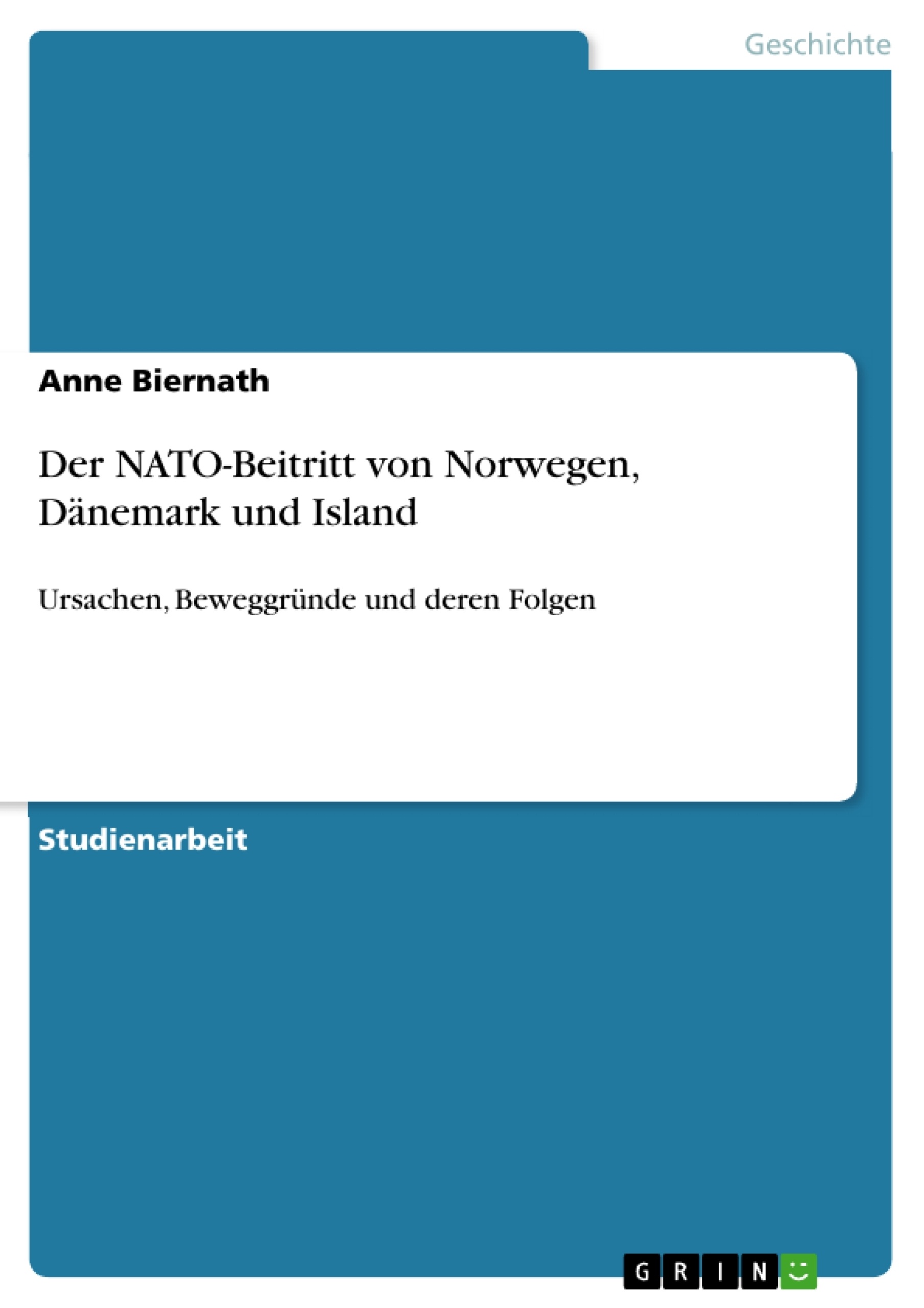Über den Kalten Krieg, dessen Verlauf und Folgen, gibt es reichlich Literatur. Vieles wurde geschrieben, diskutiert und verstanden. Doch wie kam es zu einer Formierung der Blöcke? Welche Umstände trugen dazu bei? Wann begann der Kalte Krieg wirklich?
Auf politischer und militärischer Sicht muss die Situation nach Kriegsende in Deutschland und Berlin, welche die Gegensätze zwischen den Alliierten offen hervor trugen, angeführt werden. Jedoch stellte ein wichtiger Einschnitt in eine künftige Zusammenarbeit – oder zu mindestens Akzeptanz des Ostblocks – durch die westlichen Alliierten die Gründung der NATO 1949 da. Denn der transatlantische Pakt der Westmächte formte eine Einheit, die sich aufgrund der Gefahr die aus dem Osten, in Form der UdSSR, drohte, zum Schutz und zur Sicherheit gegen den ideologischen Gegner. Die Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten war nicht nur auf das Militärische beschränkt. Auch die Wirtschaft und der Handel spielte eine entscheide Rolle in der Kooperation der Westmächte.
Doch wie kam es dazu, dass drei Länder des Nordens – Norwegen, Dänemark und Island – die vor dem zweiten Weltkrieg in außenpolitischen Angelegenheiten irrelevant waren und zudem über kaum militärische Ressourcen verfügten, da sie einer strikten Neutralitätspolitik folgten, in einem so mächtigen Bündnis mitwirkten und dort eine so bedeutende Rolle einnahmen?
Um dieser Frage zu beantworten, muss geklärt werden, welche Ursachen und Beweggründe es für die drei skandinavischen Länder gab und welche Folgen sich aus dem NATO-Beitritt für die Länder Nordeuropas sowie für die anderen Mitglieder der NATO ergaben.
Diese Arbeit wird sich zunächst mit der Vorgeschichte der NATO (2.), sowie mit der Gründung der NATO (3.) beschäftigen, um herauszuarbeiten, wie es zu dem transatlantischen Bündnis gekommen ist, welche Faktoren es beeinflussten und welche Konflikte und Problem, sowie Chancen und Alternativen besprochen wurden.
Die Staaten Nordeuropas waren jedoch, obwohl Dänemark, Norwegen und Island als Gründungsmitglieder angegeben werden, zu den Vorverhandlungen nicht eingeladen. Deshalb soll im Verlauf der Arbeit geklärt werden, welche Faktoren, Beweggründe und Ursachen den Beitritt beeinflussten (4.) und welche Bedeutung die Länder Nordeuropas für die beratenden Parteien und insbesondere der USA hatten.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Vorgeschichte der NATO
- Gründung der NATO
- Ursachen, Beweggründe und Folgen des NATO-Beitritts
- Norwegen
- Dänemark
- Island
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Ursachen und Beweggründe für den Beitritt Norwegens, Dänemarks und Islands zur NATO nach dem Zweiten Weltkrieg. Sie beleuchtet die Rolle dieser drei skandinavischen Länder im Kontext des Kalten Krieges und analysiert die Folgen des NATO-Beitritts für die beteiligten Länder und das Bündnis selbst.
- Die Vorgeschichte der NATO und die Entstehung des transatlantischen Bündnisses
- Die individuellen Beweggründe der drei skandinavischen Länder für den NATO-Beitritt
- Die Bedeutung der USA als dominierende Kraft im Bündnis und deren Einfluss auf die skandinavischen Länder
- Die Folgen des NATO-Beitritts für Norwegen, Dänemark, Island und die NATO
- Der Vergleich der außenpolitischen Strategien der drei skandinavischen Staaten vor und nach dem NATO-Beitritt.
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik des NATO-Beitritts von Norwegen, Dänemark und Island ein und stellt die zentrale Forschungsfrage nach den Ursachen, Beweggründen und Folgen dieses Schrittes. Sie betont die scheinbar paradoxen Aspekte: die vorherige strikte Neutralitätspolitik dieser Länder und ihr anschließender Beitritt zu einem mächtigen militärischen Bündnis. Die Einleitung skizziert den Aufbau der Arbeit und hebt die Bedeutung der USA im Kontext des transatlantischen Bündnisses hervor, wobei der Einfluss der USA auf die Entscheidungen der skandinavischen Länder im Mittelpunkt steht.
2. Vorgeschichte der NATO: Dieses Kapitel beschreibt die politische Atmosphäre nach dem Zweiten Weltkrieg, die durch die wachsenden Spannungen zwischen den Westmächten (USA, Großbritannien, Frankreich) und der UdSSR geprägt war. Der Fokus liegt auf den Ereignissen, die zum Zusammenschluss der Westmächte führten, insbesondere der Prager Coup von 1948. Das Kapitel analysiert die Versuche, eine „dritte Kraft“ zwischen den beiden Blöcken zu bilden, und die wachsende Notwendigkeit eines westeuropäischen Bündnisses als Reaktion auf die sowjetische Expansion. Es wird deutlich, dass der Wunsch nach amerikanischer Unterstützung und militärischer Stärke die Bemühungen um einen westeuropäischen Pakt antrieb. Die Bemühungen der Benelux-Staaten um ein multilaterales Bündnis und die anfängliche Zurückhaltung der USA werden detailliert dargestellt.
Häufig gestellte Fragen zur Arbeit: Ursachen, Beweggründe und Folgen des NATO-Beitritts Norwegens, Dänemarks und Islands
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Ursachen und Beweggründe für den Beitritt Norwegens, Dänemarks und Islands zur NATO nach dem Zweiten Weltkrieg. Sie analysiert die Rolle dieser drei skandinavischen Länder im Kontext des Kalten Krieges und die Folgen des NATO-Beitritts für die beteiligten Länder und das Bündnis selbst. Ein besonderes Augenmerk liegt auf dem scheinbar paradoxen Wechsel von strikter Neutralitätspolitik zum Beitritt zu einem militärischen Bündnis und dem Einfluss der USA auf diese Entscheidung.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in die Kapitel: Einleitung, Vorgeschichte der NATO, Gründung der NATO, Ursachen, Beweggründe und Folgen des NATO-Beitritts (mit Unterkapiteln zu Norwegen, Dänemark und Island) und Fazit. Jedes Kapitel liefert detaillierte Informationen zu den jeweiligen Aspekten.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit beleuchtet die Vorgeschichte der NATO und die Entstehung des transatlantischen Bündnisses. Sie analysiert die individuellen Beweggründe der drei skandinavischen Länder für den NATO-Beitritt, die Bedeutung der USA als dominierende Kraft im Bündnis und deren Einfluss auf die skandinavischen Länder, sowie die Folgen des NATO-Beitritts für Norwegen, Dänemark, Island und die NATO. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf dem Vergleich der außenpolitischen Strategien der drei skandinavischen Staaten vor und nach dem NATO-Beitritt.
Was wird in der Einleitung erläutert?
Die Einleitung führt in die Thematik ein und stellt die zentrale Forschungsfrage nach den Ursachen, Beweggründen und Folgen des NATO-Beitritts. Sie betont den scheinbar paradoxen Aspekt des Wechsels von Neutralität zu Bündnismitgliedschaft und skizziert den Aufbau der Arbeit. Der Einfluss der USA und deren Bedeutung im Kontext des transatlantischen Bündnisses wird hervorgehoben.
Welche Aspekte werden in der Vorgeschichte der NATO behandelt?
Dieses Kapitel beschreibt die politische Atmosphäre nach dem Zweiten Weltkrieg, die durch die Spannungen zwischen den Westmächten und der UdSSR geprägt war. Es analysiert die Ereignisse, die zum Zusammenschluss der Westmächte führten (z.B. der Prager Coup), die Versuche, eine „dritte Kraft“ zu bilden, und die wachsende Notwendigkeit eines westeuropäischen Bündnisses als Reaktion auf die sowjetische Expansion. Die Rolle der USA und deren Einfluss werden detailliert dargestellt.
Wie werden die einzelnen Länder (Norwegen, Dänemark, Island) behandelt?
Die Arbeit widmet sich jedem der drei Länder im Kapitel "Ursachen, Beweggründe und Folgen des NATO-Beitritts" in eigenen Unterkapiteln. Hier werden die spezifischen Ursachen und Beweggründe für den NATO-Beitritt jedes Landes im Detail untersucht.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
(Der Inhalt des Fazit-Kapitels wird in der gegebenen Vorschau nicht dargestellt. Die detaillierte Zusammenfassung der Ergebnisse und Schlussfolgerungen ist im vollständigen Dokument enthalten.)
Für wen ist diese Arbeit bestimmt?
Diese Arbeit richtet sich an Personen, die sich akademisch mit der Geschichte der NATO, dem Kalten Krieg und der Außenpolitik Skandinaviens auseinandersetzen möchten.
- Quote paper
- Anne Biernath (Author), 2011, Der NATO-Beitritt von Norwegen, Dänemark und Island, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/180779