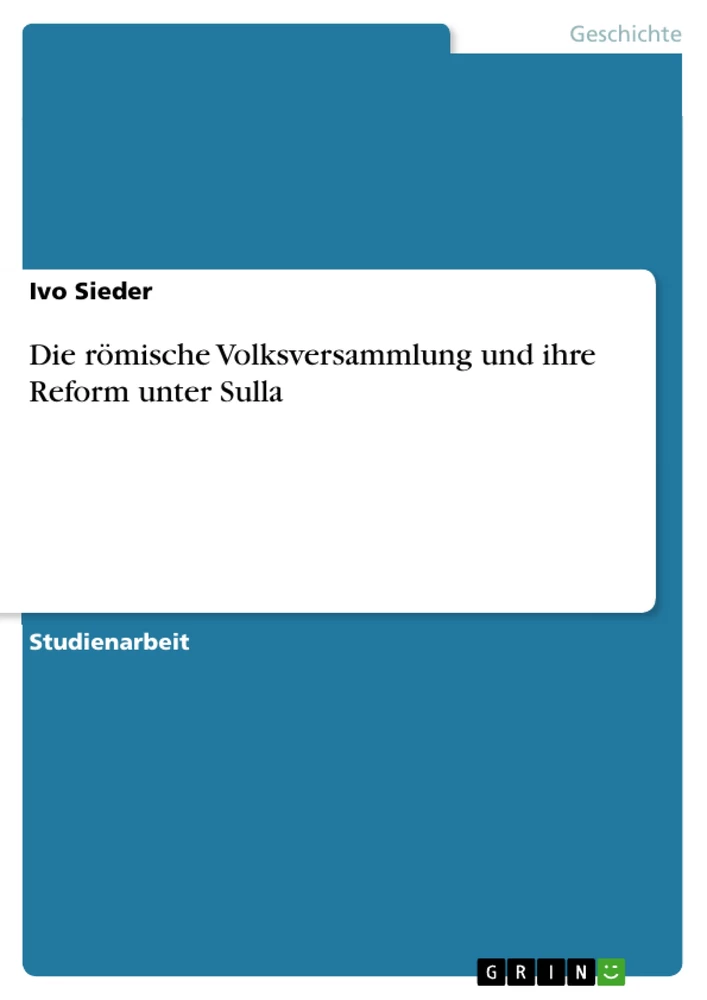Diese Hausarbeit untersucht, warum Sulla sich gezwungen sah den Einfluss der Volksversammlung zu beschränken, wie Sulla versuchte dies zu erreichen und ob seine Maßnahmen erfolgreich waren. Hierzu wird zunächst die Geschichte und Struktur der drei Typen der römischen Volksversammlung, der comitia curiata, comitia centuriata und comitia tributa sowie der informellen Versammlungen, den contiones dargestellt. Daran anschließend folgt eine kurze Darstellung des Volkstribunats, da die beiden Institutionen Volksversammlung und Volkstribunat, nur wenn sie gemeinsam agierten, die Republik (und die kollektive Herrschaft der Nobilität) destabilisieren konnten und auch gemeinsam von Sulla bekämpft wurden. Es schließt sich an ein historischer Abriss der Krisenzeit der Republik bis zu Sulla, beginnend mit den Gracchen; Sulla und seine Politik sind nur zu verstehen aus der Erfahrung der ihm vorangegangenen fünfzig Jahre. Anschließend wird die von Sulla geschaffene Verfassung dargestellt und daraufhin analysiert, welche Maßnahmen er zur Eindämmung der Volksversammlung traf.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Struktur und Geschichte der Volksversammlung
- a) allgemeine Charakteristika
- b) comitia curiata
- c) comitia centuriata
- d) comitia tributa
- e) contiones
- III. Das Volkstribunat
- IV. Die Krise der Republik von den Gracchen bis Sulla
- V. Die Neuordnung durch Sulla
- a) Die Neuordnung
- b) Die Nachwirkungen
- VI. Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die römische Volksversammlung und deren Reform unter Sulla. Das Hauptziel ist es, Sullas Motivation für die Beschränkung der Macht der Volksversammlung und des Volkstribunats zu analysieren, seine Vorgehensweise zu beschreiben und den Erfolg seiner Maßnahmen zu bewerten.
- Die Struktur und Geschichte der verschiedenen Arten römischer Volksversammlungen (comitia curiata, comitia centuriata, comitia tributa).
- Die Rolle des Volkstribunats und seine enge Verbindung zur Volksversammlung.
- Die politische Krise der römischen Republik vor Sullas Reform, insbesondere die Ereignisse seit den Gracchen.
- Sullas Maßnahmen zur Neuordnung des politischen Systems und die Auswirkungen auf die Volksversammlung.
- Die Bedeutung der Volksversammlung im römischen Staats- und Werteverständnis.
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitung: Die Einleitung stellt die drei wichtigsten politischen Institutionen der römischen Republik – Senat, Magistratur und Volksversammlung – vor und hebt die vergleichsweise geringe Aufmerksamkeit, die die Volksversammlung in der Literatur erhält, hervor. Sie führt die Forschungsfrage ein: War die Volksversammlung ein bloßes Instrument der Nobilität oder ein mächtiges politisches Organ? Die Arbeit untersucht Sullas Maßnahmen zur Beschränkung der Macht der Volksversammlung, ihre historischen Hintergründe und ihre Effektivität. Die Methodik wird skizziert, und die wichtigsten antiken und modernen Quellen werden genannt. Die Einleitung betont die Notwendigkeit, die Volksversammlung im Kontext der gesamten politischen Struktur und der zeitgenössischen Krisen zu betrachten.
II. Struktur und Geschichte der Volksversammlung: Dieses Kapitel beschreibt die verschiedenen Arten der römischen Volksversammlungen. Es wird betont, dass es nicht „die“ römische Volksversammlung gab, sondern verschiedene Versammlungstypen mit unterschiedlicher Zusammensetzung, Struktur und Kompetenzen. Das Kapitel erläutert die allgemeinen Charakteristika aller Versammlungen, wie die öffentliche Ankündigung, die Aufteilung in Stimmkörper, die Durchführung von Auspizien und die ursprünglich öffentliche Stimmabgabe. Es werden die comitia curiata, comitia centuriata und comitia tributa im Detail behandelt, wobei auf ihre historische Entwicklung, Zusammensetzung und Bedeutung für die spät-republikanische Politik eingegangen wird. Der Unterschied zur griechischen Volksversammlung wird herausgestellt.
Schlüsselwörter
Römische Republik, Volksversammlung, comitia curiata, comitia centuriata, comitia tributa, Volkstribunat, Sulla, Reform, politische Krise, Nobilität, Senat, Magistratur, antike Quellen, römisches Staatsrecht.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Hausarbeit: Die Römische Volksversammlung und ihre Reform unter Sulla
Was ist der Gegenstand dieser Hausarbeit?
Die Hausarbeit untersucht die römische Volksversammlung und ihre Reform unter Sulla. Im Fokus steht die Analyse von Sullas Motivation für die Machtbeschränkung der Volksversammlung und des Volkstribunats, seine Vorgehensweise und der Erfolg seiner Maßnahmen.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Struktur und Geschichte verschiedener römischer Volksversammlungen (comitia curiata, comitia centuriata, comitia tributa), die Rolle des Volkstribunats, die politische Krise der Republik vor Sullas Reform (insbesondere seit den Gracchen), Sullas Maßnahmen zur politischen Neuordnung und deren Auswirkungen auf die Volksversammlung, sowie die Bedeutung der Volksversammlung im römischen Staats- und Werteverständnis.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in sechs Kapitel: Einleitung, Struktur und Geschichte der Volksversammlung, Das Volkstribunat, Die Krise der Republik von den Gracchen bis Sulla, Die Neuordnung durch Sulla, und Schluss. Jedes Kapitel wird im Inhaltsverzeichnis detailliert aufgelistet.
Was wird in der Einleitung behandelt?
Die Einleitung stellt die drei wichtigsten politischen Institutionen der römischen Republik (Senat, Magistratur, Volksversammlung) vor, führt die Forschungsfrage nach der tatsächlichen Macht der Volksversammlung ein und skizziert die Methodik und die verwendeten Quellen. Sie betont die Notwendigkeit, die Volksversammlung im Kontext der gesamten politischen Struktur und der zeitgenössischen Krisen zu betrachten.
Wie beschreibt die Arbeit die Struktur und Geschichte der Volksversammlung?
Kapitel II beschreibt die verschiedenen Arten römischer Volksversammlungen und deren Unterschiede in Zusammensetzung, Struktur und Kompetenzen. Es erläutert allgemeine Charakteristika wie öffentliche Ankündigung, Stimmabgabe und Auspizien und behandelt die comitia curiata, comitia centuriata und comitia tributa detailliert, inklusive ihrer historischen Entwicklung und Bedeutung für die spät-republikanische Politik. Der Vergleich mit der griechischen Volksversammlung wird ebenfalls angestellt.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Schlüsselwörter sind: Römische Republik, Volksversammlung, comitia curiata, comitia centuriata, comitia tributa, Volkstribunat, Sulla, Reform, politische Krise, Nobilität, Senat, Magistratur, antike Quellen, römisches Staatsrecht.
Welches ist das zentrale Forschungsziel?
Das Hauptziel der Arbeit ist die Analyse von Sullas Motivation, Vorgehensweise und dem Erfolg seiner Maßnahmen zur Beschränkung der Macht der Volksversammlung und des Volkstribunats.
Welche Quellen werden verwendet?
Die Arbeit bezieht sich auf sowohl antike als auch moderne Quellen, welche in der Einleitung näher spezifiziert werden.
- Quote paper
- Ivo Sieder (Author), 2006, Die römische Volksversammlung und ihre Reform unter Sulla, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/180812