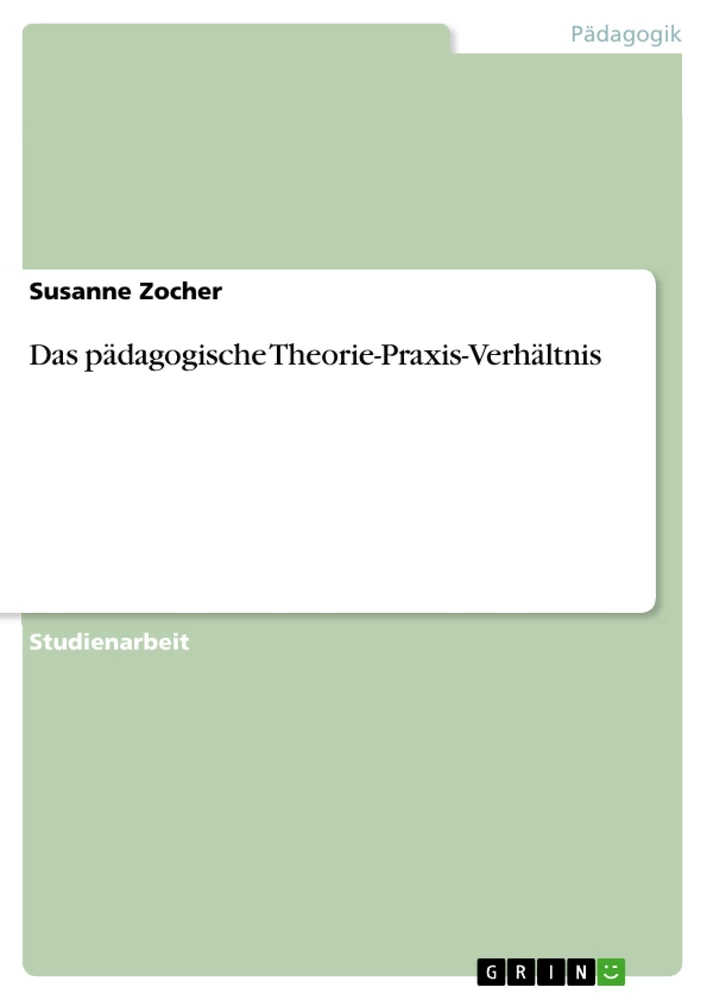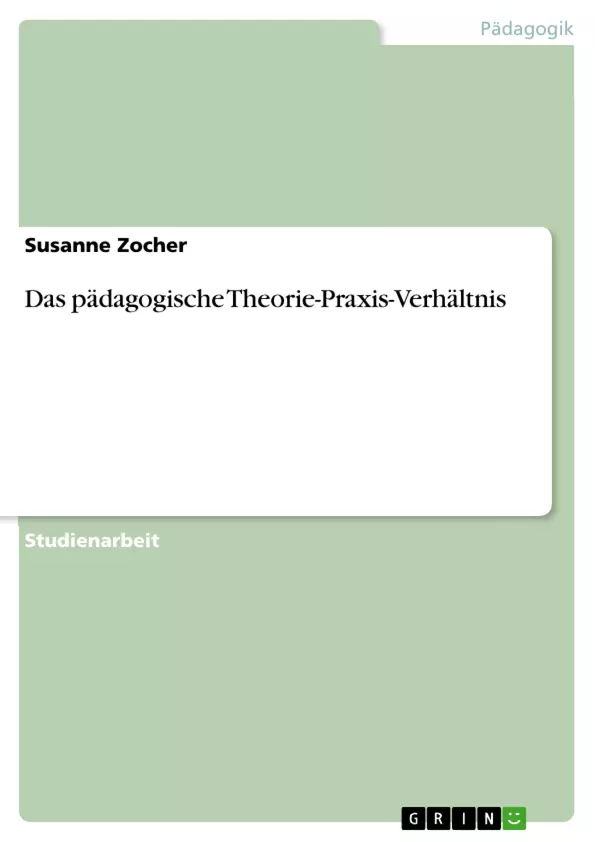Eine „klare Einsicht in die Struktur der pädagogischen Arbeit, de[r] Zusammenhang ihrer Begriffe und Methoden […] veredelt diese Arbeit erst zu bewußter und in sich begründender Leistung […] und gibt die Grundlage für eine Gemeinschaft der Arbeit und für einen reinen Stil der pädagogischen Lebensform.“ „[D]as Ideal der Theorie erhebt sich aus der Praxis, indem sie diese formuliert, begründet und in ihren Konsequenzen entwickelt.“
Mit diesen Worten spricht Herman Nohl ein Problem an, welches von den Wissenschaftlern häufig diskutiert wird, nämlich das Problem des Verhältnisses zwischen Theorie und Praxis in der Pädagogik. Es stellt sich die Frage, wie denn das wirkliche Verhältnis beider zueinander aussieht. Stehen sich Theorie und Praxis gegenüber und konkurrieren miteinander, oder beeinflussen sie sich wechselseitig? Wenn letzteres der Fall ist, inwiefern beeinflussen sie sich und ist die Praxis dann eher von der Theorie abhängig, oder verhält es sich so, dass die Theorie von der Praxis abhängig ist? In der vorliegenden Arbeit soll dieses Verhältnis besonders hervorgehoben werden.
Im ersten Teil der Arbeit werden die Begriffe Theorie und Praxis, sowie ihr Zusammenhang mit der Pädagogik, untersucht. Dabei wird vor allen Dingen auf die Geschichte und das heutige Verständnis der beiden Begriffe eingegangen. Die zweite Hälfte, welche den Hauptteil der Arbeit darstellen soll, befasst sich mit dem pädagogischen Theorie-Praxis-Verhältnis. Hierbei wird besonders auf das Verhältnis im Allgemeinen, sowie auf positive und negative Seiten eingegangen.
Ich habe dieses Thema gewählt, weil es von Herman Nohl nur sehr kurz angeschnitten wurde und ich mehr darüber erfahren wollte, denn vorher hatte ich mir noch keine Gedanken über ein mögliches pädagogisches Theorie-Praxis-Verhältnis gemacht, obwohl dieses Thema häufig in der Pädagogik, vor allen Dingen in der Erziehungswissenschaft diskutiert wird.
Eine empfehlenswerte Hilfe zu diesem Thema sind die Bücher „Das Verhältnis von Theorie und Praxis in der Pädagogik. Eine systematische Untersuchung.“ von Wilhelmine M. Sayler und „Die Vermittlung zwischen Theorie und Praxis in der Pädagogik.“ von Jürgen Oelkers, da sich diese beiden Autoren ausgiebig mit diesem Thema auseinandergesetzt haben.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Theoriebegriff
- Der Theoriebegriff im allgemeinen Sinn
- Der Theoriebegriff im pädagogischen Sinn
- Der Praxisbegriff
- Der Praxisbegriff im allgemeinen Sinn
- Der Praxisbegriff im pädagogischen Sinn
- Das Theorie- Praxis-Verhältnis in der Pädagogik
- Das Verhältnis allgemein
- Das Verhältnis im positiven Sinn
- Das Verhältnis im negativen Sinn
- Die theoretischen Aufgaben in Bezug auf die Praxis
- Schlussbemerkungen
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem Verhältnis zwischen Theorie und Praxis in der Pädagogik. Sie untersucht die beiden Begriffe im allgemeinen und im pädagogischen Sinn und analysiert, wie sich Theorie und Praxis in der pädagogischen Praxis gegenseitig beeinflussen. Die Arbeit beleuchtet sowohl positive als auch negative Aspekte dieses Verhältnisses und geht auf die Rolle der Theorie in Bezug auf die Praxis ein.
- Definition und Entwicklung des Theoriebegriffs in der Pädagogik
- Definition und Entwicklung des Praxisbegriffs in der Pädagogik
- Das Verhältnis zwischen Theorie und Praxis in der Pädagogik
- Positive und negative Aspekte des Theorie-Praxis-Verhältnisses
- Die Rolle der Theorie in Bezug auf die Praxis
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema des pädagogischen Theorie-Praxis-Verhältnisses ein und stellt die Relevanz der Thematik heraus. Sie beleuchtet die Problematik der Beziehung zwischen Theorie und Praxis in der Pädagogik und stellt die Forschungsfrage nach der Art und Weise der gegenseitigen Beeinflussung beider Bereiche.
Das zweite Kapitel befasst sich mit dem Theoriebegriff. Es wird zunächst der allgemeine Sinn des Begriffs "Theorie" erläutert, bevor der Fokus auf den pädagogischen Sinn des Begriffs gelegt wird. Hierbei wird die Bedeutung von pädagogischen Theorien für die Praxis und die Notwendigkeit einer wissenschaftlichen Fundierung dieser Theorien hervorgehoben.
Das dritte Kapitel widmet sich dem Praxisbegriff. Es wird zunächst der allgemeine Sinn des Begriffs "Praxis" erläutert, bevor der Fokus auf den pädagogischen Sinn des Begriffs gelegt wird. Hierbei wird die Bedeutung von Praxis für die Pädagogik und die Notwendigkeit einer wissenschaftlichen Fundierung der Praxis hervorgehoben.
Das vierte Kapitel analysiert das pädagogische Theorie-Praxis-Verhältnis. Es wird zunächst das Verhältnis allgemein betrachtet, bevor positive und negative Aspekte des Verhältnisses beleuchtet werden. Abschließend werden die theoretischen Aufgaben in Bezug auf die Praxis erörtert.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen das pädagogische Theorie-Praxis-Verhältnis, die Definition und Entwicklung des Theoriebegriffs, die Definition und Entwicklung des Praxisbegriffs, die Beziehung zwischen Theorie und Praxis in der Pädagogik, positive und negative Aspekte des Theorie-Praxis-Verhältnisses sowie die Rolle der Theorie in Bezug auf die Praxis.
Häufig gestellte Fragen
Wie stehen Theorie und Praxis in der Pädagogik zueinander?
Die Arbeit untersucht, ob sie konkurrieren oder sich wechselseitig beeinflussen, wobei Theorie oft die Praxis formuliert und begründet.
Was ist Herman Nohls Ansicht zum Theorie-Praxis-Verhältnis?
Nohl betont, dass eine klare Einsicht in die Struktur der pädagogischen Arbeit diese erst zu einer bewussten Leistung veredelt.
Was sind die Aufgaben der Theorie in Bezug auf die Praxis?
Theorie soll pädagogisches Handeln reflektieren, wissenschaftlich fundieren und Konsequenzen für die Erziehungswissenschaft entwickeln.
Gibt es negative Aspekte im Theorie-Praxis-Verhältnis?
Ja, die Arbeit beleuchtet auch die Diskrepanzen, wenn wissenschaftliche Theorien zu abstrakt für die konkrete pädagogische Anwendung sind.
Warum ist dieses Thema für die Erziehungswissenschaft so wichtig?
Weil die Professionalität von Pädagogen darauf beruht, ihr Handeln (Praxis) theoretisch begründen und reflektieren zu können.
- Quote paper
- Susanne Zocher (Author), 2008, Das pädagogische Theorie-Praxis-Verhältnis, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/180898