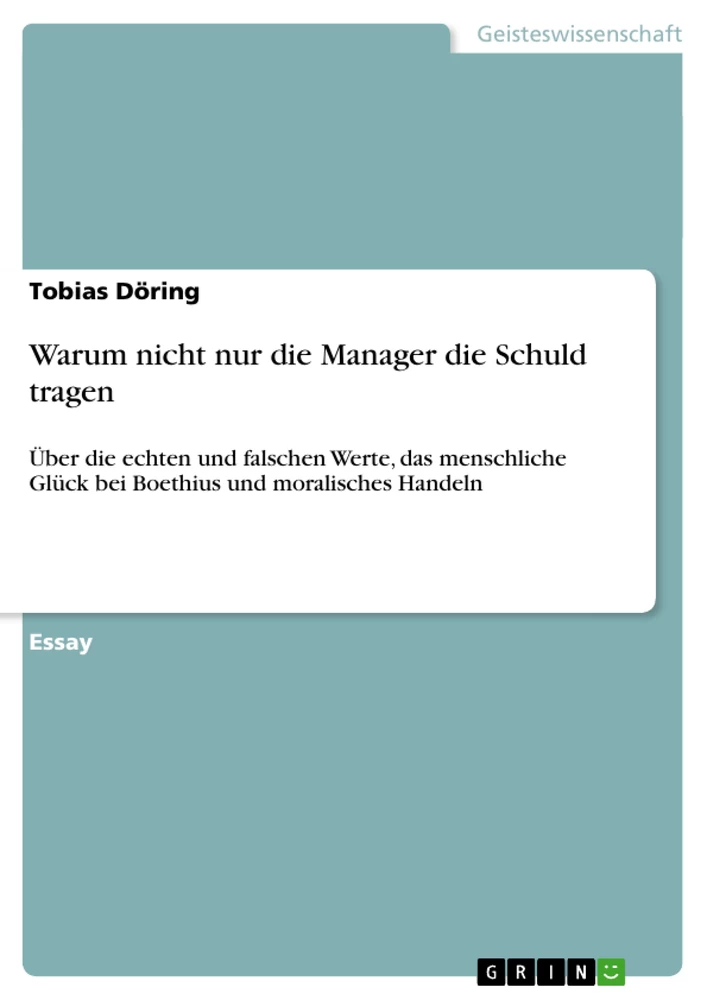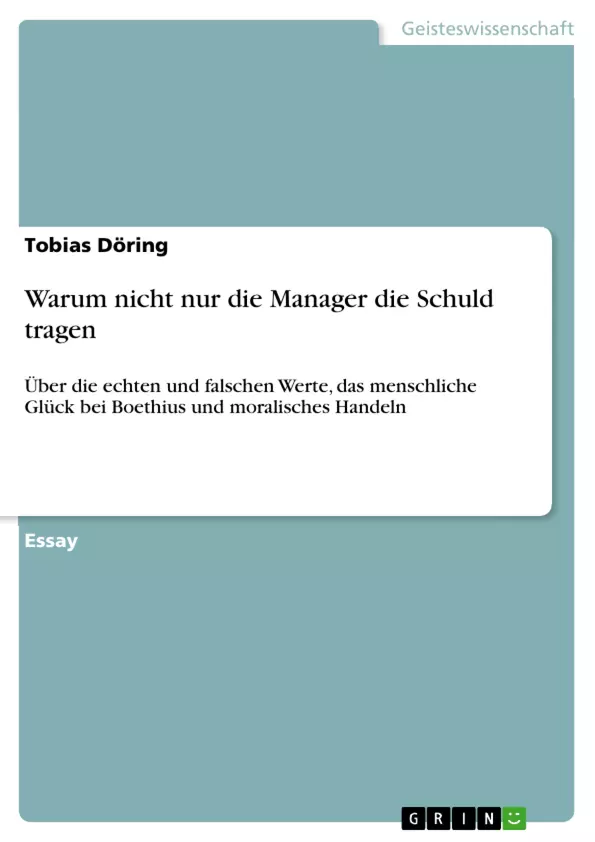Zwei Schritte vor und einen zurück. Und wieder zwei Schritte nach vorn. Der zyklische Wachstumsprozess der Marktwirtschaft begleitet die industrialisierte Gesellschaft Europas und des Nordatlantiks seit dem 18./19. Jahrhundert und sorgt mit regelmäßigen Konjunktureinbrüchen, ausgelöst durch sogenannte Krisen, für temporär steigende Arbeitslosigkeit und Armut. Diese auftretenden, kurz- oder langlebigen sozialen Verwerfungen führen immer wieder zu heftigen Erschütterungen der politischen Systeme. Nun könnte man annehmen, dass diese zyklischen Schwankungen ein Phänomen sind, welche dem marktwirtschaftlichen Prinzipien innewohnen und jeder externe politische Eingriff würde einem Duell von Gut gegen Böse1 gleichkommen. Nun ist der Markt aber kein einköpfiges Wesen und die Politik trägt kein Schwert in der Hand, mit dem sie versucht den Markt zu enthaupten. Der Markt ist als ein Tummelplatz von freien Akteuren zu verstehen, die in erster Linie den Anreiz haben, ihre eigenen egoistischen Bedürfnisse zu befrieden. Eine weitgreifende Handlungsfreiheit2 ist eine Grundvoraussetzung für das Funktionieren der Marktwirtschaft und die Politik gibt mit einer Rahmenordnung vor, wie weit unter anderem diese Handlungsfreiheit reichen kann. Die den Markt umgebenden gesetzlichen und ökonomischen Bedingungen3, sollen hier der kritischen Bearbeitung nicht zur Disposition stehen. Vielmehr müssen sie als gegeben angesehen werden. Nicht die Freiheiten an sich sollen diskutiert werden, sondern was die Akteure des Marktes mit diesen Freiheiten angestellt haben. Um eine moralische Beurteilung der Handlungen der Marktteilnehmer durchführen zu können, welche zur zurück- und gleichzeitig noch vor uns liegenden Krise4 führten, soll hier das Moralverständnis nach Platon und Aristoteles heran gezogen werden. Demnach ist jedes Handel von moralischer Relevanz und "die moralische Qualität einer Handlung [hängt] von der in ihr enthaltenen Erkenntnis ab"5. Unter Berücksichtigung gegebener Umstände – also institutioneller Art – kann gezeigt werden, was die falsche6 Wertegrundlage der Bedürfnisbefriedigung zu dieser Krise beitragen konnten. Es geht nicht um die Schuld einzelner Personen oder Gruppen, die aus falschen Handlungen aus der Vergangenheit her rühren könnte, was zu Beurteilen sich in einem durch Freiheiten geprägten Raum ohnehin nicht rechtfertigen ließe, zumindest da, wo geltende Gesetze nicht übergangen wurden.
Inhaltsverzeichnis
- Zwei Schritte vor und einen zurück. Und wieder zwei Schritte nach vorn.
- Am Finanzmarkt tummeln sich eine ganze Reihe verschiedener Gruppen von Akteuren, die ich kurz vorstellen möchte.
- Jedes menschliche Handeln, jede Unternehmung die der Mensch angeht, strebt nach einem höheren Ziel, wie Boethius zu beginn seines Dritten Buches von der Trost der Philosophie bemerkt:
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Essay befasst sich mit der Frage, warum nicht nur Manager die Schuld an der Finanzkrise tragen, sondern auch die Akteure des Marktes selbst. Er analysiert die moralische Qualität der Handlungen von Marktteilnehmern im Kontext der Finanzkrise und bezieht sich dabei auf das Moralverständnis von Platon und Aristoteles. Der Essay untersucht die Rolle von falschen Werten und der Bedürfnisbefriedigung in der Entstehung der Krise und betont die Notwendigkeit, Verantwortung für die Zukunft zu übernehmen.
- Moralische Beurteilung von Handlungen im Marktkontext
- Falsche Werte und Bedürfnisbefriedigung
- Verantwortung für die Zukunft
- Das Streben nach Glückseligkeit bei Boethius und Aristoteles
- Wahres und falsches Glück
Zusammenfassung der Kapitel
Der Essay beginnt mit einer Analyse der Finanzkrise und der Rolle der verschiedenen Akteure am Finanzmarkt. Er stellt die Manager von Finanzunternehmen, Broker, Investoren und Kreditnehmer vor und konzentriert sich dabei auf die Hypothekennehmer als Akteure mit nahezu uneingeschränkter Handlungsfreiheit. Der Essay argumentiert, dass die Vergabe von Eigenheimhypotheken eine Schlüsselrolle bei der Entstehung der Kreditblase spielte und dass die Hypothekennehmer die einzigen Akteure waren, die weder Sachzwängen unterlagen noch ihr Unternehmen im Wettbewerb verteidigen mussten.
Im dritten Kapitel des Essays wird das Streben nach Glückseligkeit bei Boethius und Aristoteles untersucht. Boethius argumentiert, dass alle menschlichen Aktivitäten Mittel zum Ziel der Glückseligkeit sind und dass der Mensch durch seine eigenen Fehler und Irrtümer vom wahren Glück abgelenkt werden kann. Der Essay stellt die Unterscheidung zwischen wahrem und falschem Glück dar und zeigt, wie das Streben nach falschem Glück, das sich in der Form von Geld, Ehren, Macht, Ruhm und Lust manifestiert, zu einer euphorischen Lähmung des Inneren führen kann.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Finanzkrise, die moralische Qualität von Handlungen, falsche Werte, Bedürfnisbefriedigung, Glückseligkeit, Boethius, Aristoteles, Verantwortung für die Zukunft, Hypothekennehmer, Immobilienmarkt und das Streben nach dem höchsten Gut.
Häufig gestellte Fragen
Warum tragen laut dem Essay nicht nur Manager die Schuld an der Finanzkrise?
Der Essay argumentiert, dass auch die Akteure des Marktes selbst, insbesondere Hypothekennehmer, durch ihr Streben nach individueller Bedürfnisbefriedigung und falsche Werte zur Krise beigetragen haben.
Welche Philosophen werden zur moralischen Beurteilung herangezogen?
Die Arbeit bezieht sich auf das Moralverständnis von Platon und Aristoteles sowie auf die philosophischen Überlegungen von Boethius zur Glückseligkeit.
Welche Rolle spielten Hypothekennehmer in der Krise?
Sie werden als Akteure mit großer Handlungsfreiheit beschrieben, deren Streben nach Wohneigentum zur Entstehung der Kreditblase beigetragen hat.
Was ist der Unterschied zwischen wahrem und falschem Glück nach Boethius?
Wahres Glück liegt im „höchsten Gut“, während falsches Glück oft in materiellen Werten wie Geld, Macht, Ruhm oder bloßer Lust gesucht wird.
Wie definiert der Text die moralische Qualität einer Handlung?
Unter Bezugnahme auf die Antike wird erklärt, dass die moralische Qualität einer Handlung von der in ihr enthaltenen Erkenntnis und der Wertegrundlage abhängt.
- Citation du texte
- Tobias Döring (Auteur), 2010, Warum nicht nur die Manager die Schuld tragen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/181037