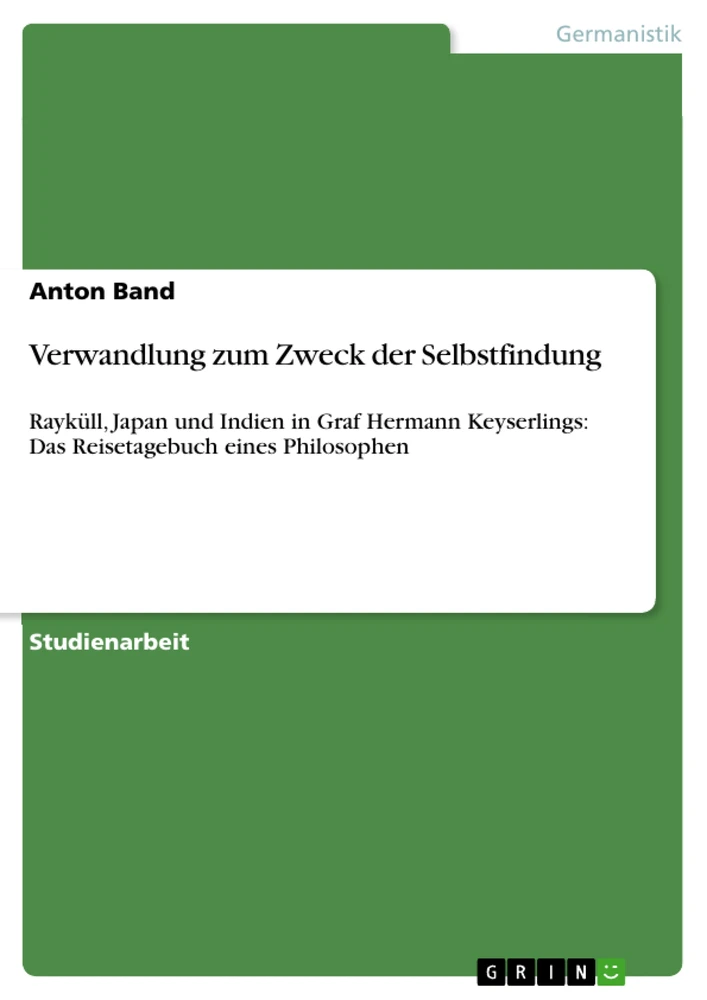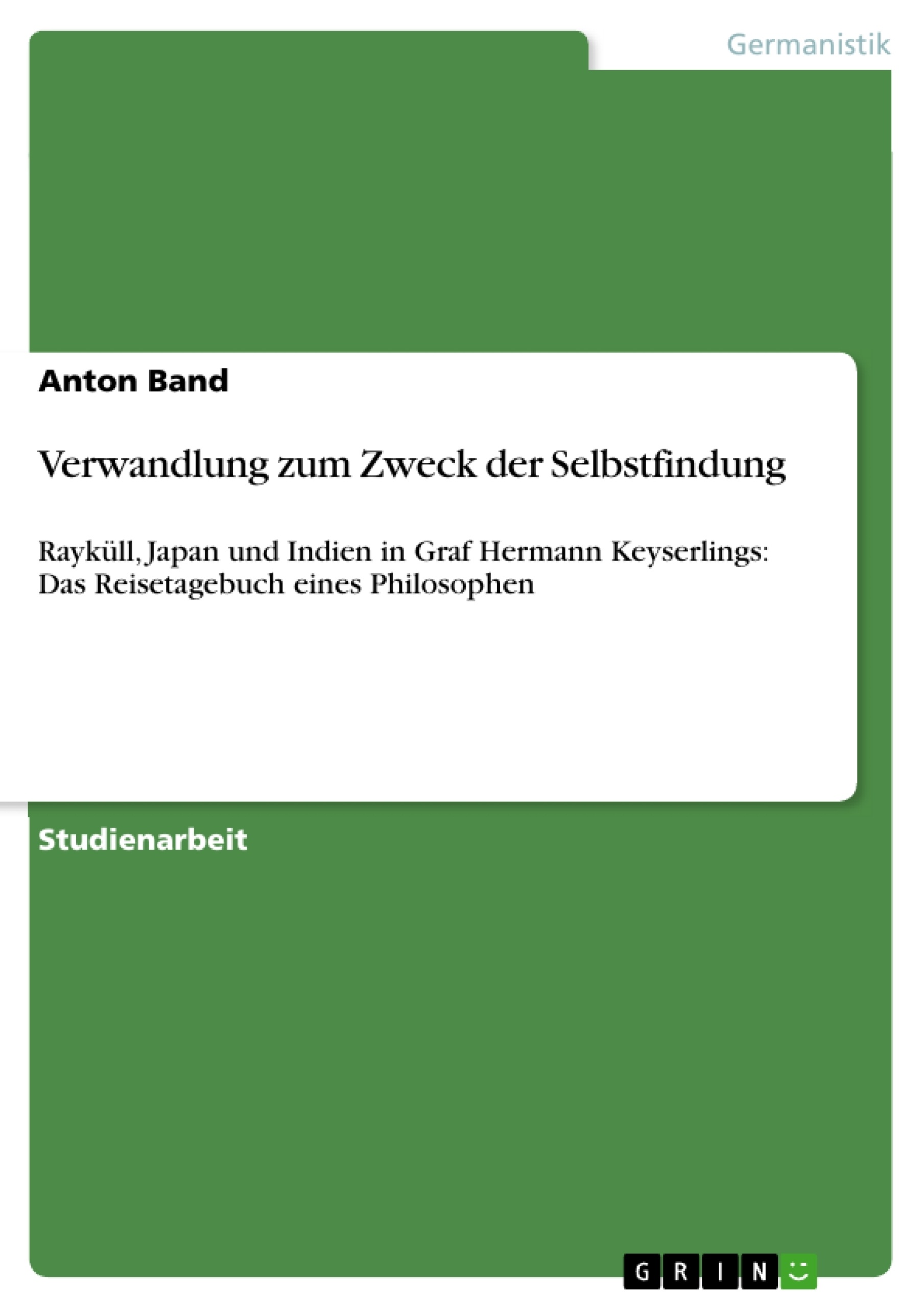Graf Hermann Keyserling bereiste die Welt vom Oktober 1911 an bis zu seiner Rückkehr im Oktober 1912. Sieben Jahre später erschien sein „Reisetagebuch eines Philosophen“ . Stationen seiner Weltreise waren Ceylon, Indien, China, Japan und Amerika. Laut Ute Gahlings war dies die gängige Reisestrecke um die Welt, absolvierbar in 60 Tagen. Keyserling, durch das Erbe seines Vaters Graf Leo Keyserling zu diesem Zeitpunkt noch finanziell unabhängig, lässt sich mehr Zeit, verweilt nach Geschmack an einigen Stationen länger. Diese Hausarbeit richtet ihr Hauptaugenmerk neben dem Start- und Zielort Rayküll vor allem auf das Japan-, noch stärker auf das Indienkapitel. Der ferne und nahe Osten waren zu Beginn des 20. Jahrhunderts beliebte Reiseziele unter deutschen Schriftstellern. Peter Brenner weist darauf hin, dass vor allem Indien zum erklärten Wunschziel des expressionistischen und neuromantischen Exotismus geworden sei. Dementsprechend erschien eine Vielzahl von Reiseberichten zur damaligen Zeit, als Beispiele seien nur Hermann Hesses Aus Indien (1913) und Waldemar Bonsels` (1916) Indienfahrt genannt. Diese Werke erreichten eine breite Masse, von Bonsels‘ Indienfahrt wurde bis 1922 trotz Inflation bereits 278 000 Exemplare verkauft. Brenner sieht in dieser Sehnsucht nach einem aus europäischer Sicht von spiritueller, okkulter und ursprünglicher Natur geprägtem Land das Bedürfnis des Europäers nach neuer Ganzheit, Religiosität. Europa war durch die fortschreitende Industrialisierung und Technisierung immer mehr von der Natur abgeriegelt. Brenner stellt fest, dass für viele der vor dem ersten Weltkrieg veröffentlichen Werke gilt, dass die Reisebeschreibung vielmehr Ausdruck einer exotischen Sehnsucht als Reflexion von Erfahrenem ist. Keyserling versucht mittels einer neuartigen Methode, die diese Arbeit näher untersucht, dem entgegenzuarbeiten. Die Untersuchung, ob ihm das immer gelingt, wird ebenfalls Bestandteil dieser Arbeit sein.
Inhaltsverzeichnis
- Einordnung in den geschichtlichen Zusammenhang
- Gattungs- und Formfrage
- Motivation der Reise
- Reisemethode
- JAPAN
- Einblick in das Japanverständnis der Zeit
- Kulturbegegnung
- Dualistische Beurteilung
- Ratio vs. Intuition
- INDIEN
- Erster Kontakt zur fremden Kultur
- Reinkarnationssystematik
- Aneignung des Polytheismus
- Der Inder als Träumer
- Reflektion über das eigene Indienverständnis
- RAYKÜLL
- Proteustum
- Reflektion
- Biografische Schlussbemerkung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Graf Hermann Keyserlings „Das Reisetagebuch eines Philosophen“ schildert seine Weltreise von 1911 bis 1912. Das Werk befasst sich mit der Suche nach Selbstverwirklichung und neuen Wirklichkeitsdimensionen, die Keyserling durch den Kontakt mit fremden Kulturen erlangen möchte.
- Die Bedeutung von Reiseerfahrungen für die persönliche Entwicklung
- Der Kulturvergleich und die Begegnung mit fremdem Denken
- Die Suche nach Ganzheit und spiritueller Erkenntnis
- Die Auseinandersetzung mit der eigenen Identität im Kontext anderer Kulturen
- Die Grenzen des eigenen Ansatzes und die Bedeutung von kultureller Individualität
Zusammenfassung der Kapitel
- Einordnung in den geschichtlichen Zusammenhang: Dieser Abschnitt beschreibt den historischen Kontext der Reise und beleuchtet die damaligen Reisetrends und die Faszination des Orients in der deutschen Literatur.
- Gattungs- und Formfrage: Hier wird die Form des Reisetagebuchs als literarische Gattung analysiert und mit den gängigen Konventionen verglichen. Die Besonderheiten des Werkes werden im Hinblick auf die Mischung aus Impressionen, Reflexionen und sachlichen Informationen diskutiert.
- Motivation der Reise: Keyserlings Beweggründe für seine Weltreise werden erörtert. Seine Sehnsucht nach Selbstverwirklichung und die Unzufriedenheit mit dem damaligen Europa stehen im Vordergrund.
- Reisemethode: Keyserling beschreibt seine Methode, fremde Kulturen nicht nur zu beobachten, sondern sie auch zu adaptieren, um neue Perspektiven auf die eigene Welt zu gewinnen.
- JAPAN: Dieser Abschnitt thematisiert Keyserlings Erfahrungen in Japan. Der Einfluss der westlichen Kultur auf das Land wird diskutiert, sowie die Wahrnehmung des Reisenden als Fremder.
- INDIEN: Hier werden Keyserlings Begegnungen mit der indischen Kultur und seine Auseinandersetzung mit dem Hinduismus und dem Reinkarnationskonzept geschildert.
Schlüsselwörter
Die zentralen Begriffe, die in „Das Reisetagebuch eines Philosophen“ eine wichtige Rolle spielen, sind: Weltreise, Selbstverwirklichung, Kulturvergleich, Orient, Japan, Indien, Reinkarnation, Hinduismus, Fremdheit, Identität, Metaphysik, Individualität.
Häufig gestellte Fragen
Was war das Ziel von Keyserlings Weltreise?
Keyserling suchte durch den Kontakt mit fremden Kulturen nach Selbstfindung, neuen Wirklichkeitsdimensionen und einer Überwindung der technisierten europäischen Lebensweise.
Welche Länder bereiste Keyserling zwischen 1911 und 1912?
Stationen seiner Reise waren Ceylon, Indien, China, Japan und Amerika.
Was ist Keyserlings 'neuartige Methode' der Reisebeschreibung?
Er versuchte, fremde Kulturen nicht nur von außen zu beobachten, sondern sie innerlich zu adaptieren („Verwandlung“), um durch diese Perspektivwechsel zu tieferer Erkenntnis zu gelangen.
Wie nahm Keyserling Indien wahr?
Indien war für ihn ein spirituelles Wunschziel. Er setzte sich intensiv mit dem Hinduismus, dem Polytheismus und der Reinkarnationssystematik auseinander.
Warum war Reiseliteratur zu Beginn des 20. Jahrhunderts so populär?
Viele Europäer empfanden eine Sehnsucht nach Ganzheit und Religiosität, da sie sich durch die Industrialisierung von der Natur und spirituellen Wurzeln entfremdet fühlten.
- Quote paper
- Anton Band (Author), 2009, Verwandlung zum Zweck der Selbstfindung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/181103