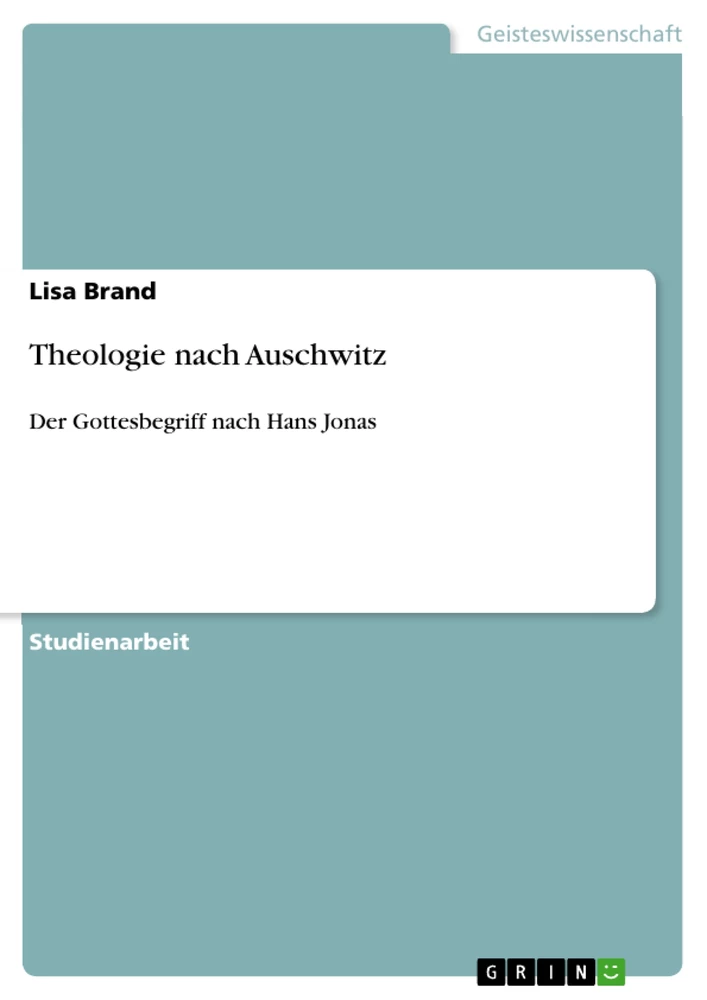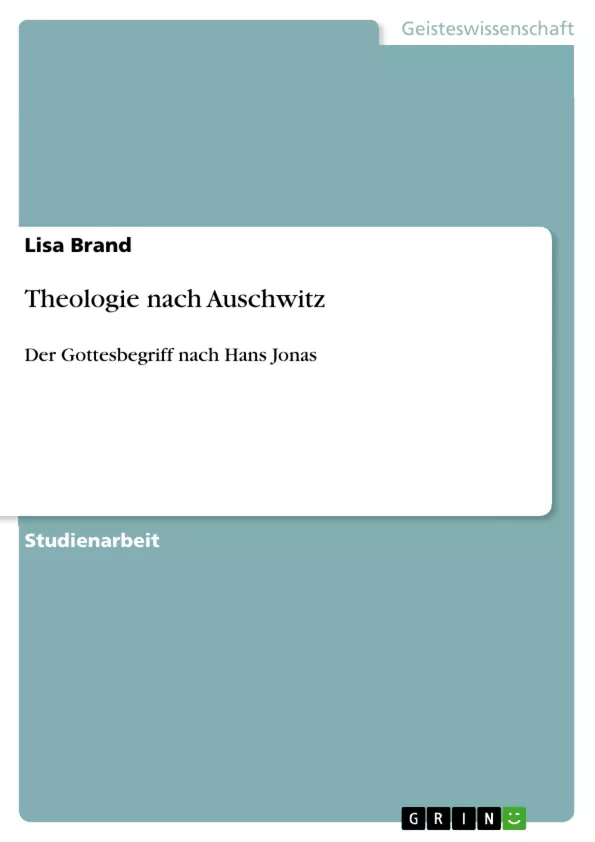Mit der Theodizeeproblematik beschäftigte er sich erst sehr spät, kurz vor seinem Tod. In der Einleitung einer Festrede anlässlich der Verleihung des Leopold-Lucas-Preises der Evangelisch-Theologischen Fakultät Tübingen 1984 erklärte er, warum er sich dazu entschlossen hatte, seinen Vortrag unter das Thema „Der Gottesbegriff nach Auschwitz. Eine jüdische Stimme“ zu stellen: Dorothea Lucas, die Frau Leopold Lucas’, wurde „nach Auschwitz weiterverschickt […], wo sie das Schicksal auch meiner Mutter teilte, da drängte sich mir unwiderstehlich dies Thema auf“ (7) . Hans Jonas bekam sehr spät Kenntnis vom Tod seiner Mutter, erst nach dem Krieg kehrte er als Mitglied der briti-schen Armee für einen kurzen Aufenthalt nach Deutsch¬land zurück. Zu diesem Zeit-punkt erfuhr er, dass auch seine Mutter nach Auschwitz deportiert und dort ermordet worden war.
Inhaltsverzeichnis
- Hans Jonas' Beschäftigung mit der Theologie nach Auschwitz
- Hans Jonas' Gottesbegriff nach Auschwitz
- Jüdische Theodizee
- Das Leid der Juden
- Die Problematik der jüdischen Theodizee
- Der selbsterdachte Mythos
- Die Selbstentäußerung Gottes
- Gottesattribute
- Konsequenzen
- Absprache der Allmacht Gottes
- Machtposition des Menschen
- Jüdische Theodizee
- Kritische Anfragen an Hans Jonas
- Gottes Handeln im Alten Testament
- Christliche Annahme der göttlichen Allmacht
- Kritik an,,Gottes Ohnmacht“
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit Hans Jonas' Gottesbegriff nach Auschwitz und analysiert seine Auseinandersetzung mit der Theodizee. Sie untersucht, wie Jonas den Gottesbegriff neu denkt, um das Leid der Juden im Holocaust zu erklären. Die Arbeit beleuchtet Jonas' Kritik an traditionellen jüdischen Theodizee-Ansätzen und stellt seinen "selbsterdachten Mythos" vor, der auf der Selbstentäußerung Gottes basiert.
- Hans Jonas' Gottesbegriff nach Auschwitz
- Die Problematik der jüdischen Theodizee
- Der "selbsterdachte Mythos" von Hans Jonas
- Die Selbstentäußerung Gottes
- Die Machtposition des Menschen
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel beleuchtet Hans Jonas' Beschäftigung mit der Theologie nach Auschwitz und stellt seinen biographischen Hintergrund dar. Es wird deutlich, dass Jonas' Auseinandersetzung mit der Theodizee durch den Holocaust geprägt ist und er sich mit der Frage auseinandersetzt, warum gerade Juden so viel Leid ertragen mussten.
Das zweite Kapitel analysiert Jonas' Gottesbegriff nach Auschwitz. Es wird deutlich, dass Jonas den traditionellen Gottesbegriff in Frage stellt und einen neuen Gottesbegriff entwickelt, der auf der Selbstentäußerung Gottes basiert. Jonas argumentiert, dass Gott sich aus der Welt zurückgezogen hat, um dem Menschen Freiheit zu ermöglichen. Diese Freiheit führt jedoch auch zu Leid, da der Mensch nicht immer nach Gottes Willen handelt.
Das dritte Kapitel befasst sich mit kritischen Anfragen an Hans Jonas' Gottesbegriff. Es werden verschiedene Argumente gegen Jonas' Theorie vorgebracht, insbesondere die Frage, wie Gottes Handeln im Alten Testament mit seiner Selbstentäußerung vereinbar ist. Außerdem wird die christliche Annahme der göttlichen Allmacht in den Blick genommen und die Kritik an Jonas' Konzept der "Gottes Ohnmacht" diskutiert.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen Hans Jonas, Gottesbegriff, Theodizee, Auschwitz, Holocaust, Jüdische Theologie, Selbstentäußerung Gottes, Freiheit, Leid, Machtposition des Menschen, Kritik an Gottes Ohnmacht.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet "Theologie nach Auschwitz"?
Es bezeichnet die theologische Auseinandersetzung mit der Frage, wie man nach dem Holocaust noch an Gott glauben kann und wie sich der Gottesbegriff ändern muss.
Wer war Hans Jonas?
Hans Jonas war ein jüdischer Philosoph, der sich intensiv mit Ethik und dem Gottesbegriff nach den Schrecken des Zweiten Weltkriegs und der Ermordung seiner Mutter in Auschwitz befasste.
Was ist der "selbsterdachte Mythos" von Hans Jonas?
Jonas entwickelte einen Mythos der "Selbstentäußerung" Gottes, wonach Gott seine Allmacht aufgegeben hat, um der Welt und dem Menschen Raum für Freiheit zu geben.
Warum lehnt Jonas die göttliche Allmacht ab?
Er argumentiert, dass Gott nicht gleichzeitig gütig, verstehbar und allmächtig sein kann, wenn Auschwitz möglich war. Er entscheidet sich dafür, die Allmacht zu verneinen.
Welche Rolle spielt die Freiheit des Menschen in Jonas' Theorie?
Da Gott "ohnmächtig" geworden ist, liegt die gesamte Verantwortung für das Geschehen in der Welt beim Menschen und dessen freiem Handeln.
- Citation du texte
- Lisa Brand (Auteur), 2008, Theologie nach Auschwitz, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/181164