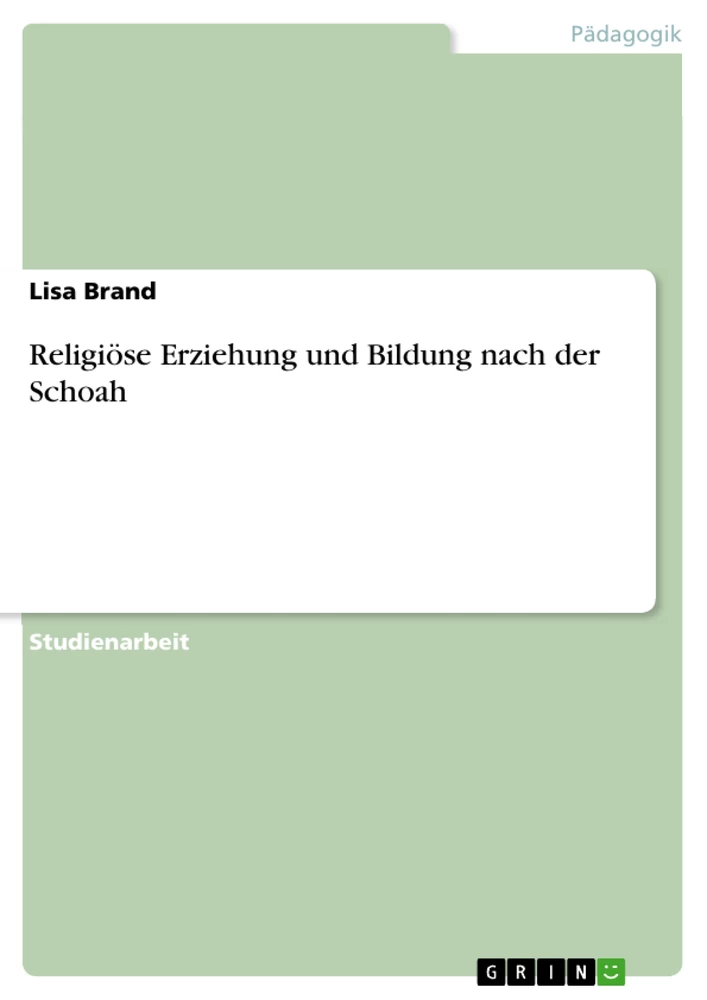„Auf den ersten Blick ein Tabubruch, auf den zweiten eine Provokation und auf den dritten eine kluge Antwort auf die Frage, wie man an das Ungeheuerliche erinnern kann.“ So beschreibt Henry M. Broder den Kurzfilm, den die Künstlerin Jane Korman zusammen mit ihrem Großvater erschaffen hat. Ihr Großvater Adam Adolek Kohn wurde 1921 in der Nähe von Oppeln geboren und mit 23 Jahren in das Konzentrationslager Auschwitz deportiert. Nach der Befreiung des Vernichtungslagers 1945 arbeitete er zunächst in München, bevor er mit seiner Frau Marysias nach Australien auswanderte. Nach mehr als 60 Jahren reist er mit seinen Enkelkindern zurück nach Europa, um mit ihnen seine Vergan¬gen¬¬heit zu verarbeiten. Doch die Familie besucht die Erinnerungsstätten nicht ausschließlich, um wie andere Besucher ihrer Ange¬hö¬rigen (Kohns Mutter wurde im Konzentrationslager ermordet) zu gedenken, sondern um das Überleben Adams und Marysias Kohn zu feiern. Zu Gloria Gaynors Hit „I will survive“ (‚Ich werde überleben‘) tanzen der Großvater und seine Enkelkinder vor den Vernichtungsstätten der Nationalsozialisten. Der Kurzfilm, den Jane Korman nach der Reise produziert, wurde im Sommer 2010 auf der Internetvideoplattform Youtube veröffentlicht. „Innerhalb weniger Tage wurde das Video eine halbe Million Mal angeklickt. In Australien, in den USA, in Deutschland, in Israel – überall dort, wo ‚Auschwitz‘ noch immer eine Metapher für das Ungeheuerliche ist.“
Inhaltsverzeichnis
- ,Dancing Auschwitz': Welcher Umgang mit Geschichte ist erlaubt?
- Vorbemerkungen
- Theologie nach Auschwitz: Hans Jonas' Gottesbegriff
- Erziehung und Bildung nach Auschwitz
- ,Dem Erinnern verpflichtet‘: Anamnetische Kultur
- Ansätze einer Erziehung nach Auschwitz
- Exkurs: Der Umgang mit der Schoah in israelischer Erziehung
- Religionspädagogik nach der Schoah
- Die Bedeutung der Schoah für die Religionspädagogik
- Theodizee und die Frage nach Gott bei Jugendlichen
- Religionsunterricht konkret
- Aufgaben des Lehrenden
- Kompetenzen
- Projekte außerhalb des regulären Religionsunterrichts
- Auschwitz ein Thema, das alle herausfordert
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Religionspädagogik nach der Schoah und untersucht, wie Jugendliche mit der Theodizeefrage umgehen, welche Bedeutung eine anamnetische Kultur für die Religionspädagogik hat und welche Kompetenzen sich daraus ergeben. Darüber hinaus werden Ansätze für Projektarbeit an Schulen zum Thema vorgestellt. Die Arbeit beleuchtet auch die Bedeutung der Erinnerungskultur und die Herausforderungen, die sich aus der Auseinandersetzung mit der Geschichte des Holocaust für die Erziehung und Bildung ergeben.
- Theodizeefrage und Gottesbegriff nach Auschwitz
- Anamnetische Kultur und Erinnerungskultur
- Kompetenzen und Aufgaben der Religionspädagogik nach der Schoah
- Projektarbeit an Schulen zum Thema Holocaust
- Erziehung und Bildung nach Auschwitz
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel beschäftigt sich mit dem Kurzfilm „Dancing Auschwitz“ von Jane Korman und stellt die Frage, welcher Umgang mit Geschichte erlaubt ist. Der Film zeigt den Großvater der Künstlerin, Adam Adolek Kohn, der als Überlebender des Konzentrationslagers Auschwitz mit seinen Enkelkindern an die Orte seiner Vergangenheit zurückkehrt und dort zu Gloria Gaynors Hit „I will survive“ tanzt. Die Reaktion auf den Film ist gespalten, wobei der Vorwurf der Geschmacklosigkeit im Vordergrund steht. Der Autor stellt die Frage, ob es legitim ist, die Vergangenheit auf diese Weise zu verarbeiten und zu feiern.
Die Vorbemerkungen beschäftigen sich zunächst mit der Theologie nach Auschwitz und dem Gottesbegriff von Hans Jonas. Jonas, selbst ein Überlebender der Schoah, argumentiert, dass der Gottesbegriff nach Auschwitz neu definiert werden muss, um die Frage nach dem Leid und dem Nichteingreifen Gottes zu beantworten. Er stellt den Gottesbegriff des Zimzum in den Vordergrund, in dem Gott sich aus der Welt zurückzieht und den Menschen als autonomes Wesen schafft. Die Theodizeefrage wandelt sich so zu Anthropodizee.
Im zweiten Teil der Vorbemerkungen wird die Frage nach Erziehung und Bildung nach der Schoah behandelt. Der Autor argumentiert, dass die Erinnerung an die Geschichte des Holocaust eine zentrale Aufgabe der Erziehung ist, um aus der Vergangenheit zu lernen und die Gegenwart für eine gelungene Zukunft zu verbessern. Die Bedeutung der Erinnerungskultur und die Herausforderungen, die sich aus der Auseinandersetzung mit der Geschichte des Holocaust für die Erziehung und Bildung ergeben, werden diskutiert.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Schoah, die Theodizeefrage, den Gottesbegriff nach Auschwitz, die Religionspädagogik, die Erinnerungskultur, die Erziehung und Bildung nach der Schoah, die anamnetische Kultur, die Kompetenzen der Religionspädagogik und die Projektarbeit an Schulen zum Thema Holocaust.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet Religionspädagogik „nach Auschwitz“?
Es ist eine Pädagogik, die die Schoah als zentralen Wendepunkt begreift und religiöse Inhalte sowie das Gottesbild angesichts des radikalen Bösen kritisch hinterfragt.
Was ist Hans Jonas' Gottesbegriff nach der Schoah?
Jonas entwickelte das Konzept eines Gottes, der seine Allmacht zugunsten der menschlichen Freiheit aufgegeben hat (Zimzum), um zu erklären, warum Gott im Vernichtungslager nicht eingriff.
Was ist eine anamnetische Kultur?
Eine Kultur des Eingedenkens, die die Opfer der Geschichte nicht vergisst und die Erinnerung als moralische Verpflichtung für die Gestaltung der Gegenwart sieht.
Warum ist das Video „Dancing Auschwitz“ so umstritten?
Es zeigt Überlebende und ihre Enkel, die an Vernichtungsstätten tanzen. Kritiker sehen darin einen Tabubruch, während Befürworter es als Feier des Überlebens und des Sieges über den Tod interpretieren.
Welche Rolle spielt die Theodizee-Frage bei Jugendlichen?
Jugendliche stellen oft die Frage, wie ein gütiger Gott solches Leid zulassen konnte. Die Religionspädagogik muss hier Räume für diese Zweifel und die Suche nach Antworten bieten.
- Arbeit zitieren
- Lisa Brand (Autor:in), 2010, Religiöse Erziehung und Bildung nach der Schoah, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/181172