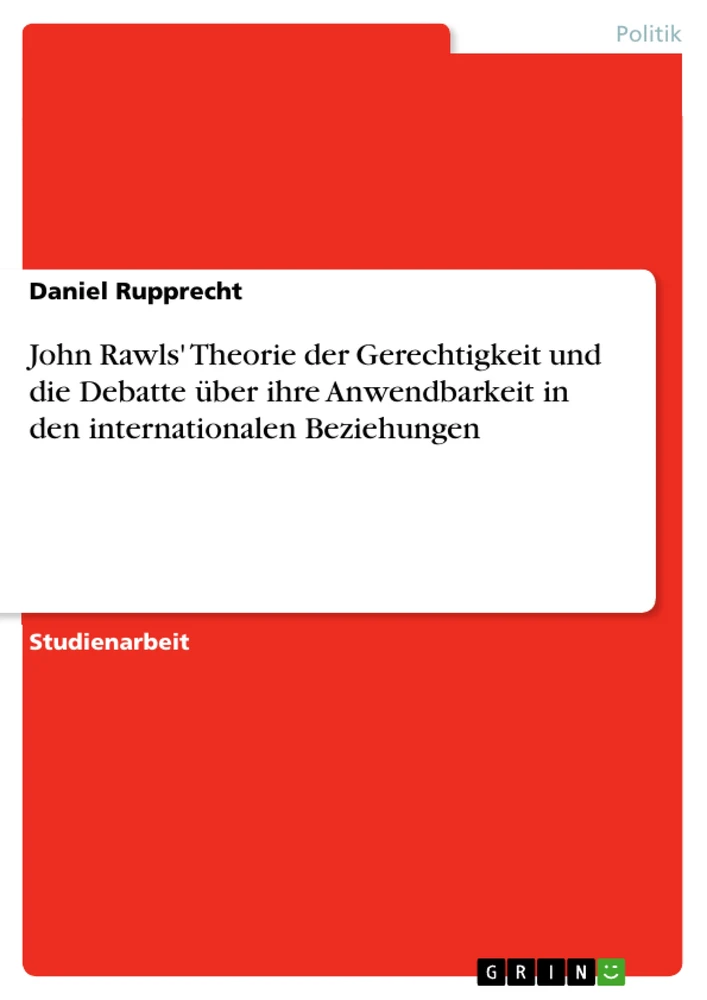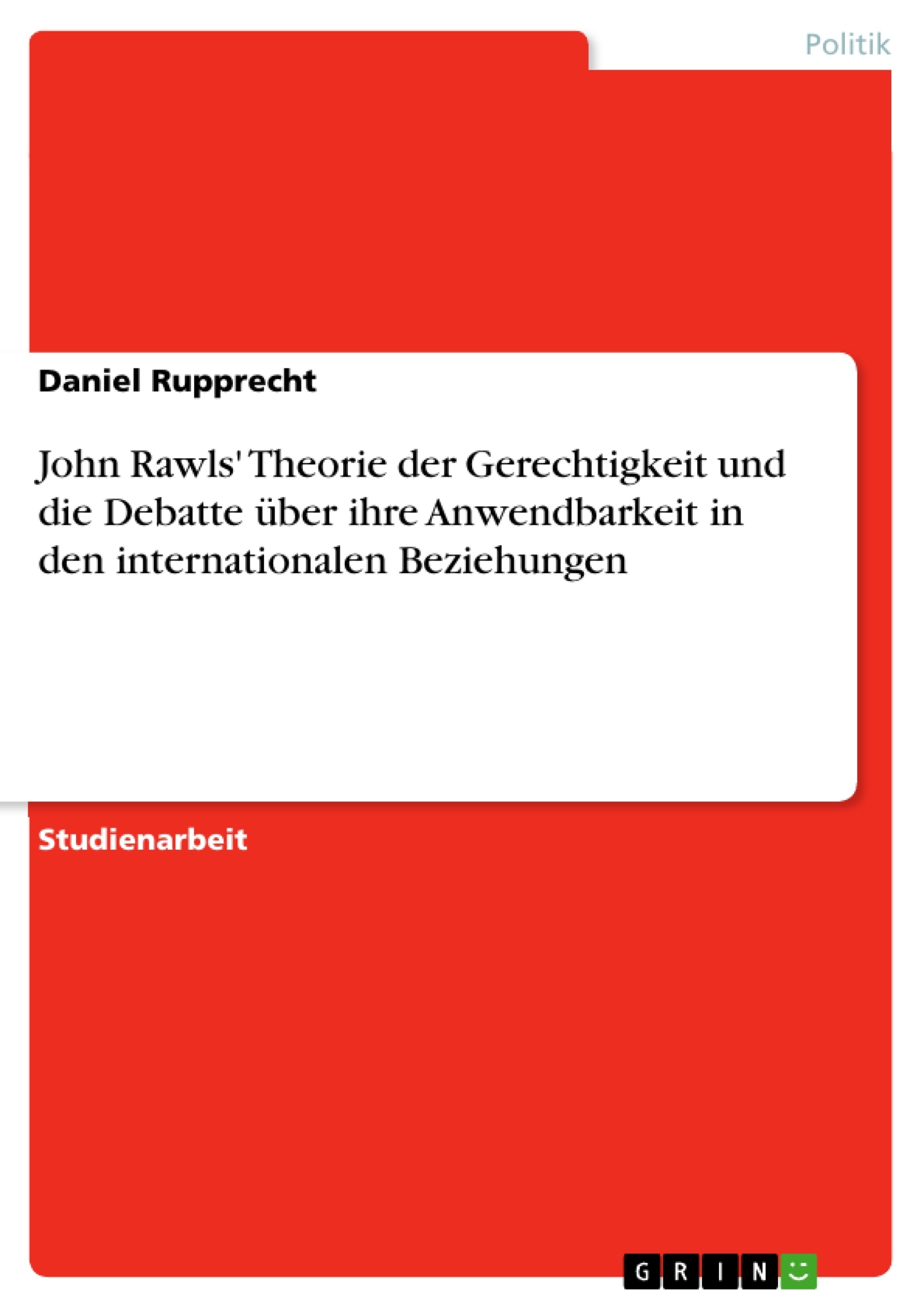Seit den Anfängen der politischen Philosophie wurde die inhaltliche Bestimmung pol. Werte u. Normen wie Freiheit, Gleichheit oder Gerechtigkeit im Kontext pol. Ethik kontrovers diskutiert. Doch seit Mitte des 19.Jahrh. war diese Tradition abgebrochen, da sich im Zeitverlauf zahlreiche Erkenntnis- und Weltverständnisse etablierten, welche die pol. Phil. als unwissenschaftlich disqualifizierten. Erst durch John Rawls´ Aufsatz „Justice as Fairness“ u. der detaillierten Ausarbeitung dieser Idee in „A Theory of Justice“, erlangte die bereits Tod gesagte Disziplin der pol. Phil. ihre Renaissance. Diese äußerte sich nicht zuletzt im Aufkommen einer neuen politikphil.Gerechtigkeitsdiskussion, indem sich eine Vielzahl von Autoren mit Rawls´ Theorie kritisch auseinandersetzten, u. das Thema der pol. Gerechtigkeit weiterentwickelten. Einige dieser Autoren, allen voran C.Beitz, T.Pogge, D.Skubik u. B.Barry, beschäftigten sich mit Frage nach der Anwendbarkeit der Rawlsschen Theorie der Gerechtigkeit auf die internationalen Beziehungen. Dabei entwickelten sie auf der Grundlage ihrer jeweiligen Kritik verschiedene Ansätze und Modelle, die im Kontext dieser Arbeit ansatzweise dargestellt werden sollen.Der erste Teil umfasst eine Darstellung der wichtigsten Grundzüge der Rawlsschen Theorie der Gerechtigkeit. Hierbei wird hinsichtlich der kontraktualistischen Argumentationweise dieser Theorie zunächst auf die „Anwendungsverhältnisse der Gerechtigkeit“, sowie auf die jeweilige Konzeption der „Vertragsparteien“, des „Urzustands“ und des „Schleier des Nichtwissens“ eingegangen. Anschließend werden die Ergebnisse der vorher beschrieben Entscheidungssituation dargelegt u. begründet. Darüber hinaus, wird im Zusammenhang der Deutungsproblematik des zweiten Gerechtigkeitsgrundsatzes das Differenzprinzip erläutert.Im Teil der Arbeit soll ansatzweise auf die Debatte über die Anwendbarkeit der Theorie der Gerechtigkeit auf den Bereich der internationalen Beziehungen eingegangen werden. Dazu erfolgt zunächst eine kurze Einleitung, in der unter anderem die beiden wesentlichen Grundkonzeptionen der pol. Phil. der internationalen Beziehungen dargestellt werden, innerhalb derer sich die nachfolgenden Ansätze und Konzeptionen theoretisch verorten lassen. Daran anknüpfend werden Rawls´ eigene Ausführungen zum Völkerrecht in der Theorie der Gerechtigkeit, sowie die als Kritik an seinen völkerrechtlichen Ausführungen entwickelten alternativen Ansätze u. Konzeptionen thematisiert.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- John Rawls' Theorie der Gerechtigkeit
- Einleitung
- Die Anwendungsverhältnisse der Gerechtigkeit und die Vernünftigkeit der Vertragspartner
- Der Urzustand und der Schleier des Nichtwissens
- Die Gerechtigkeitsgrundsätze
- Die Debatte über Anwendung der Theorie der Gerechtigkeit in den internationalen Beziehungen
- Einleitung
- Rawls und das Völkerrecht in der Theorie der Gerechtigkeit
- Nationalstaatliche Modelle
- Eine Präzisierung des Urzustands und der Gerechtigkeitsgrundsätze
- Das nationalstaatliche Modell und distributive Gerechtigkeit
- Das kosmopolitische Modell
- Schlussbetrachtung
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert John Rawls' Theorie der Gerechtigkeit und untersucht deren Anwendbarkeit in den internationalen Beziehungen. Dabei wird sowohl die kontraktualistische Argumentation der Theorie beleuchtet als auch die Debatte über ihre Anwendung auf die internationale Ebene betrachtet. Die Arbeit konzentriert sich auf die zentrale Frage, wie die Gerechtigkeitsgrundsätze von Rawls in einem Kontext globaler Politik und internationaler Beziehungen interpretiert und angewendet werden können.
- Rawls' Theorie der Gerechtigkeit als Grundlage für internationale Beziehungen
- Die Debatte über die Anwendbarkeit von Rawls' Theorie auf die globale Ebene
- Nationale und kosmopolitische Modelle der internationalen Gerechtigkeit
- Das Verhältnis von internationalem Recht und Gerechtigkeitstheorie
- Die Rolle von Verteilungsgerechtigkeit in der internationalen Politik
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel bietet eine Einführung in die zentrale These der Arbeit. Es stellt John Rawls' Theorie der Gerechtigkeit als Ausgangspunkt der Analyse vor und beleuchtet die Relevanz dieser Theorie für die heutige Zeit. Kapitel 2 stellt die wichtigsten Elemente der Rawlsschen Theorie der Gerechtigkeit vor, einschließlich des Urzustands, des Schleier des Nichtwissens und der Gerechtigkeitsgrundsätze. Dieses Kapitel bietet eine detaillierte Erläuterung der zentralen Argumentationslinie der Theorie und erklärt, wie diese Argumente zu einer spezifischen Konzeption von Gerechtigkeit führen. Das dritte Kapitel befasst sich mit der Debatte über die Anwendbarkeit der Rawlsschen Theorie der Gerechtigkeit auf die internationale Ebene. Es beleuchtet sowohl nationalstaatliche als auch kosmopolitische Modelle der internationalen Gerechtigkeit und untersucht die jeweiligen Vor- und Nachteile dieser Ansätze.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit zentralen Themen der politischen Philosophie, insbesondere mit John Rawls' Theorie der Gerechtigkeit, internationalen Beziehungen, Vertragstheorie, Gerechtigkeitsgrundsätzen, Völkerrecht, nationalstaatliche und kosmopolitische Modelle, distributive Gerechtigkeit, globale Politik und die Anwendung von Gerechtigkeitskonzepten auf die internationale Ebene.
- Citar trabajo
- Daniel Rupprecht (Autor), 2006, John Rawls' Theorie der Gerechtigkeit und die Debatte über ihre Anwendbarkeit in den internationalen Beziehungen, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/181251