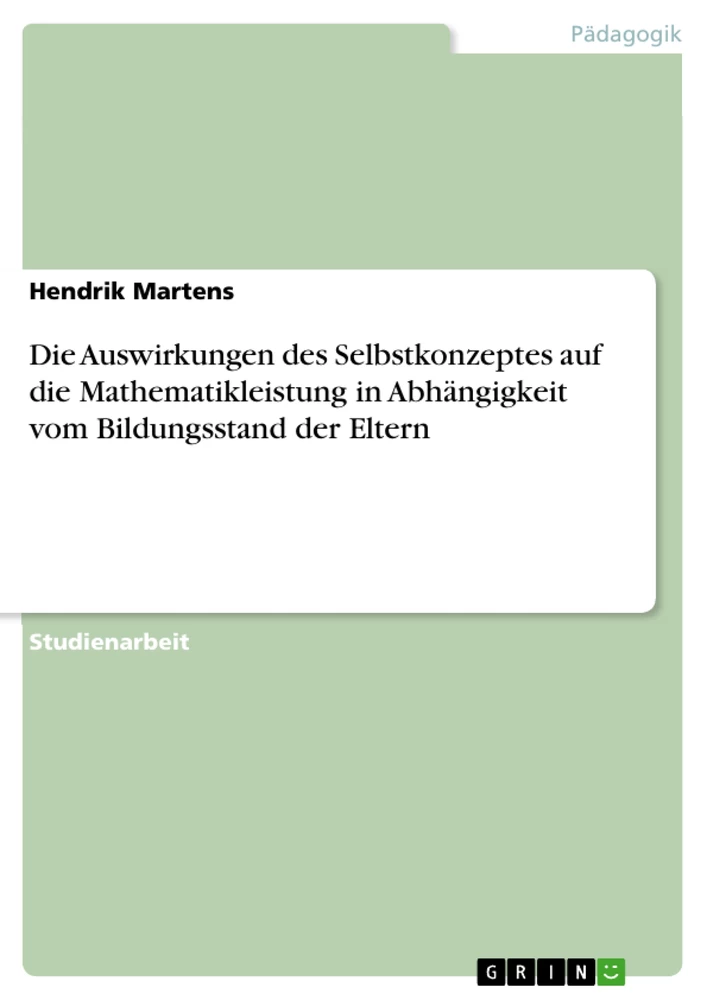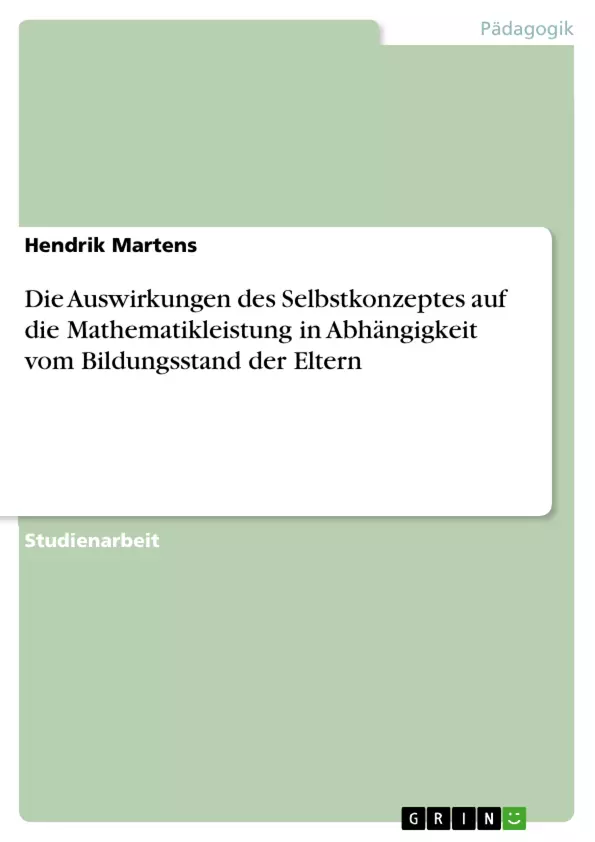Das schulische Selbstkonzept steht im Fokus dieser, im Rahmen des Mo- duls „Empirische Sozialforschung“ an der FernUniversität Hagen entstandenen Arbeit. Als Datengrundlage diente die internationale Schulleistungsuntersuchung PISA der OECD aus dem Jahr 2003, die ihren Schwerpunkt auf die Untersuchung mathematischer Kompetenzen setzte.
Die vorliegende Arbeit zielt darauf ab, einen Zusammenhang zwischen dem mathematischen Selbstkonzept und dem Bildungsstand der Eltern, sowie der Mathematikleistung herzustellen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Herleitung der Fragestellung
- Die Matheleistung
- Das schulische Selbstkonzept
- Der Bildungshintergrund der Eltern
- Bildung der Eltern, Selbstkonzept und Matheleistung
- Die abgeleiteten Hypothesen
- Operationalisierung der Variablen
- Die Matheleistung
- Das Selbstkonzept
- Der Schulabschluß der Eltern
- Hypothese 1: Je positiver das mathematische Selbstkonzept, desto besser die Mathematikleistung
- Hypothese 2: Je höher der Schulabschluß der Eltern, desto besser die Mathematikleistungen.
- Hypothese 3: Je höher der Schulabschluß der Eltern, desto positiver das mathematische Selbstkonzept des Schülers/der Schülerin.
- Modalitäten der Datenerhebung
- Darstellung der Ergebnisse
- Hypothese 1: Selbstkonzept und Mathematikleistung.
- Hypothese 2: Schulabschluss d. Eltern und Mathematikleistung
- Hypothese 3: Schulabschluss d. Eltern und Selbstkonzept
- Interpretation
- Zusammenfassung
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit untersucht den Zusammenhang zwischen dem mathematischen Selbstkonzept von Schülern und dem Bildungsniveau ihrer Eltern sowie der erzielten Mathematikleistung. Die Arbeit basiert auf Daten der PISA-Studie 2003 und analysiert die Zusammenhänge mithilfe statistischer Methoden.
- Mathematisches Selbstkonzept und seine Auswirkungen auf die Mathematikleistung
- Einfluss des Bildungsniveaus der Eltern auf die Mathematikleistung
- Zusammenhang zwischen dem Bildungsniveau der Eltern und dem mathematischen Selbstkonzept der Schüler
- Analyse der PISA-Daten 2003
- Anwendung statistischer Methoden zur Untersuchung der Zusammenhänge
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der Hausarbeit ein und stellt die Forschungsfrage sowie die Zielsetzung der Arbeit vor. Sie erläutert die Relevanz des Themas und die Bedeutung des mathematischen Selbstkonzepts sowie des Bildungshintergrunds der Eltern für die schulische Leistung.
Das Kapitel "Herleitung der Fragestellung" definiert die zentralen Konstrukte der Arbeit: Matheleistung, Selbstkonzept und Bildungshintergrund der Eltern. Es beleuchtet die theoretischen Grundlagen und die wissenschaftliche Literatur zu diesen Themen.
Im Kapitel "Operationalisierung der Variablen" werden die verwendeten Variablen definiert und operationalisiert. Es wird erläutert, wie die Daten der PISA-Studie 2003 zur Messung des mathematischen Selbstkonzepts, der Mathematikleistung und des Bildungsniveaus der Eltern verwendet werden.
Das Kapitel "Modalitäten der Datenerhebung" beschreibt die PISA-Studie 2003 als Datengrundlage der Arbeit. Es erläutert die Methodik der Studie, die Stichprobenziehung und die Datenerhebung.
Das Kapitel "Darstellung der Ergebnisse" präsentiert die Ergebnisse der statistischen Analysen. Es werden die Zusammenhänge zwischen dem mathematischen Selbstkonzept, der Mathematikleistung und dem Bildungsniveau der Eltern untersucht.
Das Kapitel "Interpretation" interpretiert die Ergebnisse der statistischen Analysen und diskutiert die Bedeutung der Ergebnisse im Kontext der wissenschaftlichen Literatur.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen das mathematische Selbstkonzept, die Mathematikleistung, den Bildungshintergrund der Eltern, die PISA-Studie 2003 und die statistische Analyse von Daten. Die Arbeit untersucht den Einfluss des Bildungsniveaus der Eltern auf die Mathematikleistung und das mathematische Selbstkonzept von Schülern.
- Arbeit zitieren
- Hendrik Martens (Autor:in), 2011, Die Auswirkungen des Selbstkonzeptes auf die Mathematikleistung in Abhängigkeit vom Bildungsstand der Eltern, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/181252