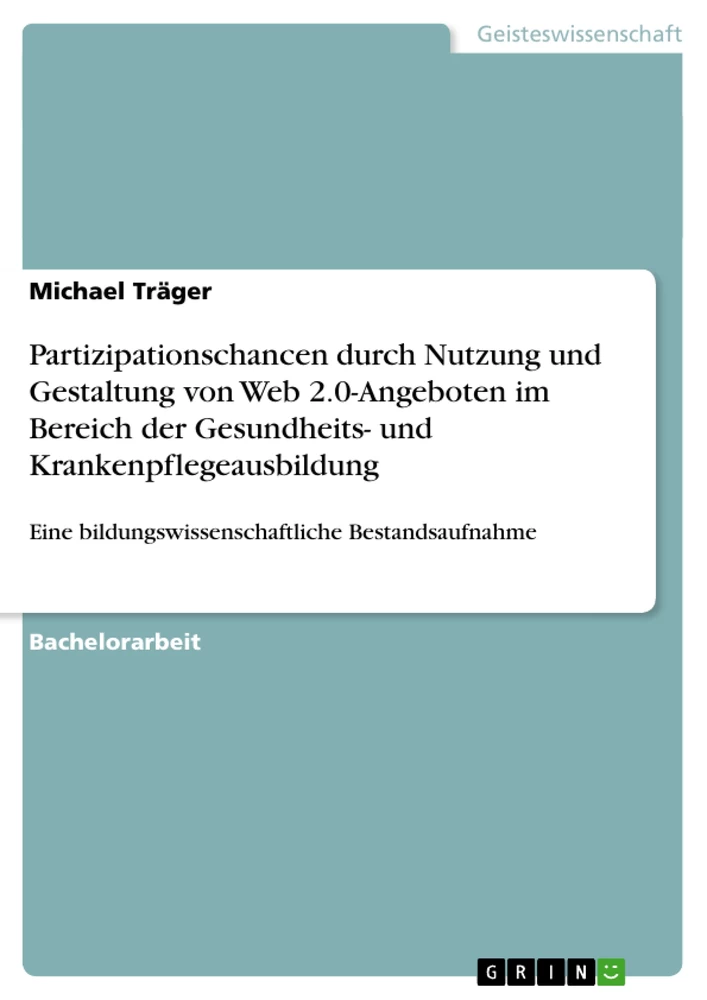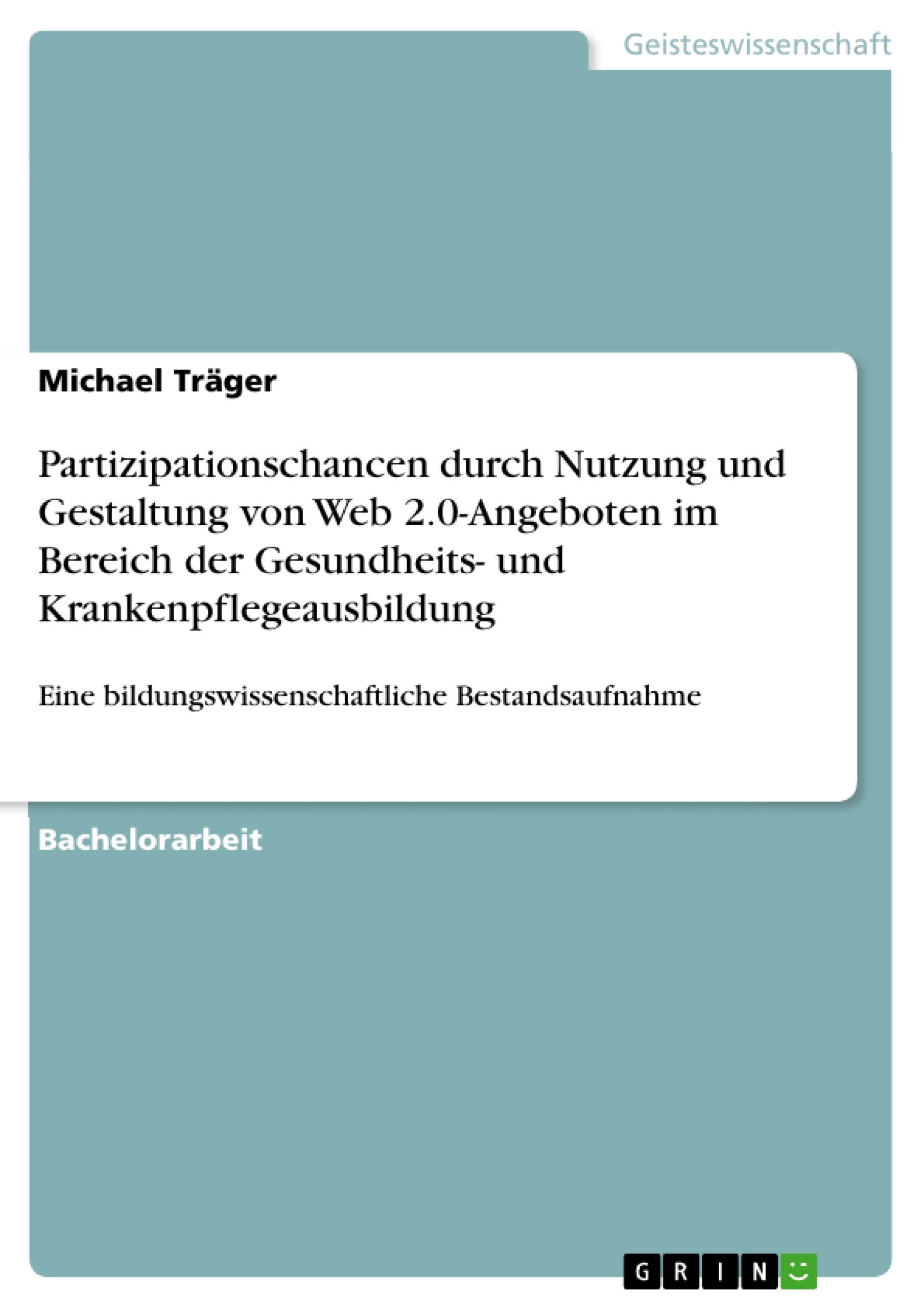Für Dieter Baacke liegt es auf der Hand: Heutige persönliche, berufliche und gesellschaftliche – demokratische Partizipationsmöglichkeiten werden durch die expandierenden Informations- und Kommunikationstechniken beeinflusst und mitgestaltet (vgl. 2007, S. 5). Anna-Maria Kamin stellt für die Weiterbildungskultur in der Pflege fest, dass hier traditionelle Veranstaltungen in Präsenzform dominieren (vgl. 2010, S. 679). Elisabeth Büsch, Annette Nauerth und Ina Pfefferle bescheinigen den Lehrenden und Lernenden an Schulen im Gesundheitswesen geringe Erfahrungen mit E-learning (vgl. 2007, S. 27). Die wenigen vorgestellten Aussagen lassen bereits eine Diskrepanz erahnen, die innerhalb der Gesundheits- und Krankenpflege(ausbildung) zu einer für diese Berufsgruppe nachteiligen Bilanz zwischen genutzten und ungenutzten bzw. verpassten Partizipationschancen führen kann.
Im Zentrum der vorliegenden Arbeit steht deshalb die Frage nach den Partizipationschan-cen durch Nutzung und Gestaltung von Web 2.0-Angeboten im Bereich der Gesundheits- und Krankenpflegeausbildung.
Um sich dem Thema Partizipation anzunähern, wird im zweiten Kapitel der Partizipationsbegriff bestimmt und seine medienpädagogisch historische und empirische Bedeutung im Allgemeinen und im Speziellen für die Gesundheits- und Krankenpflege herausgearbeitet. Anschließend werden Partizipationsvoraussetzungen im Kontext lerntheoretischer Positionen abgeleitet. Als Bindeglied zwischen lerntheoretischen Voraussetzungen, dem formellen und informellen Lernen einerseits und zunehmender berufspädagogischer Relevanz für die Gesundheits- und Krankenpflege andererseits steht der Kompetenzbegriff. Er wird im dritten Kapitel bestimmt, geordnet, auf die Pflegeausbildung bezogen und hinsichtlich seiner Messbarkeit eingeschätzt. Im vierten Kapitel wird der Kompetenzgedanke in einem berufsbezogenen mediendidaktischen Szenario aufgenommen und auf die Partizipationschancen durch Web 2.0-Applikationen in Kombination mit M-learning hin untersucht und auf Gefahren hin abgeschätzt. Im abschließenden fünften Kapitel erfolgt eine Einschätzung, inwieweit die zugrunde liegende zentrale Fragestellung beantwortet werden konnte.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- (Medien-)Pädagogische Perspektive auf das Konstrukt Partizipation
- Definition und Strukturierung des Partizipationsbegriffs
- Historische Zusammenhänge
- Empirische Befunde
- (Lern-)Theoretische Perspektiven zur Verwirklichung von Partizipation
- Vom radikalen Konstruktivismus zum neuen Konstruktivismus
- Der Denkansatz des neuen Konstruktivismus – Situated Cognition
- Lernen aus Sicht des neuen Konstruktivismus – Situiertes Lernen
- Die pragmatistische Perspektive
- Kompetenzen - Bausteine für Partizipation
- Bestimmung des Kompetenzbegriffs
- Kompetenztypen – Medienkompetenz – Kompetenzen in der Pflegeausbildung
- Kompetenzmessung
- Partizipation durch Kompetenzentwicklung – ein fiktives mediendidaktisches Szenario für die Pflegeausbildung
- Förderliche und hemmende Faktoren für die Partizipation
- Web 2.0-Charakteristika
- Mobile-learning (M-learning) - Definition und Charakteristika
- Web 2.0-Applikationen und M-learning: Nutzen, Kompetenzpotentiale - partizipative Effekte für die Pflegeausbildung
- Gefahren des Web 2.0 und von M-learning in Bezug auf Partizipation
- Fazit und Ausblick
- Literaturverzeichnis
- Abbildungsverzeichnis
- Anhang
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Bachelorarbeit befasst sich mit der Frage, welche Partizipationschancen sich durch die Nutzung und Gestaltung von Web 2.0-Angeboten im Bereich der Gesundheits- und Krankenpflegeausbildung ergeben. Die Arbeit analysiert die medienpädagogische Perspektive auf Partizipation, untersucht die Bedeutung von Kompetenzen für die Partizipation und entwickelt ein fiktives mediendidaktisches Szenario, das die Potenziale von Web 2.0-Applikationen und M-learning für die Partizipation in der Pflegeausbildung beleuchtet.
- Definition und Bedeutung des Partizipationsbegriffs im Kontext der Gesundheits- und Krankenpflegeausbildung
- Analyse der medienpädagogischen und lerntheoretischen Grundlagen von Partizipation
- Bedeutung von Kompetenzen für die Partizipation in der Pflegeausbildung
- Potenziale von Web 2.0-Applikationen und M-learning für die Partizipation in der Pflegeausbildung
- Gefahren und Herausforderungen der Nutzung von Web 2.0 und M-learning in der Pflegeausbildung
Zusammenfassung der Kapitel
Das zweite Kapitel der Arbeit widmet sich dem Partizipationsbegriff. Es werden verschiedene Definitionen und Strukturierungen des Begriffs vorgestellt und die medienpädagogische, historische und empirische Bedeutung von Partizipation im Allgemeinen und im Speziellen für die Gesundheits- und Krankenpflege herausgearbeitet. Anschließend werden lerntheoretische Positionen beleuchtet, die die Voraussetzungen für Partizipation im Kontext von Bildungsprozessen aufzeigen.
Das dritte Kapitel beschäftigt sich mit dem Kompetenzbegriff. Es wird eine Definition des Kompetenzbegriffs gegeben, verschiedene Kompetenztypen vorgestellt und der Bezug zur Pflegeausbildung hergestellt. Darüber hinaus wird die Messbarkeit von Kompetenzen diskutiert.
Im vierten Kapitel wird ein fiktives mediendidaktisches Szenario für die Pflegeausbildung entwickelt, das die Partizipationschancen durch Web 2.0-Applikationen in Kombination mit M-learning untersucht. Es werden sowohl die förderlichen als auch die hemmenden Faktoren für die Partizipation analysiert und die Potenziale sowie die Gefahren von Web 2.0 und M-learning in Bezug auf Partizipation in der Pflegeausbildung beleuchtet.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen Partizipation, Gesundheits- und Krankenpflegeausbildung, Web 2.0, M-learning, Medienkompetenz, Kompetenzentwicklung, Bildungswissenschaft, mediendidaktisches Szenario, E-Partizipation, E-Democracy, Situated Cognition, Konstruktivismus, pragmatische Perspektive.
- Citation du texte
- Michael Träger (Auteur), 2011, Partizipationschancen durch Nutzung und Gestaltung von Web 2.0-Angeboten im Bereich der Gesundheits- und Krankenpflegeausbildung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/181304