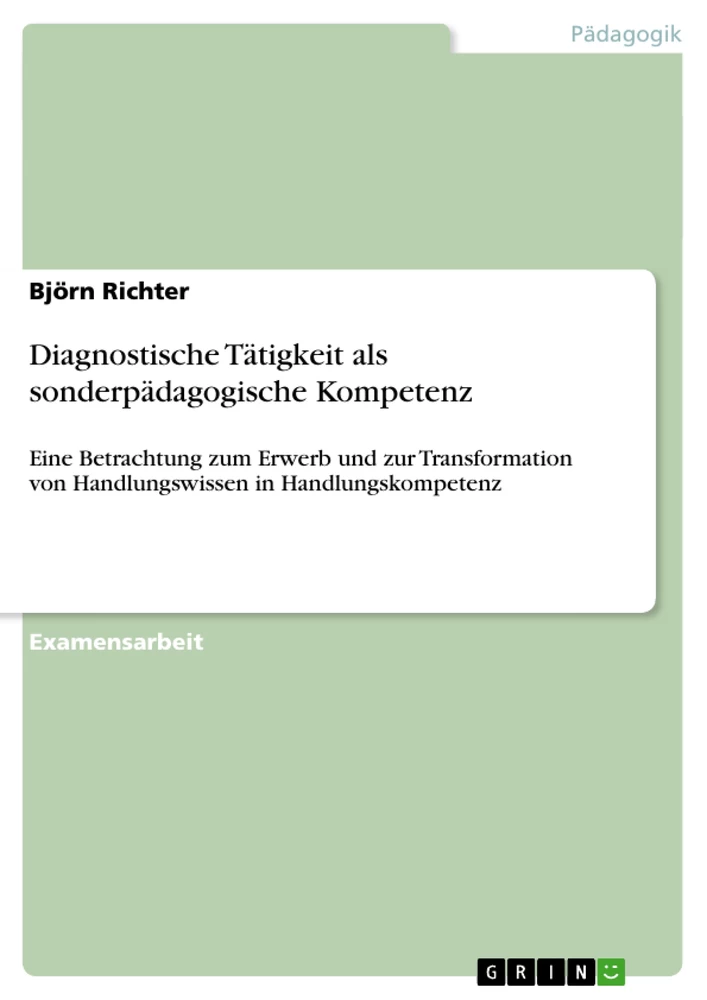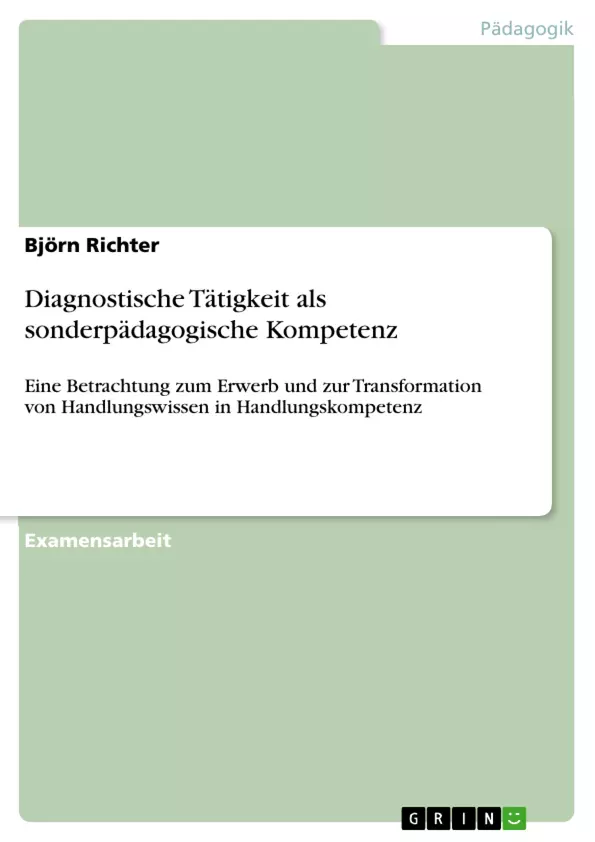Der Titel meiner Arbeit „Diagnostische Tätigkeit als sonderpädagogische Kompetenz - Eine Betrachtung zum Erwerb und zur Transformation von Handlungswissen in Handlungskompetenz
auf der Grundlage eines subjektorientierten Ansatzes“ deutet bereits auf eine weit verzweigte Anlage des Themas hin. Ich werde mich bei der Bearbeitung deshalb auf die Aspekte Kompetenzerwerb in der Lehrerbildung, theoretischer Aspekte diagnostischer Tätigkeit und
der aktuell praktizierten Diagnostik in ausgewählten Schulen konzentrieren. Einzeln betrachtet handelt es sich um Aspekte, die nicht sofort ihre Korrelation erkennen lassen. Synoptisch
betrachtet geben sie jedoch Antwort auf die zentrale Frage dieser Untersuchung, nämlich wie und ob das in der universitären Lehrerbildung erworbene Wissen in Handlungskompetenz transformiert werden kann.
Exemplifiziert wird das an einem Ansatz verstehensorientierter diagnostischer Tätigkeit. Dieses Vorgehen orientiert sich an dem zunehmenden Diskussionskonsens in der behindertenpädagogischen
Diagnostik, die sich mehr denn je verstehenden, qualitativen und an biografischen Hintergründen orientierten Aspekten ihrer Klienten orientiert. Trotzdem: Auch wenn die einst dominierenden normorientierten Ansätze gegenüber subjektorientierten Diagnosen in
jüngerer Zeit an Einfluss verloren haben und sich damit ein Wertewandel abzuzeichnen begann, bleibt die Frage, wie weit dieser Paradigmenwechsel bereits fortgeschritten ist.
Der in dieser Arbeit vorgestellte Ansatz rehistorisierender Diagnostik zeichnet sich speziell durch seine konsequente Subjektorientierung aus, versteht sich aber in Tradition mit anderen
Modellen gleicher Orientierung.
Von besonderer Aktualität wird die Kompetenzfrage im Kontext schulischen Alltags – erlebt doch die medial gesteuerte Diskussion um die Förderung und Entwicklung von beruflichen Kompetenzen in der Lehrerbildung zurzeit eine Hochkonjunktur. Die Projekte zur Erfassung
beruflicher Kompetenz von angehenden Lehrkräften sind dadurch nicht zuletzt durch umfangreiche Evaluationsauflagen der Schulen umfangreicher und mehrperspektivischer geworden.
Die rege öffentliche Diskussion um Professionalisierung im Lehrerberuf verweist dabei auf eine in der Wissenschaft noch längst nicht ausreichend beantwortete, aber höchst virulente
Frage, wie es nämlich grundsätzlich um das Verhältnis von universitärer Lehre und schulpraktischem Alltag bestellt ist.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung:
- 1.1. Problemaufriss:
- 1.2. Methodisches Vorgehen:
- 2. Kompetenzen in der Lehrerbildung
- 2.1. Zum Begriff der Kompetenz
- 2.1.1. Professionelle Kompetenz:
- 2.1.2. Professionalität im schulischen Alltag.
- 2.2. Zuschreibung von Kompetenz
- 2.3. Kodifizierung von Kompetenzen
- 2.4. Professionelle Standards
- 2.4.1. der Begriff Standard.
- 2.4.2. Über die Entstehung von Standards
- 2.4.3. Analyse von Standards.
- 2.4.4. Das Qualitätsproblem bei der Entwicklung von Standards.
- 2.5. Bedeutung für die Ausbildung behindertenpädagogischer Kompetenzen.
- 3. Theoretische Aspekte diagnostischer Tätigkeit.
- 3.1. Zum Diagnosebegriff.
- 3.1.1. Normorientierung oder Subjektorientierung.
- 3.1.2. diagnostische Tätigkeit im schulischen Alltag der Interviewpartnerinnen
- 3.2. Verstehende Diagnostik
- 3.3. Das Modell der rehistorisierenden Diagnostik.
- 3.3.1. Der Begriff der Rehistorisierung:
- 3.3.2. Die Zentrale Bedeutung rehistorisierender Diagnostik: Das Feld der Macht zu öffnen
- 3.4. Bedeutung der Rehistorisierung für die diagnostische Tätigkeit
- 3.5. Syndromanalyse nach A. R. Luria
- 3.5.1. Vygotskijs Konzept der Zone der nächsten Entwicklung unter materialistischen Gesichtspunkten....
- 3.5.2. Theorie der Semiosphären..
- 3.6. Romantische Wissenschaft:
- 3.7. Geistige Behinderung - ein sozialer Tatbestand.
- 3.7.1. Wirkungsmechanismen
- 3.7.2. Kern von Behinderung – Isolation
- 3.8. Relationalitätsbegriff – Wie wird Behinderung gedacht?
- 3.9. Materialistische Behindertenpädagogik.
- 4. Qualitative Expertenbefragung zum Thema: Was macht gute pädagogische Diagnostik aus und welche Bedeutung hat sie für den Alltag?
- 4.1 Forschungsfrage.
- 4.2. Untersuchungsmethode.
- 4.2.1. Experteninterviews.
- 4.2.2. Experteninterviews - eine Anwendungsform der Leitfadeninterviews..
- 4.3. Durchführung der Interviews.
- 4.4. Der Leitfaden.........
- 4.5. Auswertungsverfahren
- 4.6. Zusammenfassende Darstellung der Interviewdaten..
- 4.6.1. Förderdiagnostischer Alltag.
- 4.6.2. konzeptionelle Grundlagen
- 4.6.3. Kompetenzen…......
- 4.6.4. Methodik/Evaluation.
- 4.6.5. Relationales Behinderungsverständnis..
- 4.6.6. Vorinformation/Interdisziplinarität.
- 5. Interpretation und Diskussion
- 6. Rehistorisierende Diagnostik - Eine kritische Betrachtung.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Erwerb und die Transformation von Handlungswissen in Handlungskompetenz im Bereich der sonderpädagogischen Diagnostik. Der Fokus liegt auf der Frage, wie das in der universitären Ausbildung erworbene Wissen im schulischen Alltag angewendet und umgesetzt wird. Ein besonderes Augenmerk liegt dabei auf einem subjektorientierten Ansatz der Diagnostik.
- Kompetenzerwerb in der Lehrerbildung
- Theoretische Aspekte diagnostischer Tätigkeit (insbesondere subjektorientierte Ansätze)
- Praxis der diagnostischen Tätigkeit an ausgewählten Schulen
- Rehistorisierende Diagnostik als Modell
- Zusammenhang zwischen universitärer Ausbildung und schulischem Alltag
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 führt in die Thematik ein und beschreibt das methodische Vorgehen. Kapitel 2 beleuchtet den Begriff der Kompetenz in der Lehrerbildung, inklusive der Kodifizierung und professioneller Standards. Kapitel 3 behandelt theoretische Aspekte diagnostischer Tätigkeit, mit einem Schwerpunkt auf normorientierten versus subjektorientierten Ansätzen und der Vorstellung des Modells der rehistorisierenden Diagnostik. Kapitel 4 beschreibt eine qualitative Expertenbefragung zum Thema guter pädagogischer Diagnostik und deren Bedeutung im Alltag. Die Kapitel 5 und 6 bieten Interpretationen und eine kritische Betrachtung der rehistorisierenden Diagnostik.
Schlüsselwörter
Handlungskompetenz, sonderpädagogische Diagnostik, subjektorientierter Ansatz, rehistorisierende Diagnostik, Lehrerbildung, Professionelle Kompetenz, normorientierte Diagnostik, qualitative Forschung, Experteninterviews, geistige Behinderung.
- Quote paper
- Björn Richter (Author), 2007, Diagnostische Tätigkeit als sonderpädagogische Kompetenz, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/181353