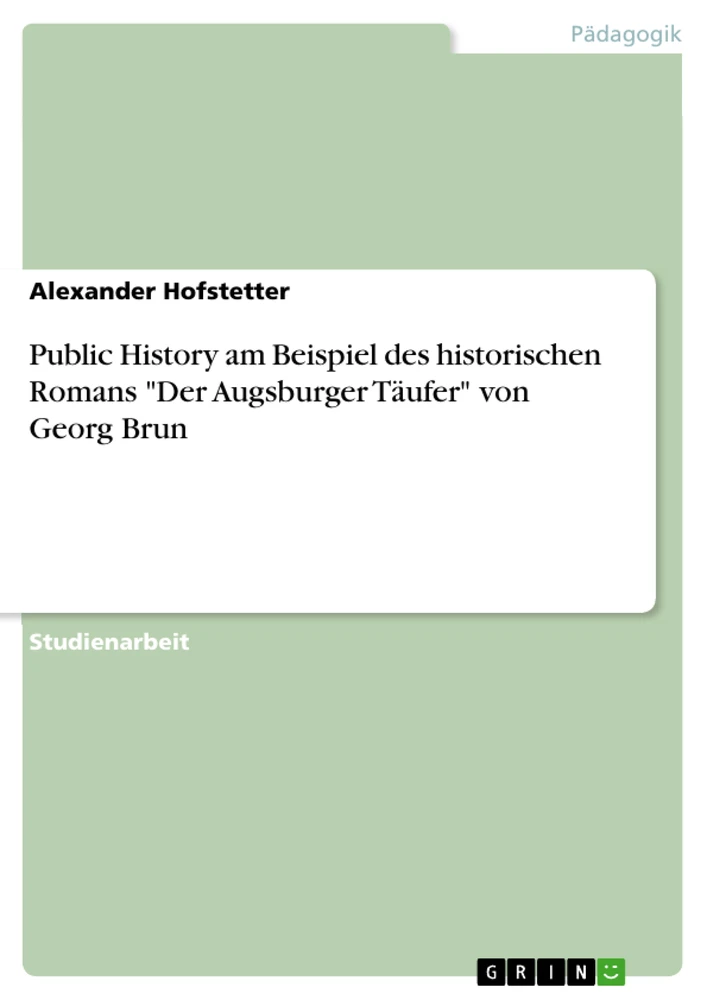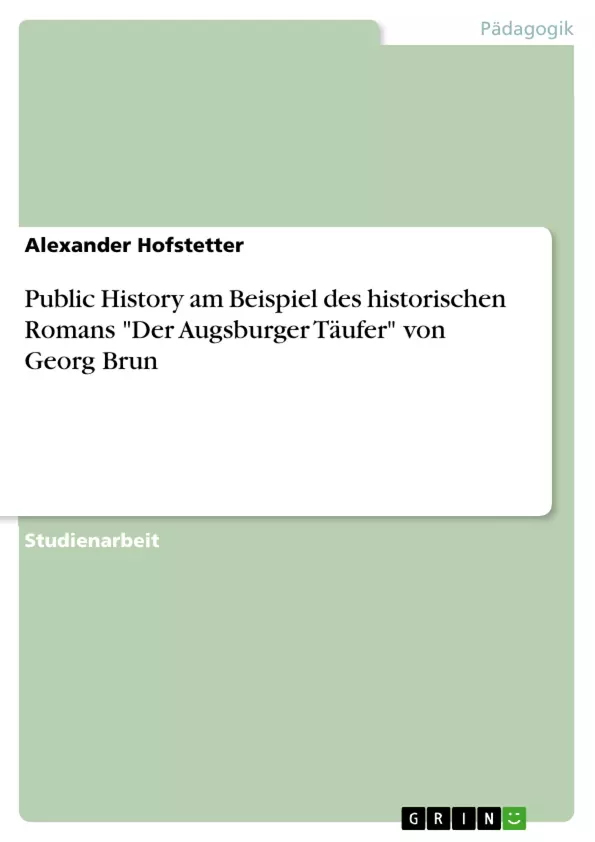Es ist ein Gebiet, welches Erfolg verspricht. Nicht umsonst werden heutzutage viele Filme mit geschichtlichem Hintergrund gedreht und Bücher mit einer historischen Basis geschrieben. Diese Auseinandersetzung mit der Vergangenheit regt die Fantasie des Lesers an, entführt den Zuschauer in eine farbenprächtige Welt der Historie und überschreitet somit die letzte Barriere zwischen Konsument und geschichtlichem Wissen. Auf angenehme Art und Weise ist es nun möglich, anstelle eine ferne Geschichte zu betrachten, direkt in die Materie einzutauchen und sich lehrreiches Wissen, verknüpft mit einer spannenden Erzählung von Helden und Abenteuern, bequem anzueignen. Nun, abgesehen davon, dass bei vielen Konsumenten sicherlich das Epos und das Abenteuer im Vordergrund des Interesses stehen, müssten die meisten Bücher und Filme dennoch sicherlich an Spannung einbüßen, würden sie in die heutige Zeit transferiert werden.
Trotzdem sind historische Filme oder Romane mit Vorsicht zu genießen. Zu schnell kann es passieren, dass sich ein historisches Faktum einfach nicht in die fiktive Handlung einfügen möchte und daher kurzerhand angeglichen wird. Auch ist der Konsument der Recherche des Autors oder Drehbuchautors völlig ausgeliefert und zunächst bleibt ihm keine Wahl, als das ihm Präsentierte für bare Münze zu nehmen und zu akzeptieren.
Die folgende Arbeit möchte sich an einem exemplarischen Beispiel eines historischen Romans mit der Fragestellung auseinandersetzen, wie dem herkömmlichen Leser Geschichte dargeboten werden kann. Ferner soll überprüft werden, ob die Wissensvermittlung, welche mit dem Lesen einhergeht, auf historisch korrekte Fakten gestützt werden kann und ob der Roman einem Realitätsbezug und –vergleich standzuhalten vermag.
Gegenstand der Untersuchung ist der Roman „Der Augsburger Täufer“ von Georg Brun. Dieses Buch wurde als Fortsetzungsroman zu „Der Engel der Kurie“ geschrieben und entstammt der Feder eines Mannes, der bereits für sein Werk „Das Vermächtnis der Juliane Hall“ mit dem Bayerischen Förderpreis für Literatur ausgezeichnet worden ist.
Inhaltsverzeichnis
- I) Problematik des Kartenverständnisses.
- II) Potentielle Beeinflussung durch Geschichtskarten..
- 1.) Inhaltsangabe
- 2.) Der Autor Georg Brun
- 3.) Konfrontation des Lesers mit historischen Bezügen
- 4.) Interpretation der Handlung..
- III) Schluss in Form persönlicher Stellungnahme
- IV) Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Roman „Der Augsburger Täufer“ von Georg Brun untersucht die Frage, wie dem herkömmlichen Leser Geschichte präsentiert werden kann. Die Arbeit befasst sich mit der Frage, ob die Wissensvermittlung durch den Roman auf historisch korrekte Fakten gestützt werden kann und ob der Roman einem Realitätsbezug und -vergleich standzuhalten vermag.
- Die Darstellung historischer Ereignisse und Personen in der fiktiven Welt des Romans
- Die Rolle des historischen Romans als Medium zur Vermittlung von Geschichtswissen
- Die Interaktion zwischen Fiktion und Realität im historischen Roman
- Die Frage nach der Authentizität und Glaubwürdigkeit historischer Romane
- Die Bedeutung des historischen Kontextes für die Interpretation der Handlung
Zusammenfassung der Kapitel
Der Roman erzählt die Geschichte des Dominikanermönchs Jakob, der im Auftrag der Kirche nach Augsburg reist, um die dortige Täuferbewegung zu infiltrieren. Die Handlung spielt im 16. Jahrhundert und zeichnet ein lebendiges Bild des damaligen Lebens in Augsburg.
Der Roman beginnt mit einer detaillierten Beschreibung der politischen und religiösen Situation in Augsburg und München. Jakob gelangt nach Augsburg und wird in den Mordfall eines Buchhalters verwickelt. Parallel dazu beobachtet er die Aktivitäten der Augsburger Täufer.
Die Handlung wird durch die Ankunft der italienischen Malerin Ludovica Zappi bereichert, die in das Anwesen der Fugger eingezogen ist. Ludovica wird ebenfalls in den Mordfall verwickelt und entdeckt Beweismaterial, das die Fugger in ein dunkles Licht rückt.
Jakob spioniert weiter die Täufer aus und gerät in ein Netz aus Intrigen und Verrat. Durch seine Ermittlungen und Beobachtungen kommt er der Wahrheit hinter dem Mordfall näher.
Die Geschichte nimmt eine dramatische Wendung, als Jakob in ein Münchner Kloster zurückkehrt, um die dortigen Täufer auszuspionieren.
Schlüsselwörter
Historischer Roman, Georg Brun, Augsburg, Täuferbewegung, Fugger, Ludovica Zappi, Jakob, Mordfall, Intrige, Verrat, Geschichte, Fiktion, Realität, Authentizität, Glaubwürdigkeit, historischer Kontext.
- Quote paper
- Alexander Hofstetter (Author), 2007, Public History am Beispiel des historischen Romans "Der Augsburger Täufer" von Georg Brun, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/181365