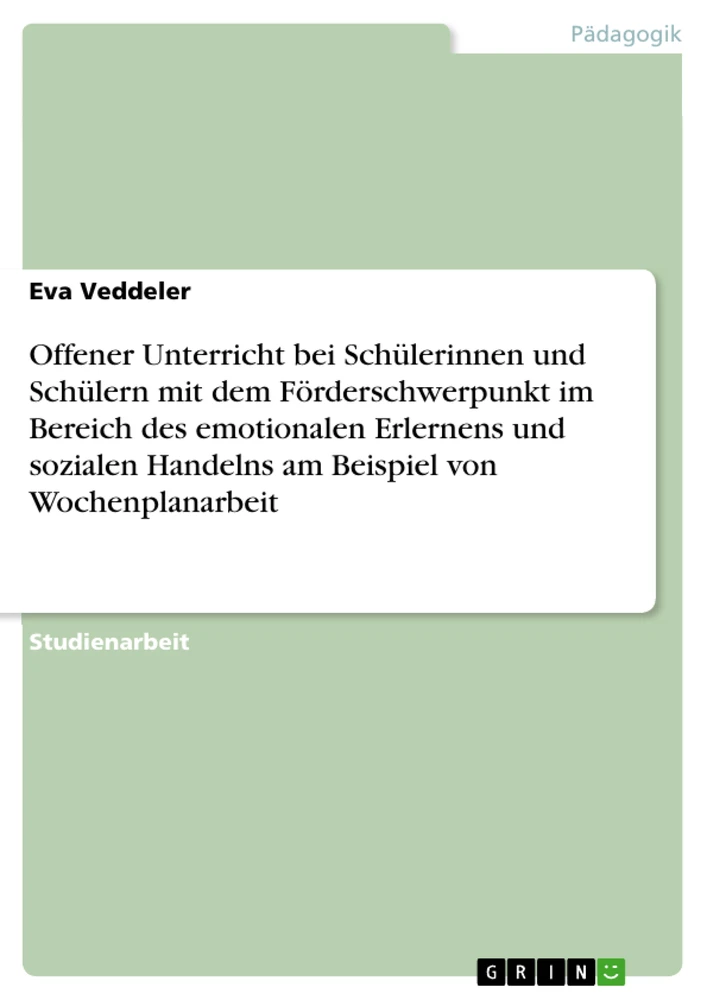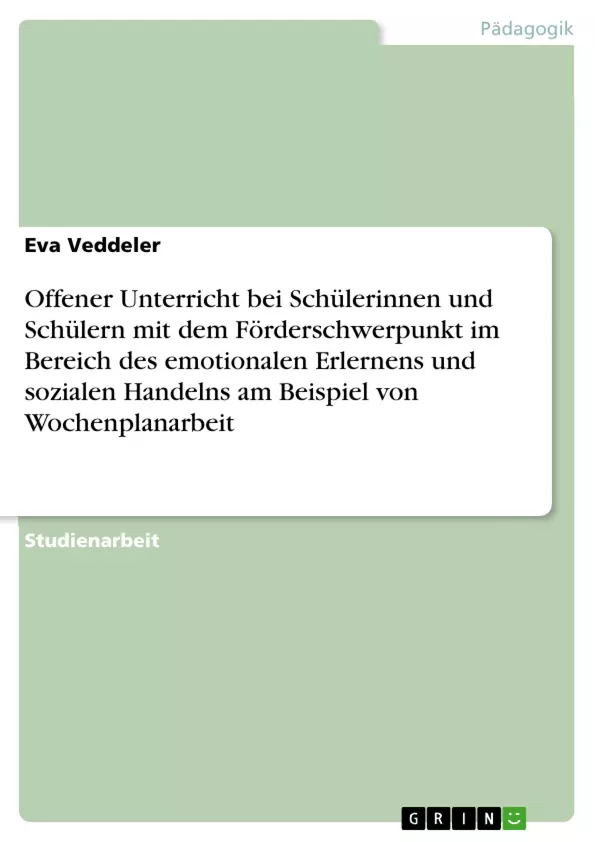In den letzten Jahren sind die Ziele des offenen Unterrichts eine wichtige Größe der Grundschulpädagogik
geworden. Zu den Zielen gehören u.a. Ganzheitlichkeit, Selbstständigkeit,
Lebensunmittelbarkeit und soziales Lernen. Sie sind ein fester Bestandteil in der Didaktik und Methodik des Unterrichts der Grundschule. Ebenso verlangen auch Fachdidaktiker den
Unterricht bei Kindern und Jugendlichen mit dem Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung weiter zu öffnen, da diese Schülergruppe keine spezielle Didaktik bedürfe.
Auch die Empfehlungen der Kultusministerkonferenz verweisen auf individuelle Förderungen der Schülerinnen und Schüler mithilfe öffnender Unterrichtsformen. Herkömmliche Unterrichtskonzepte sind im Unterricht für Schüler mit emotionalen und sozialen Förderbedarf
kaum noch durchführbar, wenn die Lehrkräfte den besonderen Bedürfnissen dieser Schülergruppe gerecht werden wollen. Voraussetzung hierfür ist jedoch, dass sich die offenen
Unterrichtsformen wie die Arbeit mit dem Wochenplan für die in sich sehr differente Schülerklientel als geeignet erweisen, da immer wieder Autoren betonen, dass dieser Schülergruppe die nötigen Kompetenzen wie z.B. Handlungsplanung und Regelbeachtung fehlen
und so klar strukturierte Lernarrangements vorzuziehen seien.
In der anschließenden Ausarbeitung soll daher erläutert und an empirischen Daten untersucht werden, ob der offene Unterricht und speziell die Arbeit mit dem Wochenplan sich positiv auf das Lernverhalten von Schülern mit emotionalen und sozialen Förderbedarf auswirken kann.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Schülerinnen und Schüler mit dem Förderschwerpunkt im Bereich des emotionalen Erlernens und sozialen Handelns
- Problematik der Begriffsbestimmung
- Lernrelevante Verhaltensmerkmale bei emosoz- Schülern
- Die Empfehlungen der Kultusministerkonferenz
- Offener Unterricht
- Begriff und Dimensionen des offenen Unterrichts
- Wochenplanarbeit
- Diskussion und Forschungsstand im Hinblick auf den offenen Unterricht mit emosoz- Schülern
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Einsatzmöglichkeiten des offenen Unterrichts, insbesondere der Wochenplanarbeit, für Schülerinnen und Schüler mit dem Förderschwerpunkt im Bereich des emotionalen Erlernens und sozialen Handelns. Das Ziel ist es, herauszufinden, ob diese Unterrichtsform das Lernverhalten dieser Schülergruppe positiv beeinflussen kann und welche Faktoren dabei zu berücksichtigen sind.
- Problematik der Begriffsbestimmung von „Schülerinnen und Schüler mit dem Förderschwerpunkt im Bereich des emotionalen Erlernens und sozialen Handelns“
- Lernrelevante Verhaltensmerkmale dieser Schülergruppe
- Empfehlungen der Kultusministerkonferenz (KMK) für den Unterricht mit emosoz- Schülern
- Begriff und Dimensionen des offenen Unterrichts
- Einsatzmöglichkeiten der Wochenplanarbeit im Unterricht mit emosoz- Schülern
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel gibt einen Einblick in die aktuelle Debatte über offene Unterrichtsformen und deren Bedeutung für die Grundschulpädagogik. Es werden die Ziele des offenen Unterrichts, wie Ganzheitlichkeit, Selbstständigkeit und soziales Lernen, sowie die Notwendigkeit einer Weiterentwicklung des Unterrichts für Schülerinnen und Schüler mit emotionalen und sozialen Förderbedürfnissen hervorgehoben.
Das zweite Kapitel beschäftigt sich mit der heterogenen Schülergruppe, die im Fokus dieser Arbeit steht. Es werden verschiedene Begrifflichkeiten und Definitionen von „Schülerinnen und Schüler mit dem Förderschwerpunkt im Bereich des emotionalen Erlernens und sozialen Handelns“ diskutiert, sowie lernrelevante Verhaltensmerkmale dieser Schülergruppe dargestellt. Des Weiteren werden die Empfehlungen der KMK zum Unterricht mit emosoz- Schülern vorgestellt.
Das dritte Kapitel widmet sich dem offenen Unterricht und beleuchtet verschiedene Dimensionen von „Offenheit“. Die Arbeit mit dem Wochenplan als eine offene Unterrichtsform wird näher betrachtet und im Hinblick auf den Unterricht mit emosoz- Schülern diskutiert.
Schlüsselwörter
Offener Unterricht, Wochenplanarbeit, emotionale und soziale Entwicklung, Förderschwerpunkt, Lernverhalten, Verhaltensauffälligkeiten, Kultusministerkonferenz, Empfehlungen, empirische Daten, Schülergruppen, Unterrichtskonzepte, Didaktik, Methodik, Grundschule, Integration, Individualisierung.
- Quote paper
- Bachelor of Science Eva Veddeler (Author), 2011, Offener Unterricht bei Schülerinnen und Schülern mit dem Förderschwerpunkt im Bereich des emotionalen Erlernens und sozialen Handelns am Beispiel von Wochenplanarbeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/181381