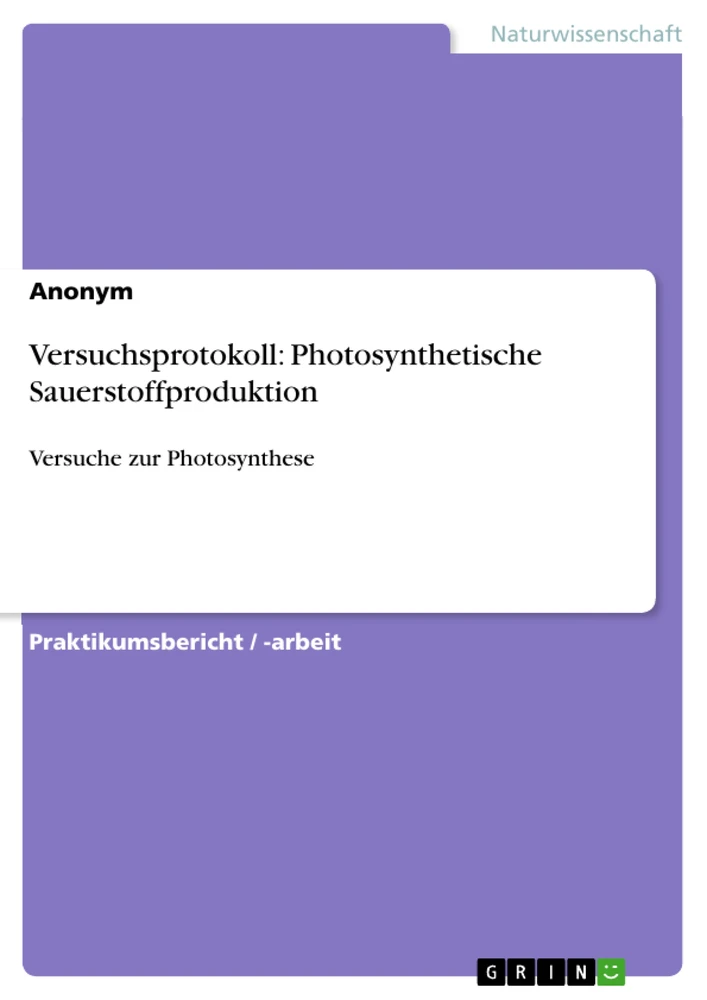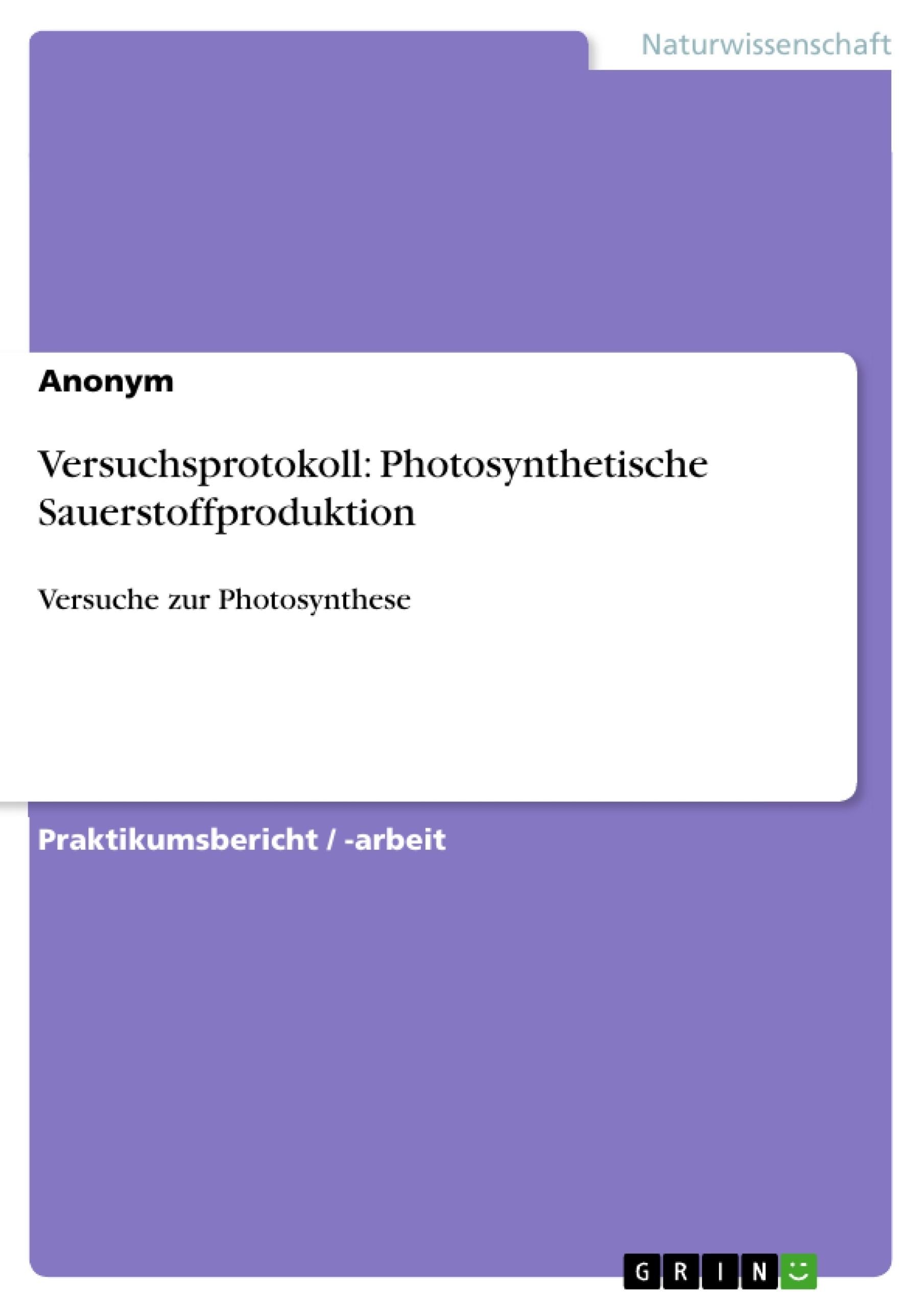Im Allgemeinen sind Lebewesen organisierte, aus organischen Stoffen bestehende Strukturen, die aufgenommene Stoffe chemisch umwandeln können (Metabolismus), einen genetischen Bauplan besitzen (DNA) und diesen an eine Folgegeneration weiter vererben können (Reproduktion). Diese Vorgänge setzen jedoch voraus, dass der Organismus auf schnell verfügbare, chemische Energieträger zurückgreifen kann, welche leicht zu transportieren und zu speichern sind, gleichzeitig aber genug Energie für die oben genannten Vorgänge liefern. Einer der wichtigsten ist die Glucose. Ein aus Kohlenstoff, Sauerstoff und Wasserstoff bestehendes Molekül, das von einem Organismus leicht verwertet werden kann und zugleich ein guter Energielieferant ist. Dieses Molekül entsteht jedoch nicht spontan, sondern muss gebildet werden. Die Ausgangsstoffe für die Glucosebildung, Kohlenstoffdioxid und Wasser sind auf der Erde ubiquitär. Die Energie zur Synthese von Glucose liefert die Sonne, in Form von unter anderem sichtbarem Licht. Je nach Jahreszeit und Ort der Messung schwankt der Energieeintrag der Sonne zwar, liegt im Mittel für die gesamte Erdoberfläche jedoch bei ungefähr 1,37 kJ pro Sekunde und Quadratmeter. Viele Organismen sind auf diese Energiequelle direkt oder indirekt angewiesen. Dabei nutzen heterotrophe Organismen die Energie, welche zuvor von autotrophen Organismen verfügbar gemacht wurde. Fast alle autotrophen Organismen
sind zur Photosynthese befähigt. Hierbei wird überwiegend und allgemein gesprochen Wasser oxidiert und Kohlenstoffdioxid reduziert. Bei genauerer Betrachtung der Vorgänge in den Chloroplasten, der Ort an dem die Photosynthese stattfindet, stellt man fest, dass die Synthese in zwei Phasen gegliedert ist.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Material und Methoden
- 2.1 Polarographische Messung der photosynthetischen O²-Produktion
- 2.2 Hill-Reaktion isolierter Chloroplasten
- 3 Ergebnisse
- 3.1 Polarographische Messung der photosynthetischen O²-Produktion
- 3.2 Hill-Reaktion isolierter Chloroplasten
- 3.2.1 Erster Versuchsteil
- 3.2.2 Zweiter Versuchsteil
- 4 Diskussion
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Das Versuchslabor beschreibt verschiedene Experimente zur Untersuchung der photosynthetischen Sauerstoffproduktion in Pflanzen. Die Zielsetzung liegt darin, die Mechanismen der Photosynthese zu verstehen und die Faktoren, die die Sauerstoffproduktion beeinflussen, zu analysieren.
- Polarographische Messung der photosynthetischen O²-Produktion
- Hill-Reaktion isolierter Chloroplasten
- Einfluss von Lichtintensität und Wellenlänge auf die Sauerstoffproduktion
- Rolle von Elektronenakzeptoren in der Photosynthese
- Untersuchung der Lichtphase und Dunkelphase der Photosynthese
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 führt in das Thema der Photosynthese ein und erklärt die Bedeutung von Glucose als Energieträger. Es wird erläutert, wie die Photosynthese in zwei Phasen - Lichtphase und Dunkelphase - abläuft.
Kapitel 2 beschreibt die verwendeten Materialien und Methoden. Hier werden die polarographische Messung der Sauerstoffproduktion und die Hill-Reaktion isolierter Chloroplasten detailliert dargestellt.
Kapitel 3 präsentiert die Ergebnisse der Experimente. Die Ergebnisse der polarographischen Messung der Sauerstoffproduktion bei verschiedenen Belichtungsbedingungen sowie die Ergebnisse der Hill-Reaktion werden in diesem Kapitel zusammengefasst.
Schlüsselwörter
Photosynthese, Sauerstoffproduktion, Chloroplasten, Lichtphase, Dunkelphase, Polarographie, Hill-Reaktion, Elektronenakzeptor, NADP, Kaliumhexacyanidoferrat(III), Chlamydomonas reinhardtii
- Quote paper
- Anonym (Author), 2011, Versuchsprotokoll: Photosynthetische Sauerstoffproduktion, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/181389