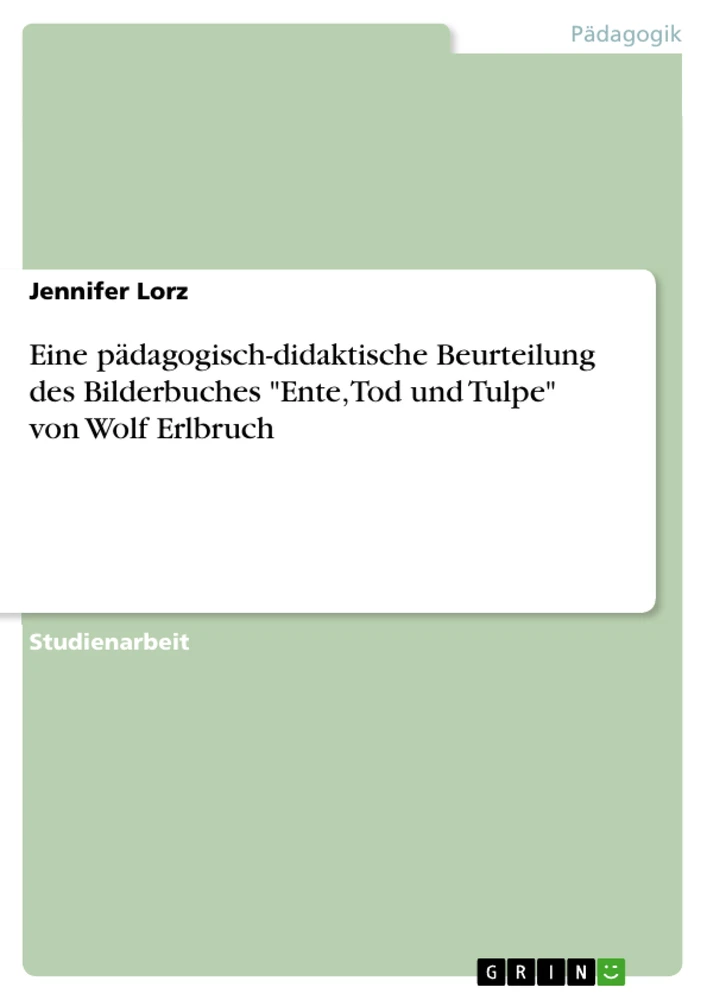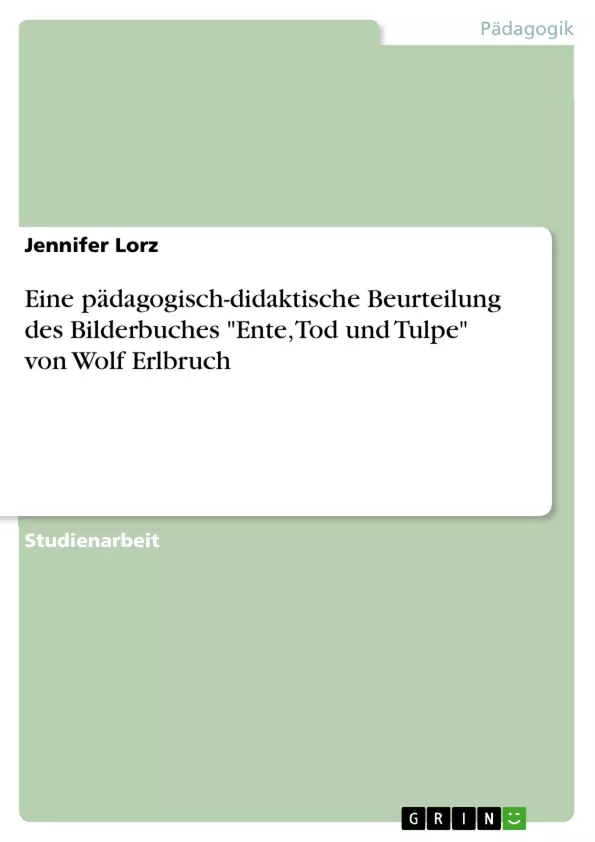Der Literaturunterricht in der Grundschule hat sich in den vergangenen Jahrzehnten stark in seiner Funktion verändert. Besonders Interpretationen, die Deutung von Stilmitteln und die literarische Ästhetik standen im traditionellen Literaturunterricht stark im Vordergrund. Der moderne Literaturunterricht ergänzt noch weitere Aspekte, z.B. die Vermittlung von
Weltwissen und Erfahrungshorizonte[n], die in Geschichten künstlerisch verarbeitet sind. [...] Literatur [provoziert] Fragen, die dazu einladen, über sich selbst, seine eigene Lebenssituation, sein Selbstverständnis und […] über Perspektiven von anderen nachzudenken (Waldt 2003: 103 f.).
Um dies dem Schüler zu ermöglichen, bedarf es einer reflektierten Auswahl der Literatur seitens des Lehrers.
Diese Seminararbeit stellt einen ersten Versuch der Autorin dar, ein Bilderbuch auf seine pädagogisch-didaktische Qualität zu beurteilen. Hierfür wählt sie das Buch Ente, Tod und Tulpe von Wolf Erlbruch. Es wurde im Seminar Textrezeption – Weiterführendes Lesen, Kinderliteratur, Kindermedien von Frau Prof. Riegler vorgestellt. Die Autorin selbst fand zu Beginn keinen Zugang zu diesem Bilderbuch und verstand nicht, weshalb es laut Überzeugung der Professorin für den Unterricht geeignet sei. Demzufolge wählte die Autorin dieses Buch, um es professionell in Augenschein zu nehmen.
Der Leser erhält im folgenden Kapitel eine Einführung in das literarische Lehren in der Primarstufe. Darin verdeutlicht die Autorin die Bedeutung der korrekten Auswahl von Literaturmaterialien und gibt anschließend eine kurze Einleitung in die Bilderbuchart problemorientiertes Bilderbuch. Danach wird ein Leitfaden zur pädagogisch-didaktischen Beurteilung der Qualität von Bilderbüchern vorgestellt, an dem sich die Autorin orientiert. Das dritte Kapitel enthält die Ausführungen ihrer Beurteilung, woran sich das vierte Kapitel mit einem Fazit anschließt.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Literarisches Lehren in der Primarstufe
- 2.1 Die Bedeutung der korrekten Literaturauswahl
- 2.2 Problemorientierte Bilderbücher im Unterricht
- 3 Das Bilderbuch Ente, Tod und Tulpe von Erlbruch
- 3.1 Inhalt
- 3.2 Gestaltung
- 3.2.1 Illustrationsbezogene Qualität
- 3.2.2 Sprachliche Qualität
- 3.2.3 Verhältnis von Bild und Text
- 3.2.4 Typographische Gestaltung
- 3.3 Erzählweise
- 3.4 Hinweise zur Interpretation und Funktion
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit analysiert die pädagogisch-didaktische Qualität des Bilderbuchs "Ente, Tod und Tulpe" von Wolf Erlbruch für den Einsatz im Grundschulunterricht. Die Autorin untersucht, ob und wie das Buch geeignet ist, literarisches Lernen und Lesekompetenz zu fördern. Dabei wird die Bedeutung einer reflektierten Literaturauswahl im Kontext des modernen Literaturunterrichts beleuchtet.
- Bedeutung der korrekten Literaturauswahl im Grundschulunterricht
- Charakteristika problemorientierter Bilderbücher
- Pädagogisch-didaktische Beurteilungskriterien für Bilderbücher
- Analyse des Inhalts und der Gestaltung von "Ente, Tod und Tulpe"
- Eignung des Buches für den Umgang mit dem Thema Tod und Trauer im Unterricht
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung erläutert den Wandel des Literaturunterrichts in der Grundschule hin zu einer breiteren Perspektive, die über Interpretation und Stilmittel hinausgeht und die Vermittlung von Weltwissen und Erfahrungshorizonten miteinschließt. Die Autorin begründet ihre Wahl des Bilderbuchs "Ente, Tod und Tulpe" mit ihrer anfänglichen Schwierigkeit, dessen pädagogischen Wert zu erkennen, und erklärt den Aufbau der Arbeit.
2 Literarisches Lehren in der Primarstufe: Dieses Kapitel behandelt die Bedeutung der Literaturauswahl im Grundschulunterricht. Es wird hervorgehoben, dass eine reflektierte Auswahl notwendig ist, um die Lesekompetenz und das literarische Lernen zu fördern und die unterschiedlichen literarischen Erfahrungen der Schüler zu berücksichtigen. Besonders wird auf die Bedeutung einer dialogischen Vorlesepraxis und die Förderung der Imaginationsfähigkeit eingegangen. Das Kapitel führt ausserdem in die spezifische Kategorie der problemorientierten Bilderbücher ein, die soziale und personale Probleme thematisieren und die Kinder zur Reflexion anregen sollen. Allerdings wird auch der verantwortungsvolle Umgang mit solchen Büchern betont, um eine Überforderung der Kinder zu vermeiden.
Schlüsselwörter
Bilderbuch, "Ente, Tod und Tulpe", Wolf Erlbruch, Grundschulpädagogik, Literaturunterricht, Lesekompetenz, problemorientierte Bilderbücher, pädagogisch-didaktische Beurteilung, Tod, Trauer, Kinderliteratur, Imaginationsfähigkeit, dialogische Vorlesepraxis.
Häufig gestellte Fragen zu "Ente, Tod und Tulpe" - Seminararbeit
Was ist der Gegenstand dieser Seminararbeit?
Die Seminararbeit analysiert die pädagogisch-didaktische Qualität des Bilderbuchs "Ente, Tod und Tulpe" von Wolf Erlbruch für den Einsatz im Grundschulunterricht. Es wird untersucht, ob und wie das Buch geeignet ist, literarisches Lernen und Lesekompetenz zu fördern.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die Bedeutung der reflektierten Literaturauswahl im Grundschulunterricht, die Charakteristika problemorientierter Bilderbücher, pädagogisch-didaktische Beurteilungskriterien für Bilderbücher, die Analyse von Inhalt und Gestaltung von "Ente, Tod und Tulpe" und die Eignung des Buches für den Umgang mit dem Thema Tod und Trauer im Unterricht.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zum literarischen Lehren in der Primarstufe, ein Kapitel zur detaillierten Analyse des Bilderbuchs "Ente, Tod und Tulpe" (Inhalt, Gestaltung, Erzählweise, Interpretation) und ein Fazit. Die Einleitung beleuchtet den Wandel des Literaturunterrichts und die Wahl des Buches. Das Kapitel zum literarischen Lehren in der Primarstufe fokussiert die Bedeutung der Literaturauswahl und problemorientierter Bilderbücher.
Welche Aspekte von "Ente, Tod und Tulpe" werden analysiert?
Die Analyse von "Ente, Tod und Tulpe" umfasst den Inhalt, die Gestaltung (Illustrationsbezogene Qualität, Sprachliche Qualität, Verhältnis von Bild und Text, Typographische Gestaltung), die Erzählweise und Hinweise zur Interpretation und Funktion des Buches im Kontext des Grundschulunterrichts.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
(Der HTML-Auszug enthält kein explizites Fazit. Die Schlussfolgerung muss aus der vollständigen Arbeit entnommen werden.) Die Arbeit untersucht die Eignung des Buches zur Förderung von Lesekompetenz und literarischem Lernen und beleuchtet die pädagogischen Herausforderungen und Chancen, die mit der Thematik Tod und Trauer verbunden sind.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Bilderbuch, "Ente, Tod und Tulpe", Wolf Erlbruch, Grundschulpädagogik, Literaturunterricht, Lesekompetenz, problemorientierte Bilderbücher, pädagogisch-didaktische Beurteilung, Tod, Trauer, Kinderliteratur, Imaginationsfähigkeit, dialogische Vorlesepraxis.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für Grundschullehrer, Lehramtsstudenten, Pädagogen und alle, die sich für den Einsatz von Kinderliteratur im Unterricht und die Vermittlung schwieriger Themen wie Tod und Trauer interessieren.
- Arbeit zitieren
- BA Jennifer Lorz (Autor:in), 2011, Eine pädagogisch-didaktische Beurteilung des Bilderbuches "Ente, Tod und Tulpe" von Wolf Erlbruch, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/181455