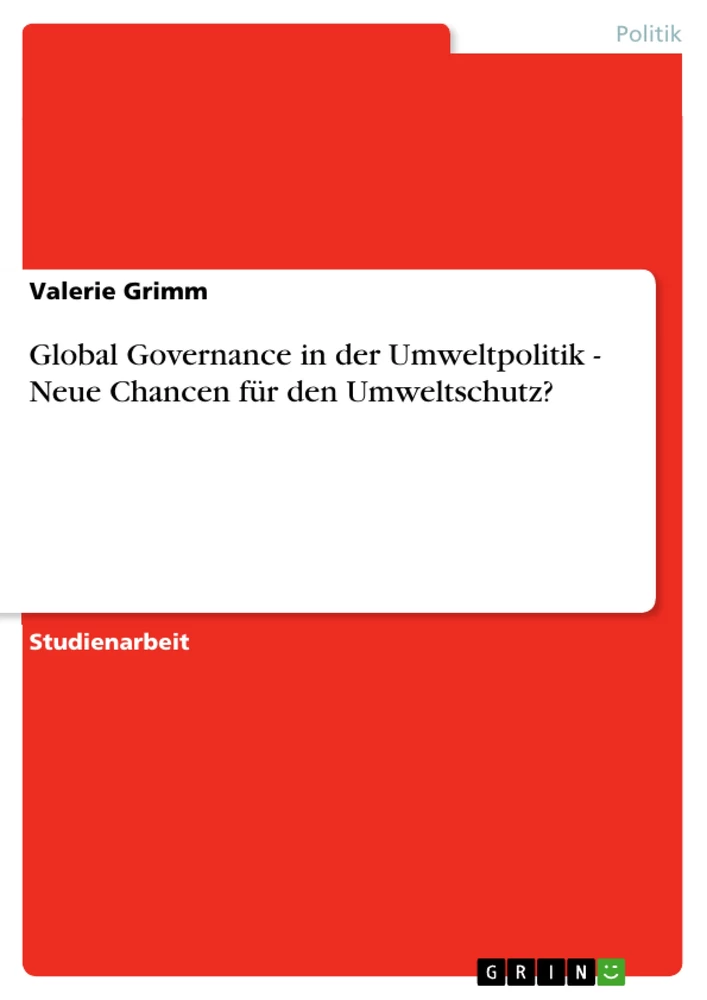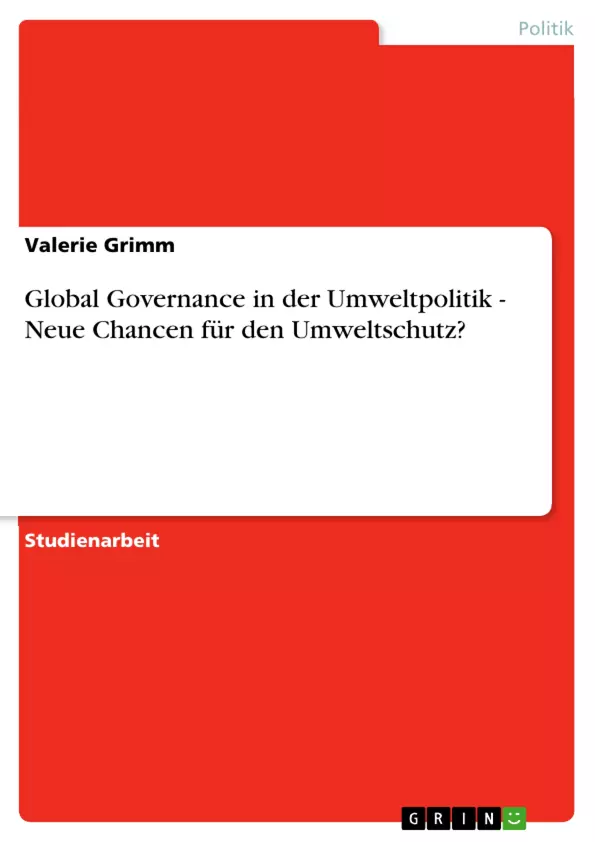1 Einleitung
Unser Ökosystem, die Erde, gelangt immer stärker an den Rand seiner Belastungsgrenze: Ein bisweilen ungebrochenes Bevölkerungswachstum (zumindest auf der südlichen Hemisphäre), unvorstellbare Massen an menschlich verursachten Müll, ein übermäßiger Energie- und Rohstoffverbrauch sowie die damit einhergehende ansteigende Verschmutzung von Luft, Böden und Gewässern und das zunehmende Aussterben zahlreicher Tier- und Pflanzenarten etc.
Erschreckend ist, dass auch im 21. Jahrhundert noch eine große Divergenz dahingehend zu herrschen scheint, Probleme hinsichtlich der Umwelt bzw. dem Umgang mit dieser einerseits zu erkennen und andererseits aber auch konkrete Lösungsmöglichkeiten und Projekte zu entwerfen. Spätestens seit Beginn der 1990 Jahre hat sich sowohl im öffentlichen Bewusstsein als auch in der Politik die Einsicht durchgesetzt, dass eine dringende Notwendigkeit dahingehend besteht, ökologisch nachhaltige Produktions- und Konsummuster zu entwickeln, um auch in Zukunft das Ökosystem Erde mit all seinen Lebewesen zu erhalten. Jedoch hinkt die tatsächliche Umsetzung solcher Kenntnisse dieser Einsicht um einiges hinter her.
Im Verlauf dieser Arbeit soll daher analysiert werden, welche Rolle das Konzept des Global Governance in der Umweltpolitik bzw. generell in Umweltfragen einnehmen kann und welche Chancen sich daraus für den Fortbestand unseres Ökosystems ergeben könnten.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Global Governance
- Begriffsdefinition: Bedeutung und Funktionen von Global Governance
- Akteure von Global Governance
- Global Governance in der Umweltpolitik
- Der Wandel in der internationalen Klimapolitik
- Das Kyoto Protokoll
- Der Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)
- Ursachen und Folgen des Klimawandels
- Ursachen bzw. Verursacher der Klimawandels
- Folgen des Klimawandels
- Maßnahmen zum „Stoppen“ des Klimawandels – potentielle Lösungsansätze
- Der Emissionshandel als potentieller Lösungsansatz
- Aktueller Stand in der internationalen Umweltpolitik
- Ausblick- Die Zukunft der internationalen Klimapolitik
- Bibliographie
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit befasst sich mit dem Konzept des Global Governance im Kontext der Umweltpolitik. Ziel ist es, die Bedeutung und Funktionen von Global Governance in Umweltfragen zu analysieren und die Chancen für den Schutz unseres Ökosystems zu beleuchten.
- Begriffsdefinition und Funktionen von Global Governance
- Akteure und Strukturen von Global Governance
- Der Wandel in der internationalen Klimapolitik
- Ursachen und Folgen des Klimawandels
- Potentielle Lösungsansätze für den Klimawandel
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Problematik des Klimawandels und die Notwendigkeit für nachhaltige Produktions- und Konsummuster dar. Kapitel 2 definiert den Begriff Global Governance und erläutert seine Bedeutung und Funktionen. Es werden die verschiedenen Akteure und Strukturen von Global Governance vorgestellt. Kapitel 3 analysiert den Wandel in der internationalen Klimapolitik und beleuchtet das Kyoto Protokoll sowie den Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). Kapitel 4 befasst sich mit den Ursachen und Folgen des Klimawandels und stellt potentielle Lösungsansätze vor, darunter der Emissionshandel. Kapitel 5 gibt einen Überblick über den aktuellen Stand in der internationalen Umweltpolitik. Der Ausblick in Kapitel 6 beschäftigt sich mit der Zukunft der internationalen Klimapolitik.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen Global Governance, Umweltpolitik, Klimawandel, Kyoto Protokoll, Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), Emissionshandel, Nachhaltigkeit, internationale Kooperation, Akteure, Strukturen, Chancen, Herausforderungen.
- Citation du texte
- Bachelor of Arts Valerie Grimm (Auteur), 2009, Global Governance in der Umweltpolitik - Neue Chancen für den Umweltschutz?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/181458