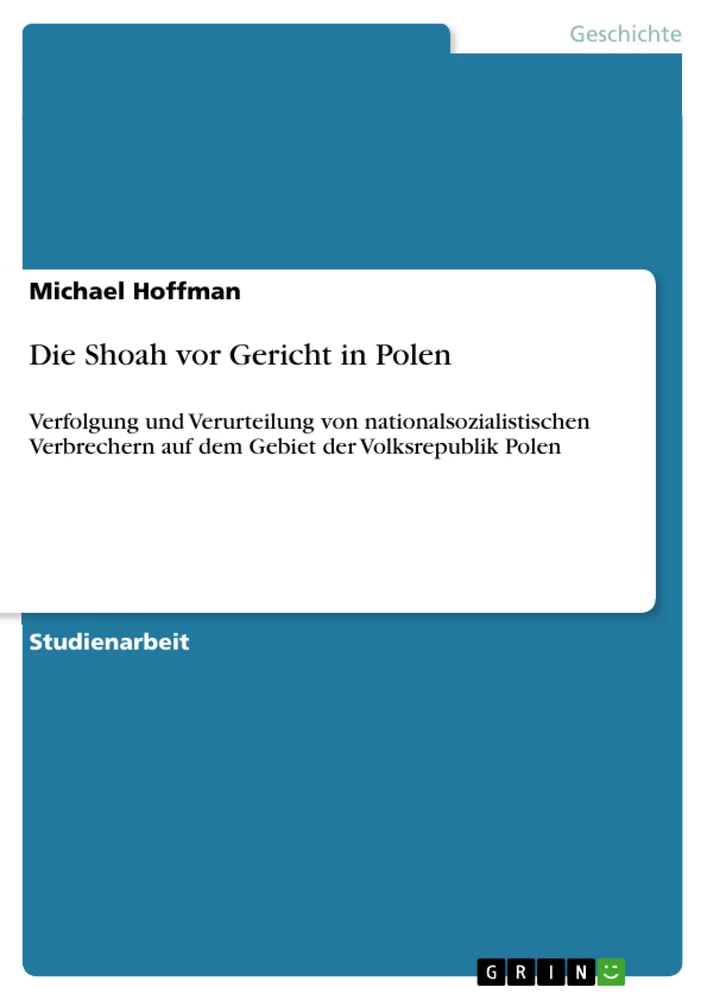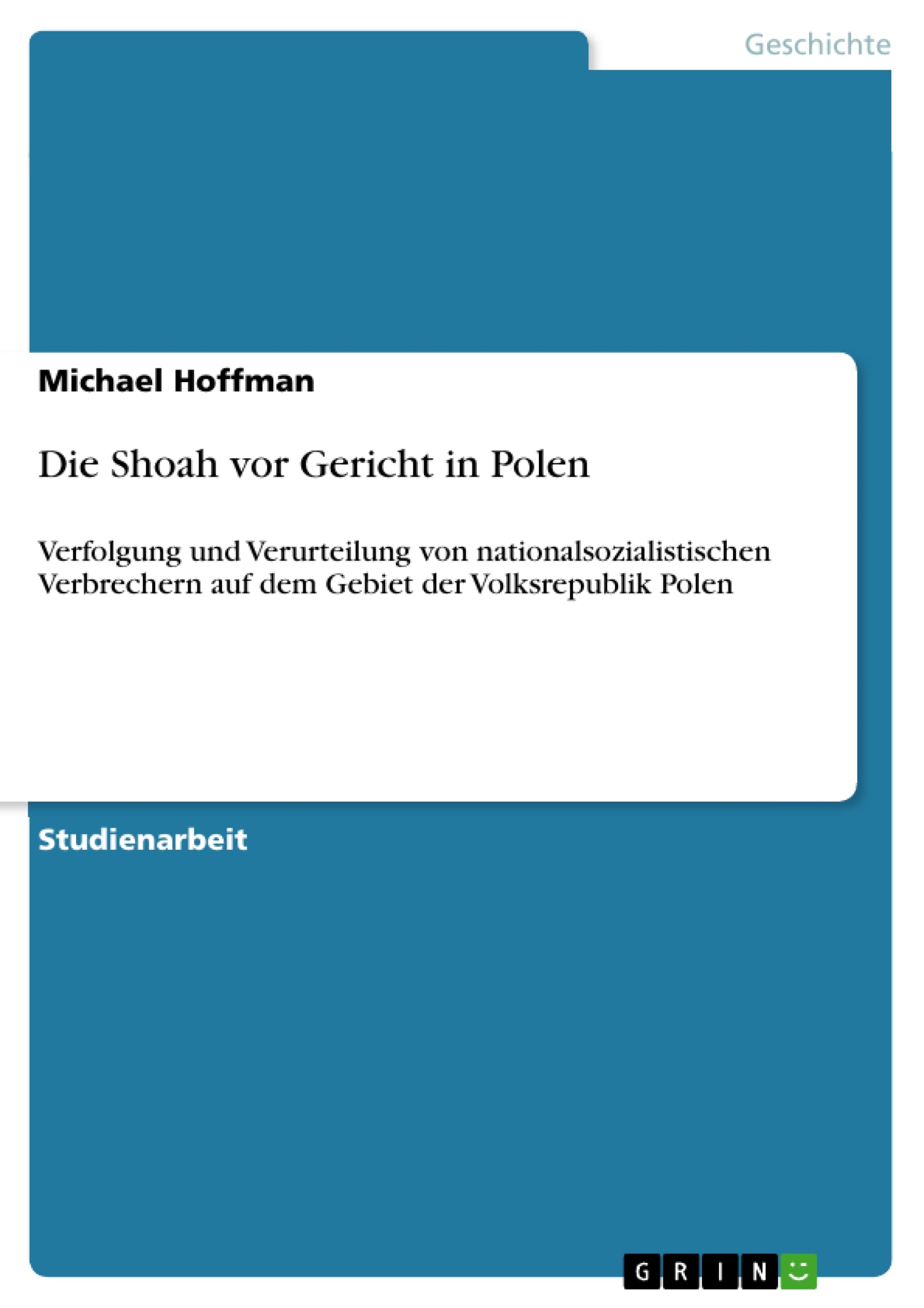Das Generalgouvernement und die annektierten Gebiete waren neben den Massenerschießungsstätten hinter der Ostfront die Haupttatorte der Shoah. In Polen befanden sich die meisten Ghettos und alle sechs nationalsozialistischen Vernichtungslager. Wenngleich die Wahnsinnsidee einer industriellen Vernichtung der europäischen Juden an anderen Orten geplant und vorbereitet wurde, so fand sie hier ihre praktische Vollendung. Die größte Opfergruppe unter den Juden stellen die polnischen Juden dar, sie wurden fast zur Gänze (90%) ausgelöscht.
Einer internationalen Vereinbarung nach erfolgte die juristische Verfolgung der Täter, die als Lagerpersonal oder in der Okkupationsverwaltung unmittelbar für die Deportation und Vernichtung verantwortlich waren, durch die Volksrepublik Polen. Angesichts der Tatsache, dass die Nationalsozialisten in Polen, im Gegensatz zu Deutschland und Österreich, auch in der katholischen Bevölkerung massenhaft mordeten, fehlte im polnischen Justizwesen ein Verständnis für die Einmaligkeit der Shoah. Aus der Sicht der polnischen Gerichte waren die Verbrechen mit aller Härte der neu geschaffenen Paragraphen zu bestrafen (und tatsächlich fielen die Urteile schärfer aus als im Westen), aber die Massenmorde an den polnischen und europäischen Juden waren eben nur ein Teil der Besatzungsverbrechen und ihnen wurde keine historische oder juristische Besonderheit zugemessen. Obwohl in den ersten Jahren nach dem Krieg sogar eine eigene Behörde (Centralna Żydowska Komisja Historyczna – Zentrale jüdische historische Kommission) geschaffen wurde, die von Juden geleitet war und sich mit der Untersuchung und Dokumentation der Verbrechen beschäftigte, ebbte ab 1950 das Interesse an der Shoah drastisch ab. Gründe dafür waren eine zunehmende Abwanderung der Überlebenden aus Polen - vornehmlich nach Israel und die USA – und das Wiederaufleben des Antijudaismus innerhalb des polnischen Regimes. Ein Auslieferungsstopp bewirkte zudem, dass spätere Auschwitz- und Majdanekprozesse trotz der Moskauer Erklärung nicht mehr in Polen, sondern in der Bundesrepublik stattfanden.
Inhaltsverzeichnis
- Inhaltsverzeichnis
- Einführung
- Polen als Tatort der Shoah
- Weichenstellungen in der Besatzungszeit
- Gesetzliche Grundlagen (Augustdekret) und Ermittlungen
- Auslieferung und Prozesse
- Schlussfolgerungen
- Quellen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit befasst sich mit der juristischen Aufarbeitung der Shoah in Polen und untersucht die NS-Prozesse in diesem Kontext. Ziel ist es, neue Erkenntnisse über die Verfolgung von NS-Verbrechen als Teil eines europäischen Gesamtprojektes zu gewinnen.
- Die Sonderstellung Polens als Haupttatort der Shoah
- Die juristische Verfolgung von NS-Tätern durch die Volksrepublik Polen
- Die Herausforderungen der Quellenlage und die Bedeutung einzelner Prozesse
- Die Rolle der polnischen Justiz im Kontext der Shoah
- Die Entwicklung der Forschung zur Shoah in Polen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einführung stellt die Arbeit und ihre Zielsetzung vor. Sie erläutert die Sonderstellung Polens als Haupttatort der Shoah und die Herausforderungen der Quellenlage. Die Arbeit konzentriert sich auf die juristische Aufarbeitung der Shoah in Polen und untersucht die NS-Prozesse in diesem Kontext. Sie beleuchtet die Rolle der polnischen Justiz im Kontext der Shoah und die Entwicklung der Forschung zur Shoah in Polen.
Das Kapitel "Polen als Tatort der Shoah" beschreibt die Bedeutung Polens als Haupttatort der Shoah und die Rolle der polnischen Juden als Opfergruppe. Es beleuchtet die Besonderheiten der Shoah in Polen und die Herausforderungen der juristischen Aufarbeitung.
Das Kapitel "Weichenstellungen in der Besatzungszeit" analysiert die politischen und rechtlichen Rahmenbedingungen der NS-Herrschaft in Polen. Es beleuchtet die Rolle der deutschen Besatzungsverwaltung und die Auswirkungen auf die jüdische Bevölkerung.
Das Kapitel "Gesetzliche Grundlagen (Augustdekret) und Ermittlungen" untersucht die rechtlichen Grundlagen der NS-Prozesse in Polen und die Ermittlungsarbeit der polnischen Behörden. Es beleuchtet die Herausforderungen der Beweisführung und die Rolle der polnischen Justiz.
Das Kapitel "Auslieferung und Prozesse" analysiert die Auslieferung von NS-Tätern nach Polen und die Durchführung der Prozesse. Es beleuchtet die Besonderheiten der polnischen Prozesse und die Urteilsfindung.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Shoah, NS-Prozesse, Polen, juristische Aufarbeitung, Besatzungszeit, Augustdekret, Auslieferung, Quellenlage, Täterforschung, Holocaust, polnische Justiz, Geschichte, Erinnerungskultur.
- Citation du texte
- Michael Hoffman (Auteur), 2011, Die Shoah vor Gericht in Polen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/181460