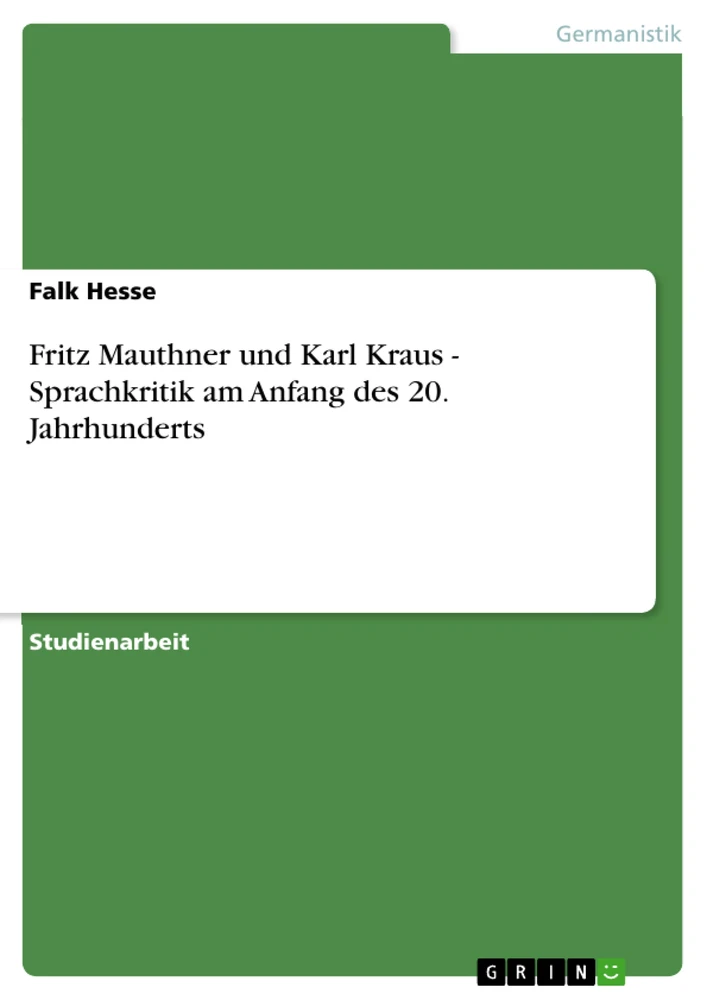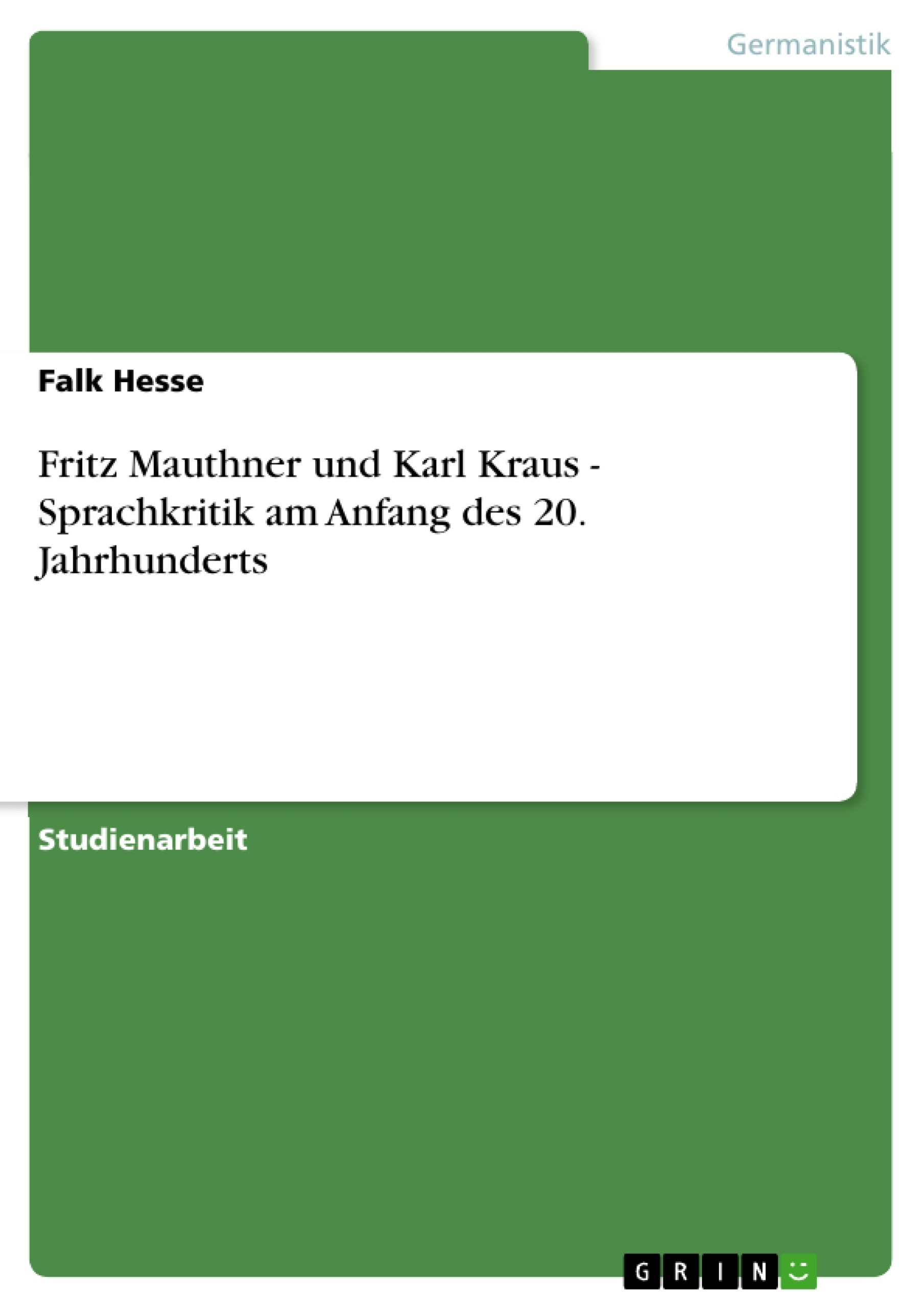Ab der Zeit um 1900 näherten sich der Bereich der Sprachkritik als Stil- oder Textkritik und der Bereich der Sprachkritik als einzelsprachliche Sprachentwicklung immer mehr aneinander an und es begann eine neue Phase der Sprachkritik im deutschsprachigen Raum. Der Sprachpurismus der vorhergehenden Phase wurde abgelöst und durch sprachkritisches und sprachskeptisches Denken ersetzt. Dieses Denken ging mit dem Beginn des 20. Jahrhunderts auch über in Wissenschaftskritik, politische Kritik und politischen Avantgardismus, die bis in die heutige Zeit wirksam sind. Mit der Radikalisierung der Sprachkritik geriet auch die Verbindung von Erkenntniskritik und Stil- bzw. Textkritik immer mehr in den Vordergrund. In den Augen der Sprachkritiker des beginnenden 20. Jahrhunderts hatten vor allem Wissenschaftler, Politiker und Journalisten Schuld an der konstatierten „allgemeinen Sprachkrise“ dieser Zeit. Die Sprachkritiker kämpften gegen eine „im Positivismus erstarrte Gesellschaft“ und kritisierten die Popularisierung der konventionellen Literatursprache, die in Zeitungen, Trivialliteratur und öffentlichen Reden massenhaft ritualisiert wurde. Als herausragende Personen ihrer Zeit sollen in dieser Arbeit die Sprachkritiker Fritz Mauthner und Karl Kraus betrachtet werden. An ihrem Beispiel soll im Folgenden detailliert analysiert werden, welche Ansichten die Sprachkritik am Anfang des 20. Jahrhunderts vertrat.
Hierzu wird zu Beginn der Arbeit Fritz Mauthner und seine Vorstellung von Sprache und Wirklichkeit betrachtet. Daran anschließend werden Mauthners Ansichten zum Thema ‚Zufallssinne„, ‚Schweigen„ und ‚leere Begriffe„ analysiert. Nach dieser Analyse wird das sprachkritische Verständnis Karl Kraus beleuchtet, welches sich vor allem in der Krausschen Auseinandersetzung mit der Presse widerspiegelte.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Fritz Mauthner
- Sprache und Wirklichkeit
- Zufallssinne und Metaphern
- Verstummen als Konsequenz
- Leere Begriffe
- Karl Kraus
- Die Presse
- Die Phrase
- Schlussbetrachtungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die Sprachkritik von Fritz Mauthner und Karl Kraus im Kontext des frühen 20. Jahrhunderts. Sie beleuchtet die Kritik an Sprache und Wirklichkeit, die Kritik an der Presse und an leeren Begriffen, sowie die Konsequenzen, die sich aus dieser Sprachkritik ergeben.
- Das Verhältnis von Sprache und Wirklichkeit
- Die Kritik an der Sprache als Mittel zur Erkenntnisgewinnung
- Die Rolle der Sprache in der Konstruktion von Wirklichkeit
- Die Kritik an der Presse und am Sprachgebrauch in der öffentlichen Kommunikation
- Die Konsequenzen der Sprachkritik für Denken und Handeln
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung führt in das Thema der Sprachkritik ein und erläutert die drei Bereiche der Sprachkritik nach Hans Jürgen Heringer. Sie zeigt, wie sich im frühen 20. Jahrhundert Sprachkritik als Erkenntniskritik und Stil- bzw. Textkritik verband und zu einer neuen Phase sprachkritischen Denkens führte.
Fritz Mauthner
Sprache und Wirklichkeit
Dieses Kapitel beleuchtet Mauthners Werk, „Beiträge zu einer Kritik der Sprache“, und seine Vorstellung von Sprache als einem eigenständigen System, das unabhängig von der Wirklichkeit funktioniert. Es wird der unüberbrückbare Gegensatz zwischen Sprache und Wirklichkeit sowie die Unmöglichkeit der Welterkenntnis durch Sprache herausgestellt.
Zufallssinne und Metaphern
Dieses Kapitel analysiert Mauthners Ansichten zu Zufallssinne und Metaphern. Es zeigt, wie Mauthner die Sprache als ein System von Begriffen betrachtet, die keine direkte Beziehung zur Wirklichkeit haben, sondern nur durch Zufall und Metaphern miteinander verbunden sind.
Verstummen als Konsequenz
Dieses Kapitel beleuchtet Mauthners Schlussfolgerung, dass die Erkenntnis der Wirklichkeit durch Sprache unmöglich ist und das Verstummen als Konsequenz der Sprachkritik gefordert wird.
Leere Begriffe
Dieses Kapitel behandelt Mauthners Kritik an leeren Begriffen und an der Verfälschung der Wirklichkeit durch Sprache. Es zeigt, wie Mauthner die Sprache als ein System von Abstraktionen betrachtet, das die Wirklichkeit nicht angemessen widerspiegeln kann.
Karl Kraus
Die Presse
Dieses Kapitel beleuchtet Karl Kraus' scharfe Kritik an der Presse und deren Sprachgebrauch. Es wird gezeigt, wie Kraus die Sprache als Instrument der Manipulation und der Verfälschung der Wahrheit betrachtet und die Presse als ein Medium der Demagogie kritisiert.
Die Phrase
Dieses Kapitel analysiert Kraus' Kritik an der Phrase und am unreflektierten Sprachgebrauch in der öffentlichen Kommunikation. Es wird gezeigt, wie Kraus die Sprache als ein Mittel der Entfremdung von der Wirklichkeit betrachtet und die Phrase als ein Zeichen für den Verlust an Sinn und Substanz kritisiert.
Schlüsselwörter
Sprachkritik, Sprache, Wirklichkeit, Erkenntniskritik, Stilkritik, Fritz Mauthner, Karl Kraus, Presse, Phrase, Sprachskepsis, Sprachkrise, Denkgewohnheit, Abstraktion, Manipulation, Wahrheit, Demagogie, Entfremdung.
- Citation du texte
- Falk Hesse (Auteur), 2011, Fritz Mauthner und Karl Kraus - Sprachkritik am Anfang des 20. Jahrhunderts, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/181499