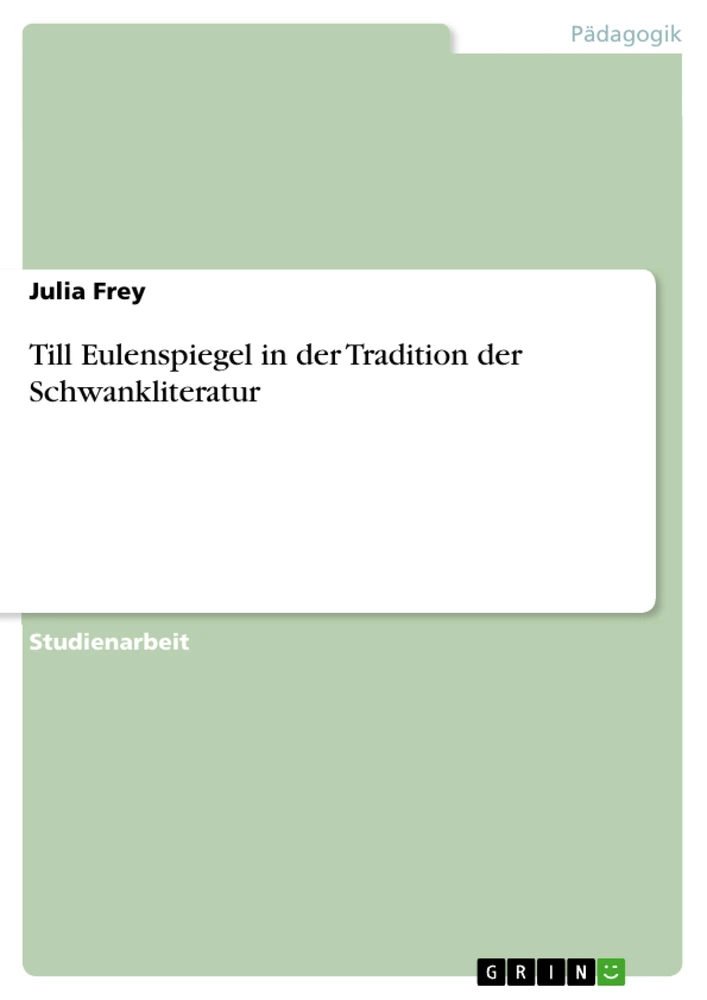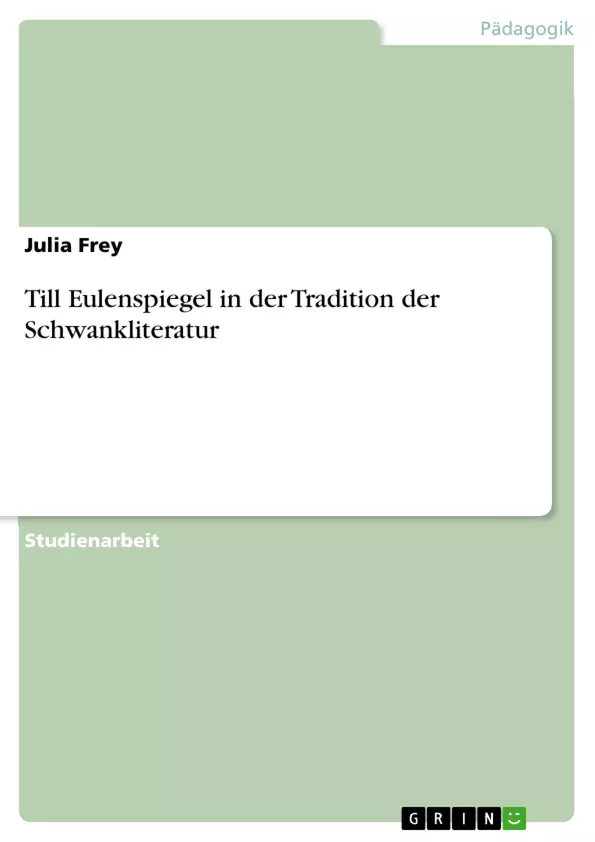Till Eulenspiegel ist kein harmloser Possenreißer, auch wenn ihn das Kinderbuch zu einem solchen umfunktioniert hat. Mehr noch: Unter allen Kinderbuchfiguren ist er ein Außenseiter, denn weder Tugenden noch Weisheiten lassen sich mit seinem Wesen vereinbaren. Bis heute besitzt er eine überraschende Popularität, obwohl er als Schwankheld auf den ersten Blick – vielleicht aufgrund seiner vielen negativen Eigenschaften – nicht zeitgemäß wirkt. Schließlich stellt Till Eulenspiegel einen „faulen Gelegenheitsarbeiter“, „Bauernfänger“ und „außerstän-dischen Landfahrer“ dar, der mit seiner überlegenen List Schaden anrichtet, aber neben Abscheu auch Bewunderung auslöst.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Volks- und Schwankbuchbegriff
- Pfaff Amîs und Dil Ulenspiegel
- Formbetrachtung
- Eine Historie
- Die Eigenschaften der Figuren
- Kritik der Gesellschaft
- Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Ziel dieser Arbeit ist es, die Rolle des Werkes Dil Ulenspiegel und der Figur Till Eulenspiegel in der Tradition der Schwankliteratur darzustellen. Der Text erörtert zunächst den Begriff des Volks- und Schwankbuches und charakterisiert die Figur Till Eulenspiegel im Vergleich mit dem Pfaffen Amîs. Die Arbeit geht außerdem der Frage nach, inwieweit sich die Werke Pfaff Amîs und Dil Ulenspiegel hinsichtlich ihrer Inhalte und Formen unterscheiden.
- Die Entwicklung des Volksbuchbegriffs
- Die Charakterisierung von Till Eulenspiegel als Schwankheld
- Der Vergleich von Till Eulenspiegel und Pfaff Amîs
- Die Rolle der Schwankliteratur in der Kritik der Gesellschaft
- Die Bedeutung von Humor und Satire in der Schwankliteratur
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung stellt Till Eulenspiegel als eine Figur vor, die in der Schwankliteratur eine bedeutende Rolle spielt und die Gesellschaft kritisch beleuchtet. Der Text beleuchtet die Popularität des Werkes Dil Ulenspiegel und die Frage nach der historischen Existenz des Titelhelden. Es wird erwähnt, dass der Verfasser des Dil Ulenspiegel, Hermen Bote, einige Schwänke aus anderen Werken entnommen und bearbeitet hat.
Der Volks- und Schwankbuchbegriff
Dieses Kapitel behandelt den Begriff „Volksbuch“ und dessen Entwicklung. Es werden verschiedene Ansätze zur Definition des Begriffs vorgestellt und die Entstehung von Volksbüchern aus verschiedenen Quellen beleuchtet. Der Text erläutert auch die spezifischen Merkmale des Schwankbuches und seine Bedeutung in der Literaturgeschichte.
Pfaff Amîs und Dil Ulenspiegel
Dieses Kapitel befasst sich mit dem Vergleich der Figuren Pfaff Amîs und Till Eulenspiegel. Es werden formelle und inhaltliche Unterschiede zwischen den beiden Werken Pfaff Amîs und Dil Ulenspiegel hervorgehoben. Der Text beleuchtet insbesondere die vierte Historie aus dem Pfaff Amîs, die auch im Ulenspiegel auftaucht, und analysiert die unterschiedlichen Eigenschaften der beiden Schwankhelden.
Schlüsselwörter
Die zentralen Schlüsselwörter und Themenbereiche des Textes umfassen: Volksbuch, Schwankliteratur, Till Eulenspiegel, Pfaff Amîs, Humor, Satire, Gesellschaftskritik, Figurencharakterisierung, historische Figuren, literarische Tradition.
- Quote paper
- Julia Frey (Author), 2011, Till Eulenspiegel in der Tradition der Schwankliteratur, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/181519