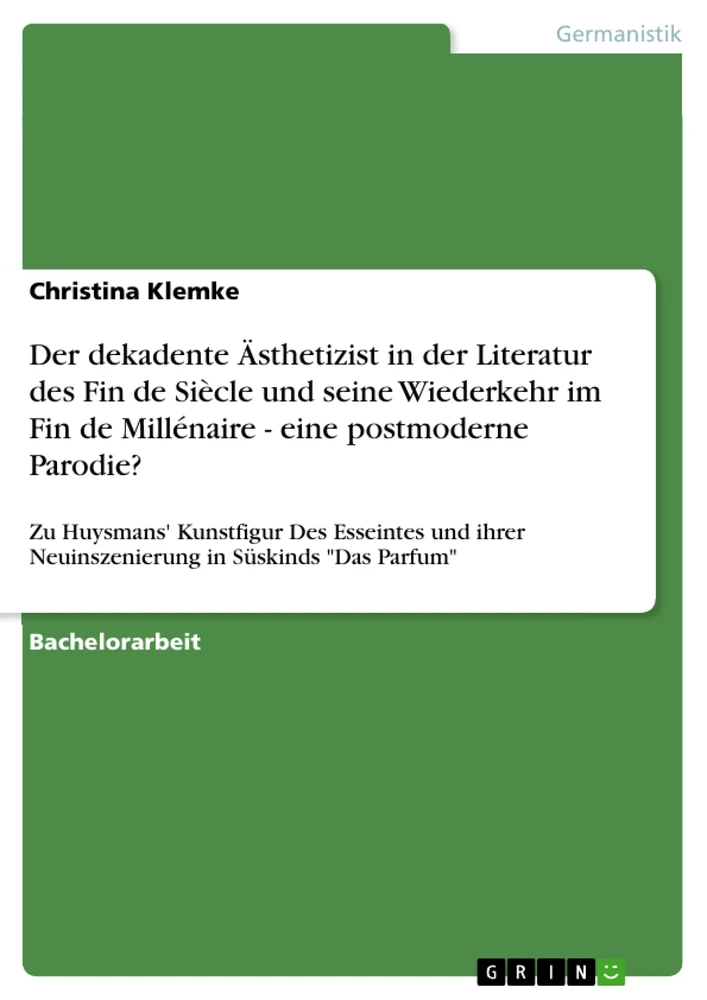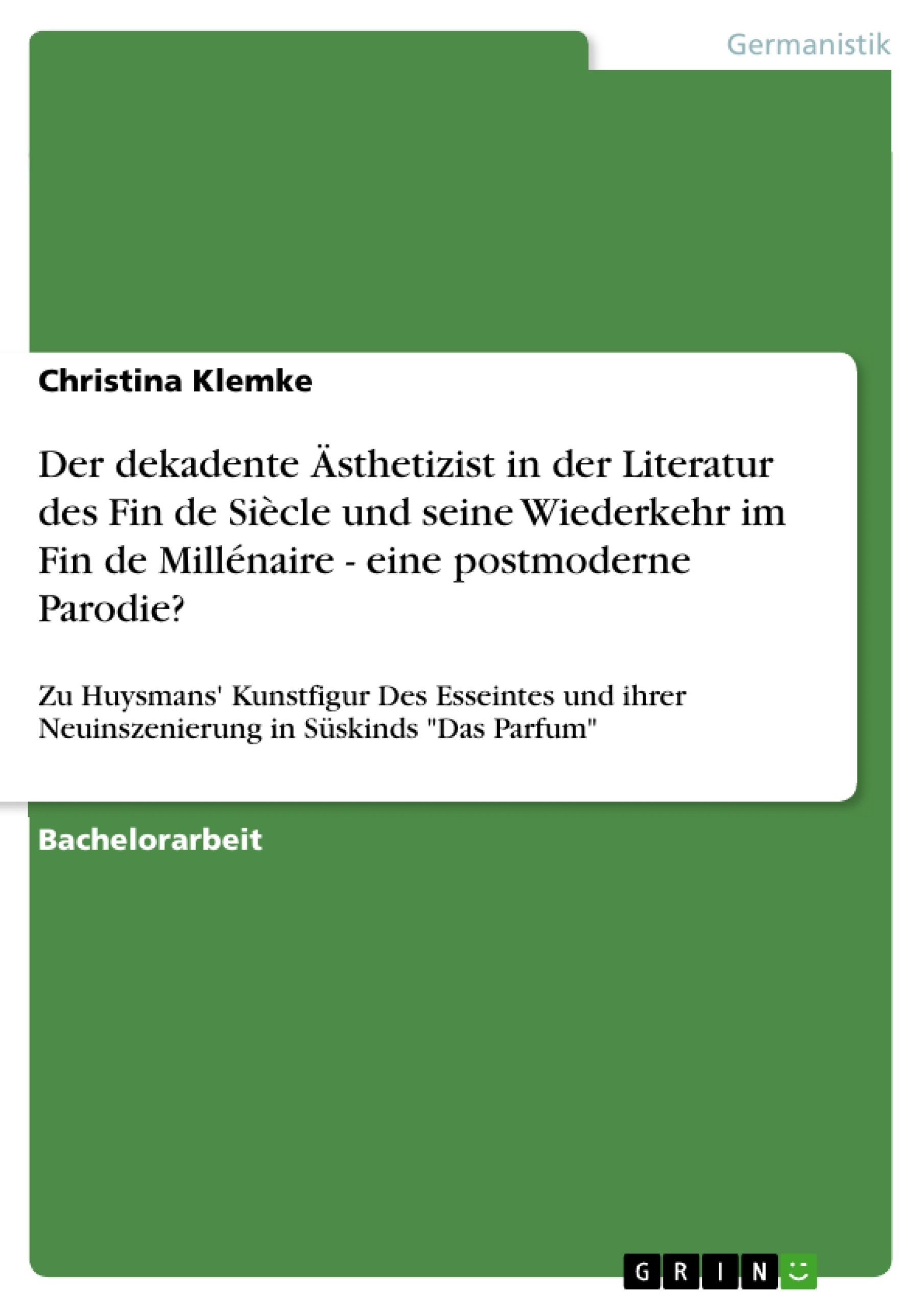Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, festzustellen, ob âDas Parfumâ damit tatsächlich als kritische Infragestellung der modernen Prämissen zu verstehen ist oder ob Süskind möglicher-weise ein völlig anderes Ziel verfolgt haben könnte. Es soll analysiert werden, inwieweit der Roman den Motiven und MaÃgaben der postmodernen Literatur entspricht und ob seine offenkundigen Anspielungen auf Huysmans. âBibel der Décadenceâ, insbesondere der Rück-griff auf den dekadenten Ãsthetizismus, als parodistische Wiederaufnahme vergangener, moderner Prämissen gedeutet werden können â ein Darstellungsverfahren, das wie zuvor er-wähnt als charakteristisch für den postmodernen Roman bezeichnet wird.31 Der Fokus der textanalytischen Untersuchung wird auf die beiden Kunstfiguren Des Esseintes und Grenouille gerichtet, die gegenübergestellt und deren zentrale Gemeinsamkeiten auf-gezeigt werden sollen. Das Hauptaugenmerk wird dabei auf die literarische Darstellung des Ãsthetizismus gelegt, da dieser für beide Figurenkonzeptionen eine entscheidende Rolle spielt und zudem eine auffällige Verbindungslinie zwischen Huysmans
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Décadence des Fin de Siècle – eine literarische Strömung zwischen Endzeitstimmung und Zukunftseuphorie
- Zeitgeschichtlicher Hintergrund
- Literarische Merkmale und Motive
- Degeneration und Verfall
- L'art pour l'art – Ästhetizismus als neuer Lebenskult
- Der isolierte „Dandy“ – Dekadente Ästhetizisten am Rande der Gesellschaft
- Das Zeitalter der Postmoderne
- Zeitgeschichtliche Einordnung
- Die Literatur der Postmoderne - Zentrale Kennzeichen und Motive
- „Das Parfum“ und die Spuren des Ästhetizismus Süskinds Grenouille und Huysmans' Des Esseintes im Vergleich
- Die dekadenten Ästhetizisten im „flüchtigen Reich der Gerüche“
- Die isolierten Sonderlinge zwischen Narzissmus und Lebenskrise
- Der dekadente Ästhetizist im Fin de Millénaire – eine postmoderne Parodie?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die literarische Strömung der Décadence im Fin de Siècle und deren mögliche Reflexion in der postmodernen Literatur am Beispiel von Patrick Süskinds „Das Parfum“. Ziel ist es, Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den beiden Epochen herauszuarbeiten und die Rolle des dekadenten Ästhetizisten in beiden Kontexten zu analysieren.
- Die Décadence als literarische Strömung des Fin de Siècle
- Der Ästhetizismus als zentraler Aspekt der Décadence
- Der Vergleich zwischen Huysmans' Des Esseintes und Süskinds Grenouille
- Die Postmoderne als Reaktion auf die Moderne
- Ironie und Parodie als Stilmittel der postmodernen Literatur
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung stellt den Kontext des Fin de Siècle dar, eine Zeit des ambivalenten Gesellschaftsbewusstseins geprägt von Innovationsstreben und Zukunftseuphorie einerseits sowie Weltschmerz und Endzeitstimmung andererseits. Sie beschreibt die Epoche als einen genuinen Teil der frühen Moderne und hebt die Diskrepanz zwischen Kritik an den Modernisierungsprozessen und dem Wunsch nach Lebenserneuerung hervor, welche sich in der Literatur der Jahrhundertwende spiegelt. Die Décadence wird als eine prägnante literarische Strömung dieser Zeit eingeführt, die sich als antibürgerliche Auflehnung gegen die neue Nützlichkeitsmoral versteht.
Die Décadence des Fin de Siècle – eine literarische Strömung zwischen Endzeitstimmung und Zukunftseuphorie: Dieses Kapitel analysiert die Décadence als antibürgerliche Bewegung, die sich von den neuen zivilisatorischen Idealen abwendet und Untergangs- und Verfallsphantasien thematisiert. Es wird die Umwertung des Begriffs "Décadence" von einer abschätzigen zu einer positiven Selbstbezeichnung moderner Dichter beschrieben und die ambivalente Darstellung von Krankheit und Verfall in der Literatur der Décadence beleuchtet, wobei der kranke Geist als Quelle einzigartiger Kreativität gesehen wird. Der Ästhetizismus wird als neuer Lebenskult eingeführt, der der Kunst den höchsten Wert beimisst und sich gegen die dominierende Nützlichkeitsmoral auflehnt.
Das Zeitalter der Postmoderne: Dieses Kapitel beschreibt die Postmoderne als eine Epoche, die in enger Beziehung zur Moderne steht und auf diese in gewisser Weise reagiert. Es charakterisiert die Literatur der Postmoderne als Radikalisierung des Modernismus oder als „postmoderne Antwort auf die Moderne“, wobei die Ideen und Konzeptionen der Moderne in Frage gestellt und in radikalisierter Form neu aufgegriffen werden. Ironie und Parodie werden als zentrale Merkmale der postmodernen Literatur hervorgehoben. Die Schwierigkeiten bei der genauen Definition und Datierung der Postmoderne werden ebenfalls angesprochen.
Der dekadente Ästhetizist im Fin de Millénaire – eine postmoderne Parodie?: Dieses Kapitel setzt sich mit der Frage auseinander, ob Patrick Süskinds „Das Parfum“ als postmoderne Antwort auf die Moderne und insbesondere auf die Décadence des Fin de Siècle zu verstehen ist. Es vergleicht die Protagonisten Huysmans' "Gegen den Strich" und Süskinds "Das Parfum" und untersucht die expliziten Ähnlichkeiten. Die Frage, ob Süskind das Motiv des Ästhetizismus bewusst wieder aufgreift, um eine bestimmte Intention zu verfolgen, wird diskutiert und die charakteristischen Merkmale des Gesellschaftsbewusstseins der Postmoderne werden thematisiert.
Schlüsselwörter
Décadence, Fin de Siècle, Ästhetizismus, Postmoderne, Patrick Süskind, Das Parfum, Joris-Karl Huysmans, Gegen den Strich, Ironie, Parodie, Moderne, Modernisierung, Verfall, Untergang, Lebenskrise, Narzissmus.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Analyse der Décadence und ihrer Reflexion in der Postmoderne
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die literarische Strömung der Décadence im Fin de Siècle und deren mögliche Reflexion in der postmodernen Literatur. Im Mittelpunkt steht ein Vergleich zwischen der Décadence und der Postmoderne, insbesondere anhand des Romans „Das Parfum“ von Patrick Süskind.
Welche Epochen werden untersucht?
Die Arbeit untersucht die Epoche des Fin de Siècle (Ende des 19. Jahrhunderts) mit dem Fokus auf die literarische Strömung der Décadence und die Postmoderne. Der Vergleich dieser beiden Epochen bildet den Kern der Analyse.
Welche zentralen Themen werden behandelt?
Zentrale Themen sind die Décadence als literarische Strömung, der Ästhetizismus als wichtiger Aspekt der Décadence, ein Vergleich zwischen dem dekadenten Ästhetizisten Des Esseintes (Huysmans) und Grenouille (Süskind), die Postmoderne als Reaktion auf die Moderne, sowie Ironie und Parodie als Stilmittel der postmodernen Literatur.
Welche Autoren und Werke werden analysiert?
Die Arbeit analysiert vor allem das Werk „Das Parfum“ von Patrick Süskind und vergleicht dessen Protagonisten mit dem dekadenten Ästhetizisten Des Esseintes aus Joris-Karl Huysmans' Roman „Gegen den Strich“. Die Analyse dient dazu, Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den beiden Epochen und ihren jeweiligen literarischen Ausprägungen aufzuzeigen.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Ziel der Arbeit ist es, Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen der Décadence des Fin de Siècle und der postmodernen Literatur herauszuarbeiten und die Rolle des dekadenten Ästhetizisten in beiden Kontexten zu analysieren. Es wird untersucht, ob „Das Parfum“ als postmoderne Parodie auf die Décadence interpretiert werden kann.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zur Décadence des Fin de Siècle, ein Kapitel zum Zeitalter der Postmoderne und ein Kapitel, welches den dekadenten Ästhetizisten im Kontext der Postmoderne als mögliche Parodie untersucht. Zusätzlich enthält die Arbeit ein Inhaltsverzeichnis, eine Zusammenfassung der Kapitel und eine Liste der Schlüsselwörter.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind Décadence, Fin de Siècle, Ästhetizismus, Postmoderne, Patrick Süskind, Das Parfum, Joris-Karl Huysmans, Gegen den Strich, Ironie, Parodie, Moderne, Modernisierung, Verfall, Untergang, Lebenskrise und Narzissmus.
Welche Aspekte der Décadence werden im Detail untersucht?
Die Analyse der Décadence umfasst den zeitgeschichtlichen Hintergrund, literarische Merkmale und Motive wie Degeneration und Verfall, L'art pour l'art und den isolierten Dandy als dekadenten Ästhetizisten am Rande der Gesellschaft.
Wie wird die Postmoderne charakterisiert?
Die Postmoderne wird als Epoche beschrieben, die in enger Beziehung zur Moderne steht und auf diese reagiert. Sie wird als Radikalisierung des Modernismus oder als „postmoderne Antwort auf die Moderne“ charakterisiert, wobei die Ideen und Konzeptionen der Moderne in Frage gestellt und neu aufgegriffen werden. Ironie und Parodie werden als zentrale Merkmale hervorgehoben.
Wie wird der Vergleich zwischen Süskinds Grenouille und Huysmans' Des Esseintes durchgeführt?
Der Vergleich zwischen Grenouille und Des Esseintes konzentriert sich auf die expliziten Ähnlichkeiten der beiden Protagonisten als dekadente Ästhetizisten. Die Analyse untersucht, ob Süskind das Motiv des Ästhetizismus bewusst wieder aufgreift und welche Intention dahinterstehen könnte.
- Quote paper
- Christina Klemke (Author), 2011, Der dekadente Ästhetizist in der Literatur des Fin de Siècle und seine Wiederkehr im Fin de Millénaire - eine postmoderne Parodie?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/181549