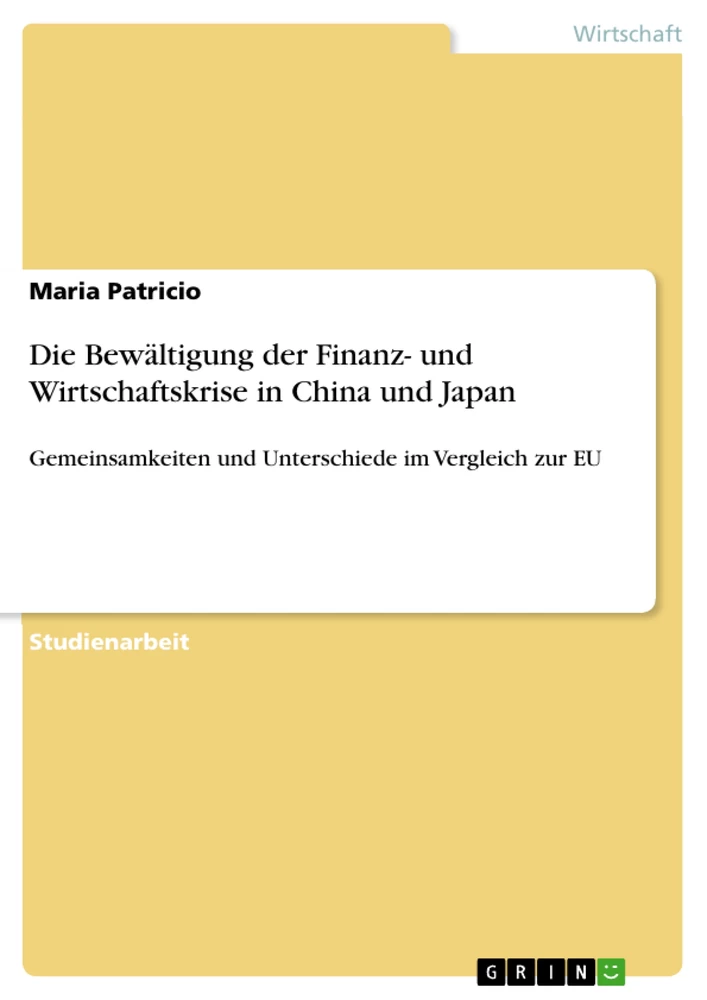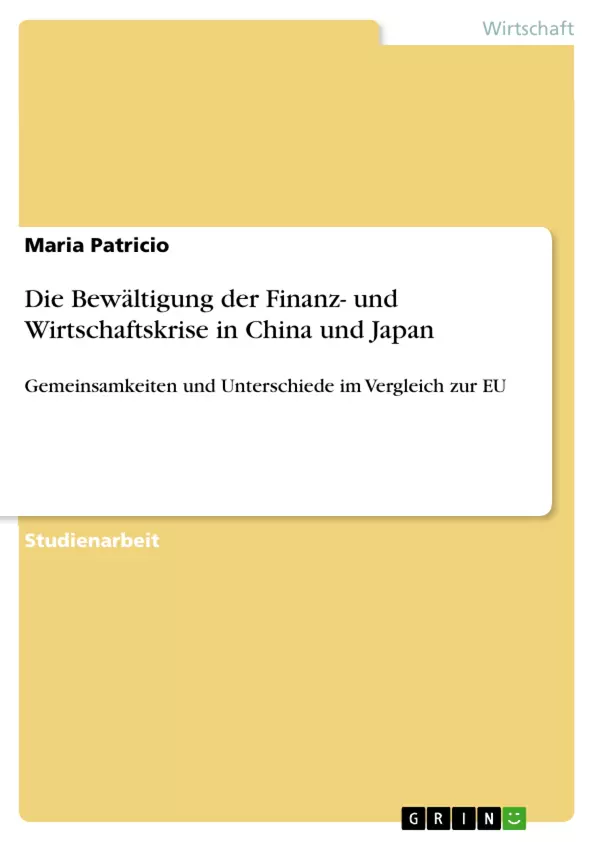Mit der Subprime-Hypothekenkrise in den USA im Sommer 2007 nahm die globale Finanzkrise
ihren Lauf. Der US-Immobilienmarkt ist durch drastische Wertverluste der
Subprime-Hypothekenverbriefungen in die Krise geraten. Seit Anfang 2008 verbreitete
sich diese Krise auch auf andere Finanzinstrumente, sodass die USA in diesem Jahr
noch in eine tiefe Rezession gezogen wurde. Die Finanzkrise fand ihren Höhepunkt mit
der Insolvenzbekanntgabe der US-Investmentbank Lehman Brothers Mitte September
2008. Dadurch schwappte die Finanzkrise seit Ende Oktober 2008 zunehmend auch
auf die reale Wirtschaft über. Ursache hierfür waren u.a. die Banken, die ihre Kreditkonditionen
verschärften, um große Teile der entstandenen Wertverluste tragen zu
können.1
Länder wie China und Japan erreichte die US-Krise im internationalen Vergleich eher
spät. Auf Grund der vorangegangenen Asienkrise hatten beide Länder jedoch das Bewusstsein
für die möglichen Schäden. Die Europäische Union hingegen unterschätzte
anfangs die Auswirkungen und wurde von dem Ausbruch der Krise im europäischen
Raum überrascht.
Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist es die Länder, China und Japan, im Hinblick auf die
Bewältigung der Finanz- und Wirtschaftskrise, näher zu beleuchten. Dabei werden bereits
ergriffene Maßnahmen, um die wirtschaftliche Krise zu bekämpfen, aufgezeigt.
Durch die enorme wirtschaftliche Konnektivität Chinas und Japans mit den Vereinigten
Staaten wird es zu klären sein, wie tief beide Staaten durch die US-Krise getroffen worden
sind bzw. wie es evtl. diesen Ländern, auf Grund ihrer wirtschaftlichen Machtposition,
gelungen ist die Krise zu überwinden.
Die geplatzte Blase auf den Vermögensmärkten erreichte auch die europäischen Märkte.
Daher werden sämtliche Reaktionen, von Regierungen und Zentralbanken Chinas
und Japans, mit denen der Europäischen Union auf Gemeinsamkeiten bzw. Unterschiede
verglichen. Außerdem werden die verheerenden Auswirkungen der USImmobilienkrise
auf die reale Wirtschaft von China, Japan und der Europäischen Union
betrachtet.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Kapitel 1: Einführung
- Finanzkrisen als Systemkrisen
- Notwendigkeit eines Staatseingriffes
- Ursachen der letzten großen Krise
- Krisenbetroffenheit von Ländern
- Kapitel 2: Von der Finanzkrise zur Wirtschaftskrise
- Ansteckungsgefahren durch die Hypothekenkrise
- Japan und China vor dem Ausbruch der Wirtschaftskrise
- Die japanische Erfahrung mit Krisen
- China in der Krise
- Krisenzeiten in der EU
- Kapitel 3: Bewältigung der globalen Krise
- Das chinesische Krisenmanagement
- Frühzeitiges Eingreifen
- Strategie der chinesischen Regierung
- Die Reaktionen in Japan auf die Krise
- Konkrete Planung
- Regierungswechsel im Jahre 2009
- Yen-Aufwertung als zusätzliche Belastung
- Ökonomische und politische Herausforderungen der EU
- Das chinesische Krisenmanagement
- Kapitel 4: Vergleichende Darstellung
- Effektivität der Konjunkturprogramme
- Wirksames Krisenmanagement in China
- Exkurs: Chinas Währungspolitik
- Die EU unter Druck
- Ausblick
- Effektivität der Konjunkturprogramme
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht die Bewältigung der Finanz- und Wirtschaftskrise in China und Japan im Vergleich zur EU. Ziel ist es, Gemeinsamkeiten und Unterschiede in den Krisenreaktionen und -bewältigungsstrategien der drei Wirtschaftsräume zu identifizieren und zu analysieren. Die Arbeit beleuchtet dabei die jeweiligen staatlichen Interventionen und deren Auswirkungen auf die Wirtschaft.
- Vergleich der Krisenbewältigungsstrategien von China, Japan und der EU
- Analyse der staatlichen Interventionen und deren Effektivität
- Untersuchung der spezifischen Herausforderungen in jedem Wirtschaftsraum
- Identifizierung von Gemeinsamkeiten und Unterschieden in den Krisenreaktionen
- Ausblick auf zukünftige Herausforderungen
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Finanz- und Wirtschaftskrise ein und skizziert den Forschungsansatz der Arbeit. Sie begründet die Relevanz des Vergleichs zwischen China, Japan und der EU und beschreibt den Aufbau der Arbeit.
Kapitel 1: Einführung: Dieses Kapitel definiert Finanzkrisen als Systemkrisen und betont die Notwendigkeit staatlicher Interventionen. Es analysiert die Ursachen der letzten großen Finanzkrise und untersucht die unterschiedliche Krisenbetroffenheit verschiedener Länder.
Kapitel 2: Von der Finanzkrise zur Wirtschaftskrise: Dieses Kapitel beschreibt den Übergang von der Finanz- zur Wirtschaftskrise und untersucht die Ansteckungsgefahren durch die Hypothekenkrise. Es analysiert die Situation Japans und Chinas vor dem Ausbruch der Wirtschaftskrise, beleuchtet deren jeweilige Erfahrungen mit früheren Krisen und untersucht die Auswirkungen der Krise auf die EU.
Kapitel 3: Bewältigung der globalen Krise: In diesem Kapitel werden die Krisenmanagementstrategien Chinas und Japans im Detail analysiert. Es werden die frühzeitigen Interventionen Chinas und die konkrete Planung Japans untersucht, ebenso wie der Regierungswechsel in Japan 2009 und die zusätzliche Belastung durch die Yen-Aufwertung. Schließlich werden die ökonomischen und politischen Herausforderungen der EU im Umgang mit der Krise beleuchtet.
Kapitel 4: Vergleichende Darstellung: Dieses Kapitel vergleicht die Effektivität der Konjunkturprogramme in China, Japan und der EU. Es hebt das wirksame Krisenmanagement Chinas hervor, analysiert dessen Währungspolitik und untersucht den Druck auf die EU. Das Kapitel schließt mit einem Ausblick auf zukünftige Entwicklungen.
Schlüsselwörter
Finanzkrise, Wirtschaftskrise, China, Japan, EU, Krisenmanagement, Staatseingriffe, Konjunkturprogramme, Währungspolitik, Vergleichende Analyse, Wirtschaftspolitik.
Häufig gestellte Fragen zur Seminararbeit: Bewältigung der Finanz- und Wirtschaftskrise in China, Japan und der EU
Was ist der Gegenstand dieser Seminararbeit?
Die Seminararbeit untersucht die Bewältigung der Finanz- und Wirtschaftskrise in China, Japan und der EU im Vergleich. Sie analysiert die Krisenreaktionen und -bewältigungsstrategien dieser drei Wirtschaftsräume, insbesondere die staatlichen Interventionen und deren Auswirkungen.
Welche Ziele verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, Gemeinsamkeiten und Unterschiede in den Krisenreaktionen und -bewältigungsstrategien von China, Japan und der EU zu identifizieren und zu analysieren. Sie untersucht die Effektivität der staatlichen Interventionen und beleuchtet die spezifischen Herausforderungen in jedem Wirtschaftsraum.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die Ursachen der Finanzkrise, den Übergang von der Finanz- zur Wirtschaftskrise, die Krisenmanagementstrategien von China, Japan und der EU (inkl. konkreter Maßnahmen und deren Wirksamkeit), einen Vergleich der Konjunkturprogramme und einen Ausblick auf zukünftige Herausforderungen.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, vier Kapitel und ein Fazit. Kapitel 1 bietet eine Einführung in die Thematik, Kapitel 2 analysiert den Übergang von der Finanz- zur Wirtschaftskrise, Kapitel 3 untersucht die Krisenbewältigungsstrategien der drei Wirtschaftsräume im Detail, und Kapitel 4 bietet einen Vergleich der Konjunkturprogramme und einen Ausblick. Die Einleitung und das Fazit fassen die Kernaussagen zusammen.
Welche Länder werden im Vergleich betrachtet?
Die Arbeit vergleicht die Krisenbewältigungsstrategien von China, Japan und der Europäischen Union (EU).
Welche Aspekte der Krisenbewältigung werden analysiert?
Die Analyse umfasst die staatlichen Interventionen, die Effektivität der Konjunkturprogramme, die jeweiligen Währungspolitiken und die spezifischen ökonomischen und politischen Herausforderungen in jedem der drei Wirtschaftsräume.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Finanzkrise, Wirtschaftskrise, China, Japan, EU, Krisenmanagement, Staatseingriffe, Konjunkturprogramme, Währungspolitik, Vergleichende Analyse, Wirtschaftspolitik.
Welche Kapitel gibt es und worum geht es in jedem Kapitel?
Kapitel 1 (Einführung): Definition von Finanzkrisen, Notwendigkeit staatlicher Interventionen, Ursachen der letzten großen Krise, Krisenbetroffenheit verschiedener Länder. Kapitel 2 (Von der Finanzkrise zur Wirtschaftskrise): Ansteckungsgefahren durch die Hypothekenkrise, Situation in Japan und China vor dem Ausbruch, Auswirkungen auf die EU. Kapitel 3 (Bewältigung der globalen Krise): Detaillierte Analyse des Krisenmanagements in China und Japan, ökonomische und politische Herausforderungen der EU. Kapitel 4 (Vergleichende Darstellung): Vergleich der Effektivität der Konjunkturprogramme, Analyse der Währungspolitik Chinas, Ausblick auf zukünftige Entwicklungen.
- Quote paper
- LL. B. Maria Patricio (Author), 2011, Die Bewältigung der Finanz- und Wirtschaftskrise in China und Japan, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/181662