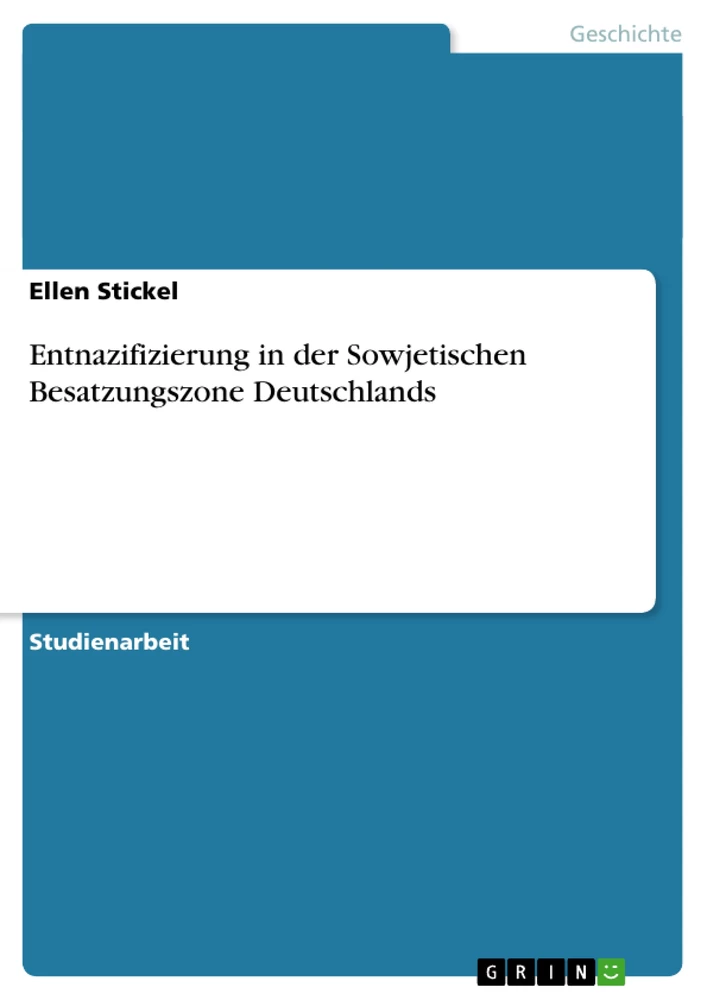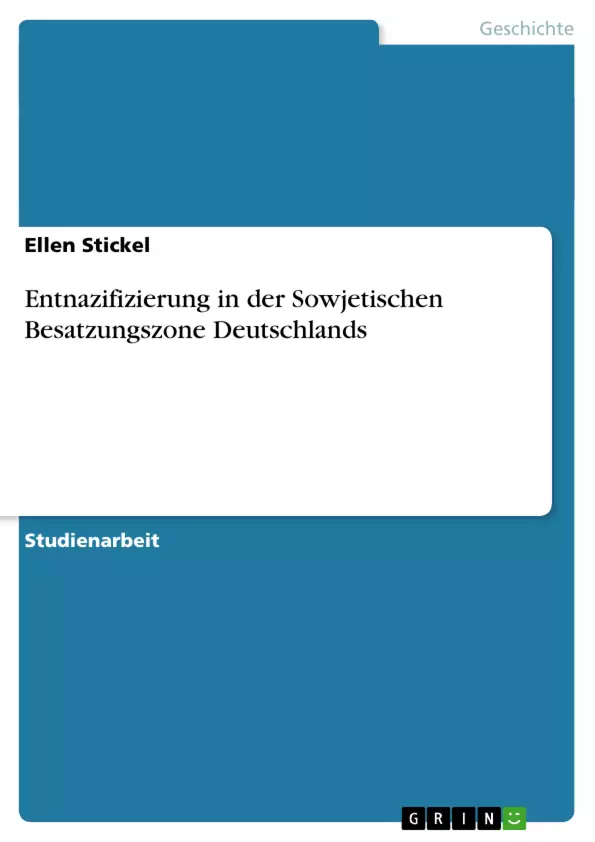Mit dem Ende des Zweiten Weltkrieges standen die vier Besatzungsmächte in Deutschland vor einer schwierigen Aufgabe: Ein ganzes Volk hatte sich von der nationalsozialistischen Progaganda beeinflussen lassen. Die Verantwortlichen des NS-Regimes wurden schnell zu Rechenschaft gezogen, doch was sollte mit den Hunderttausenden von begeisterten Anhängern geschehen und vor allem was mit der noch viel größeren Zahl von Mitläufern? Die Unterscheidung in nominelle und aktivistische Parteigenossen wurde vor allem in der Sowjetischen Besatzungszone zu einem entscheidenden Kriterium der Entnazifizierung. Doch in wieweit konnte hierbei überhaupt eine zutreffende Trennung vorgenommen werden? Welche Kriterien machten aus einem Parteimitglied einen aktiven Nazi? Und wer entschied darüber? Die oftmals unklare Differenzierung stellte die Verwantwortlichen in der SBZ vor schwere Probleme, vor allem, als es darum ging, sie der Bevölkerung plausibel zu machen. Die Forschung ist sich bis heute auch nicht einig darüber, ob die Entnazifizierung schon von Beginn an nur ein Mittel war, die Gesellschaft in der Sowjetischen Besatzungszone umzustrukturieren und einen Elitentausch einzuleiten, der die spätere kommunistische Hegemonie begründete. Die durch die Wende hinzugekommenen Quellen lassen für diesen Bereich der deutschen Geschichte ganz neue Schlüsse und Betrachtungsweisen zu. Dies hat sich in einer Vielzahl neuer Forschungsarbeiten niedergeschlagen, die nun mit DDR-Veröffentlichungen verglichen werden können.
Anhand eines chronologischen Abrisses der einzelnen Entnazifizierungswellen in der SBZ soll in dieser Arbeit erörtert werden, inwieweit die zu Kriegsende in die Entnazifizierung gesetzten Erwartungen erreicht wurden. Durch die Untersuchung der Säuberungsschwerpunkte soll außerdem dargestellt werden, in welchem Umfang die Entnazifizierung die antifaschistisch-demokratische Umwälzung der Gesellschaft vorangetrieben hat und welche Auswirkungen dies auf die Bevölkerung der späteren DDR hatte. Denn das Ende der Entnazifizierung bedeutete in der Deutschen Demokratischen Republik nicht das Ende der politischen Säuberungen. Was waren also die wirklichen Ziele der Entnazifizierung?
Inhaltsverzeichnis
- A Einleitung
- B Der Zusammenbruch und der Aufbau neuer Strukturen
- 1. Die Beschlüsse der Siegermächte
- 2. Spontane Entnazifizierung
- 3. Erste gesetzliche Grundlagen
- II. Frühe Bemühungen um gesellschaftliche Wiedereingliederung
- 1. Die Parteien als Weg zur schnellen Rehabilitierung
- 2. Das Problem der jugendlichen Nazianhänger
- III. Ende 1946: Die verspätete Verschärfung der Entnazifizierung durch die
Kontrollratsdirektive Nr. 24
- 1. Gesamtdeutsche Richtlinien zum Umgang mit ehemaligen Nazis
- 2. Die Entnazifizierungskommissionen
- IV. „Die Zeit ist reif“ – der SMAD-Befehl Nr. 201 (16. August 1947)
und die Kontrollratsdirektive Nr. 38
- 1. Hintergründe und Grundlagen
- 2. Die Durchführung
- V. Das offizielle Ende der Säuberungen – der SMAD-Befehl Nr. 35
(26. Februar 1948)
- 1. Schwerpunkte der Entnazifizierung
- a. Verwaltung
- b. Justiz
- c. Bildungswesen
- 1. Schwerpunkte der Entnazifizierung
- VI. Antifaschismus und gesellschaftliche Umwälzung
- C Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Entnazifizierung in der Sowjetischen Besatzungszone Deutschlands nach dem Zweiten Weltkrieg. Sie untersucht, inwieweit die im Zuge der Entnazifizierung gesetzten Erwartungen erreicht wurden und in welchem Umfang diese die antifaschistisch-demokratische Umwälzung der Gesellschaft vorangetrieben hat.
- Die Beschlüsse der Siegermächte und die Implementierung der Entnazifizierung
- Die Herausforderungen und Schwierigkeiten der Entnazifizierung im Kontext der Spaltung Deutschlands
- Die Rolle der Entnazifizierung in der politischen und gesellschaftlichen Umgestaltung der SBZ
- Die Folgen der Entnazifizierung für die Bevölkerung der späteren DDR
- Die Entwicklung der Entnazifizierungspolitik von der Spontaneität bis hin zu offiziellen Säuberungen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung gibt einen Überblick über die Herausforderungen, die die Entnazifizierung nach dem Zweiten Weltkrieg mit sich brachte. Sie stellt die Kontroversen um die Unterscheidung zwischen nominellen und aktiven Parteigenossen sowie die Frage nach der Gerechtigkeit und dem tatsächlichen Ziel der Entnazifizierung in den Vordergrund.
Kapitel I beleuchtet den Zusammenbruch des Nazi-Regimes und den Aufbau neuer Strukturen. Hierbei werden die Beschlüsse der Siegermächte auf der Potsdamer Konferenz und die Umsetzung der Entnazifizierung durch das Verbot der NSDAP und ihrer Gliederungen, sowie die Entfernung von Funktionären und aktiven Nazis aus öffentlichen Ämtern näher betrachtet.
Kapitel II befasst sich mit den frühen Bemühungen um die gesellschaftliche Wiedereingliederung in der SBZ. Die Rolle der Parteien als Instrument der schnellen Rehabilitierung und die Schwierigkeiten im Umgang mit jugendlichen Nazianhängern werden beleuchtet.
Kapitel III behandelt die Verschärfung der Entnazifizierung durch die Kontrollratsdirektive Nr. 24 im Jahr 1946. Die Einführung von Gesamtdeutschen Richtlinien und die Bildung von Entnazifizierungskommissionen werden analysiert.
Kapitel IV widmet sich dem SMAD-Befehl Nr. 201 und der Kontrollratsdirektive Nr. 38, welche die Entnazifizierung im Jahr 1947 weiter verschärften. Die Hintergründe und Grundlagen dieser Maßnahmen sowie die praktische Umsetzung werden in diesem Kapitel untersucht.
Kapitel V beschreibt das offizielle Ende der Säuberungen im Jahr 1948 und beleuchtet die Schwerpunkte der Entnazifizierung in den Bereichen Verwaltung, Justiz und Bildungswesen.
Kapitel VI untersucht den Zusammenhang zwischen der Entnazifizierung und dem antifaschistischen Umbruch der Gesellschaft. Es werden die Auswirkungen der Säuberungen auf die Bevölkerung der späteren DDR beleuchtet.
Schlüsselwörter
Entnazifizierung, Sowjetische Besatzungszone, Deutsche Demokratische Republik, antifaschistische Umwälzung, politische Säuberungen, Potsdamer Abkommen, SMAD-Befehle, Kontrollratsdirektiven, Parteien, Rehabilitierung, jugendliche Nazianhänger, Verwaltung, Justiz, Bildungswesen, Gesellschaft, Bevölkerung, DDR-Geschichte.
Häufig gestellte Fragen
Was war die größte Herausforderung der Entnazifizierung in der SBZ?
Die größte Schwierigkeit lag in der Unterscheidung zwischen nominellen Parteimitgliedern (Mitläufern) und aktiven Nationalsozialisten (Aktivisten) sowie der Plausibilisierung dieser Trennung gegenüber der Bevölkerung.
Welche Rolle spielten die SMAD-Befehle bei der Entnazifizierung?
Besonders die SMAD-Befehle Nr. 201 und Nr. 35 waren entscheidend für die Verschärfung bzw. das offizielle Ende der Säuberungen in den Bereichen Verwaltung, Justiz und Bildungswesen.
Diente die Entnazifizierung auch der Umstrukturierung der Gesellschaft?
Ja, die Forschung diskutiert, ob die Entnazifizierung als Mittel für einen Elitentausch genutzt wurde, um die spätere kommunistische Hegemonie in der DDR vorzubereiten.
Wie wurden jugendliche Nazianhänger in der SBZ behandelt?
Die Arbeit untersucht die spezifischen Bemühungen um die gesellschaftliche Wiedereingliederung und Rehabilitation von Jugendlichen, die vom NS-Regime beeinflusst waren.
Was bedeutete das Ende der Entnazifizierung für die spätere DDR?
Das offizielle Ende der Entnazifizierung 1948 bedeutete in der DDR nicht das Ende politischer Säuberungen, sondern war Teil einer umfassenderen antifaschistisch-demokratischen Umwälzung.
- Quote paper
- M.A. Ellen Stickel (Author), 2002, Entnazifizierung in der sowjetischen Besatzungszone Deutschlands, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/18172