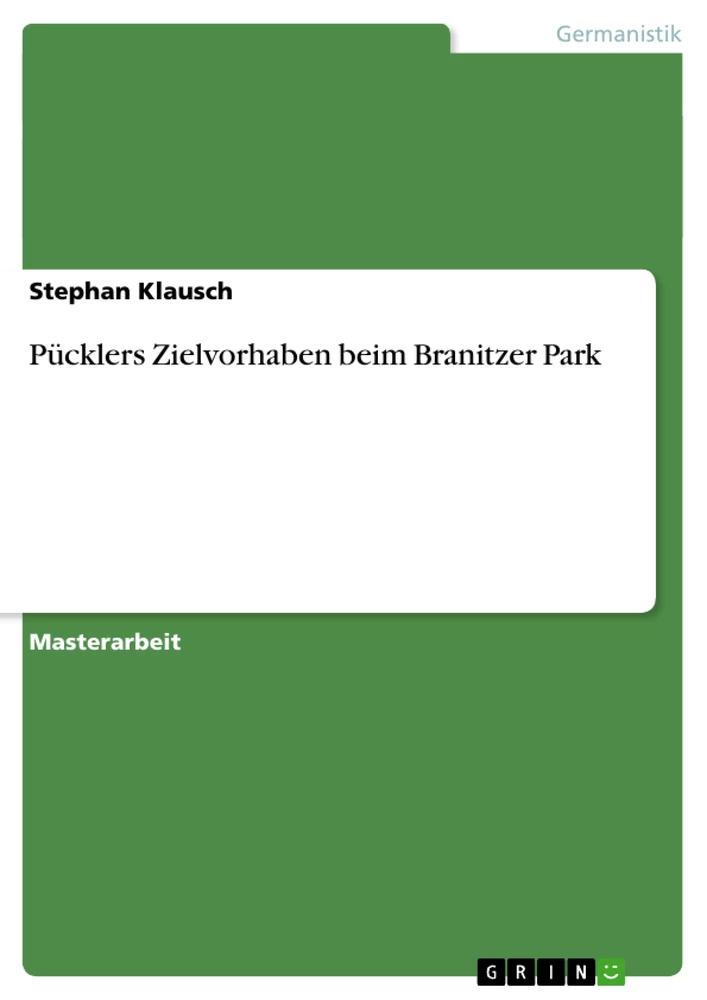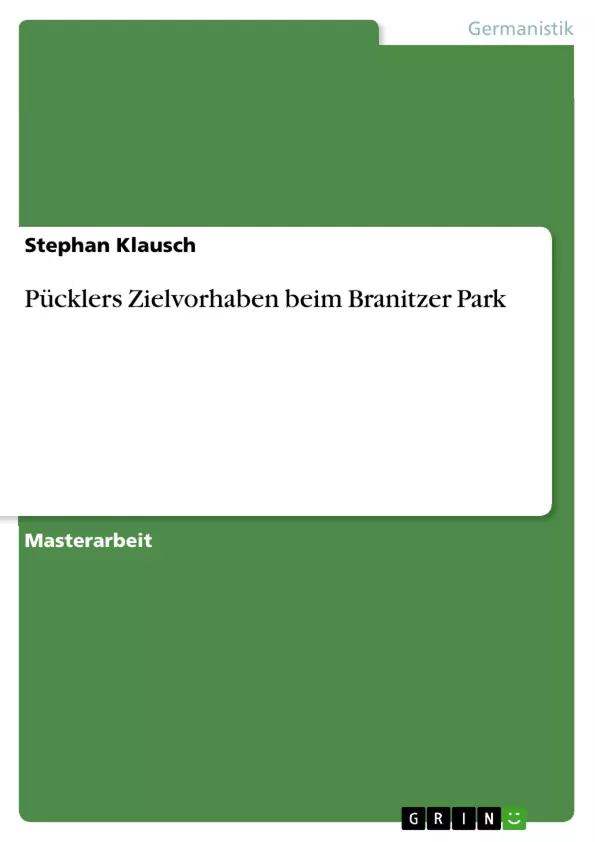Jeden Tag gehen Dinge verloren, materielle, wie die Natur, immaterielle wie Kontakte oder die Zeit.
Gelegentlich treten sie wieder in Erscheinung, zum Teil bleiben sie gänzlich vermisst. Eine dritte Art erscheint verändert, und der Betrachter kann sich der Sehnsucht nach dem Originalen, dem Ursprünglichen nicht erwehren.
Insbesondere in der Lausitz, der Gegend, in der Pückler nachhaltig wirkte, wird dem Betrachter angesichts der Tagebaue Belehrung zu Teil, wie Landschaften verschwinden, oder unkenntlich gemacht werden können.
Die Spannung hinsichtlich Pücklers Park in Branitz wurzelt in dem Wissen, dass er jedem Werk eine Hauptidee inkludiert.
Im Gegensatz zum Muskauer Park, dem Gesellschaftsbild, verschließt sich das Alterswerk des Fürsten in Branitz dem gewöhnlichen Spaziergänger einerseits, sorgt für redundante, durchaus konträre Deutungshypothesen unter den Wissenschaftlern andererseits.
Beim Gang durch den Park stellt sich eine nicht gekannte Persönlichkeit der Arrangements der Natur anheim, wirkt das Grün nicht ausschließlich grün, glaubt man, Assoziationen zu haben und will diese auch bestätigt wissen.
Um eine fundierte Aussage über Pücklers Zielvorhaben in Branitz zu treffen, versucht der Verfasser im ersten Teil, die Begriffe Park und Text aufeinander abzustimmen.
Hieraus folgt ein duales Konzept dieser Master-Arbeit. Einerseits soll die enge Beziehung zwischen Autor und Werk, beziehungsweise reisender und schriftstellerischer Landschaftsarchitekt und Parkwerk, hergestellt werden, andererseits ist beabsichtigt, auf Grundlage der Erkenntnisse ein mögliches Konzept für den Gang durch den Park zu entwickeln.
Pückler vermochte nun seinen letzten Park in Branitz derart zu planen, dass er persönliche Elemente birgt, ihn und sein Leben erfahrbar macht und dennoch unaufdringlich wirkt.
Er kann als Selbstdarstellung im wörtlichen Sinne verstanden werden, als Reminiszenz für Pückler an sein Leben.
Diese auf den Produzenten, beziehungsweise „Autor“ fokussierte Lesart gilt es zu überprüfen.
Es ist gemeinhin Konsens in der Literaturtheorie, bei einer Interpretation entweder den Fokus primär auf den Autor, auf textimmanente Elemente oder auf die Position des Lesers zu richten. In der vorliegenden Arbeit ist beabsichtigt, das Wechselverhältnis von Autor und Werk der Literatur auf den Künstler und den entstandenen Park zu transferieren, um letztlich eine substanziiertere Aussage über Pücklers Intention äußern zu können.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Begründung der Themenwahl und Zielstellung
- Vorgehensweise und Begründung
- Der Park als Text
- Eine Definitionsbestimmung der Begriffe „Text“ und „Park“
- Die Entwicklung von Landschaftsgärten und Parks in den Epochen
- Eine Einordnung von Fürst Hermann von Pückler- Muskau in die Linie bedeutender Landschaftsarchitekten des englischen Stils
- Der Stil Pücklers
- Der Transfer literaturtheoretischer Autor- Werk- Leser- Beziehungen auf Pücklers Park in Branitz
- Eine Darstellung der hermeneutischen Positionen in der Literaturtheorie und der Deutungsansätze zum Branitzer Park
- Die,,verlorenen Orte“ im Branitzer Park
- Der Park als Lebensspiegel- ein imaginärer Rundgang
- Fazit
- Literaturverzeichnis
- Anlagen
- Danksagung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Masterarbeit befasst sich mit der Absichtsbestimmung des Branitzer Parks, dem letzten Werk des Fürsten Hermann von Pückler-Muskau. Ziel ist es, die enge Verbindung zwischen dem exzentrischen und vielseitig talentierten Künstler und seinem Park aufzuzeigen und Wege zu finden, Pückler wieder erfahrbar zu machen. Dabei werden literarische Interpretationsansätze auf den Park übertragen, um die komplexen Bedeutungsstrukturen des Werkes zu entschlüsseln.
- Die Bedeutung von Parks als „Texte“ und die Anwendung literaturtheoretischer Ansätze auf die Analyse von Landschaftsarchitektur
- Die Rolle der „verlorenen Orte“ im Branitzer Park und ihre Bedeutung für die Interpretation des Werkes
- Die Verbindung zwischen Pücklers Leben und seinem Werk, insbesondere die Spiegelung seiner Biografie im Park
- Die Herausforderungen der Interpretation des Branitzer Parks und die Suche nach neuen Zugängen zu Pücklers Absichten
- Die Relevanz des Branitzer Parks als kulturelles Erbe und seine Bedeutung für die Gegenwart
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Themenwahl und Zielsetzung der Arbeit vor. Sie erläutert die besondere Bedeutung des Branitzer Parks als Alterswerk Pücklers und die Herausforderungen, die sich aus der Interpretation des Werkes ergeben. Die Einleitung führt außerdem in die Thematik der „verlorenen Orte“ ein, die im weiteren Verlauf der Arbeit eine zentrale Rolle spielen.
Das zweite Kapitel beschäftigt sich mit der Definition von „Text“ und „Park“ und beleuchtet die Entwicklung von Landschaftsgärten und Parks in den verschiedenen Epochen. Es wird die Einordnung Pücklers in die Linie bedeutender Landschaftsarchitekten des englischen Stils dargestellt und sein individueller Stil analysiert.
Das dritte Kapitel widmet sich dem Transfer literaturtheoretischer Ansätze auf den Branitzer Park. Es werden verschiedene hermeneutische Positionen in der Literaturtheorie vorgestellt und auf die Interpretation des Parks angewendet. Die „verlorenen Orte“ im Park werden als wichtige Elemente der Interpretation betrachtet und ihre Bedeutung für die Entschlüsselung der Absichten Pücklers erläutert. Das Kapitel schließt mit einem imaginären Rundgang durch den Park, der die Verbindung zwischen Pücklers Leben und seinem Werk aufzeigt.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen den Branitzer Park, Hermann von Pückler-Muskau, Landschaftsarchitektur, Literaturtheorie, Hermeneutik, „verlorene Orte“, Lebensspiegel, Interpretation, Absichtsbestimmung, kulturelles Erbe.
- Quote paper
- Bachelor of Education Stephan Klausch (Author), 2011, Pücklers Zielvorhaben beim Branitzer Park, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/181856