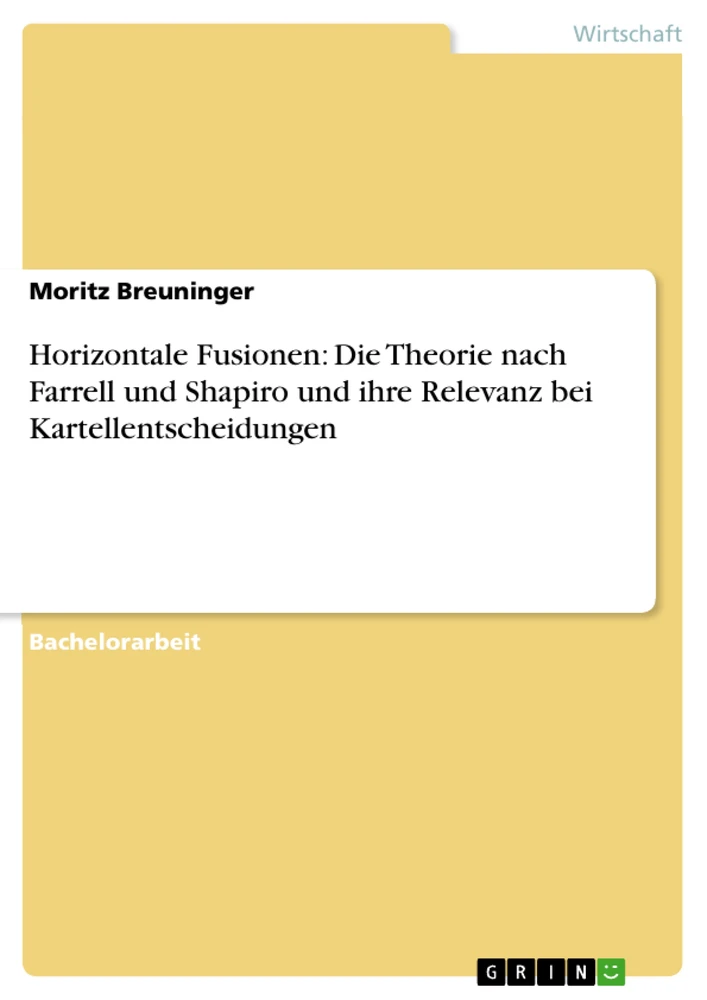Die Fundiertheit der Entscheidungen des Bundeskartellamtes wurde in den vergangenen Jahren mehrfach diskutiert. Vor allem das Fehlen einer systematischen Analyse der Fusionen und deren Auswirkungen auf die Marktteilnehmer anhand der formalen Erkenntnisse der industrieökonomischen Theorien gilt als problematisch. Die vorliegende Arbeit überprüft Kartellentscheidungen im Hinblick auf ihre Kongruenz mit der wettbewerbspolitischen Theorie. Der Fokus liegt dabei auf horizontalen Fusionen in oligopolen Märkten. Das von Joseph Farrell und Carl Shapiro (1990) aufgestellte Modell zur Gleichgewichtsanalyse von horizontalen Fusionen bildet die Basis der Untersuchung. Besondere Beachtung finden Preis- und Wohlfahrtseffekte von Zusammenschlüssen. Es wird formal gezeigt, dass Fusionen unter recht allgemeinen Annahmen immer den Preis des produzierten Gutes erhöhen, solange nicht erhebliche Synergieeffekte gehoben werden können. Außerdem verdeutlicht eine Betrachtung des externen Effektes eines Zusammenschlusses die Auswirkungen auf die Gesamtwohlfahrt. Zusammenfassend werden generelle Aussagen gemacht, welche Fusionen genehmigt und welche untersagt werden sollten.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Einführung in die Theorie und Praxis zu Horizontalen Fusionen
- 2.1 Wettbewerbspolitische Konzeptionen
- 2.2 Theoretische Grundlagen
- 2.2.1 Das Cournot-Modell
- 2.2.2 Konzentrationsmaße
- 2.3 Das Bundeskartellamt
- 2.3.1 Rechtliche Grundlagen und Zuständigkeiten
- 2.3.2 Aktuelle Entwicklung der Fusionskontrolle
- 3 Das Modell von Farrell und Shapiro (1990a)
- 3.1 Modellannahmen
- 3.2 Preiseffekte von horizontalen Fusionen
- 3.2.1 Fusionen ohne Synergien
- 3.2.2 Fusionen mit Skalen- oder Lerneffekten
- 3.3 Wohlfahrteffekte von horizontalen Fusionen
- 3.4 Implikationen für Wettbewerbsbehörden
- 4 Analyse von Kartellentscheidungen
- 4.1 Empirische Studien zu Fusionen
- 4.2 Fallbeispiele der Zusammenschlusskontrolle
- 4.2.1 Untersagungen
- 4.2.2 Genehmigungen
- 5 Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit beschäftigt sich mit der Analyse von horizontalen Fusionen und deren Relevanz bei Kartellentscheidungen. Die Arbeit untersucht die Theorie von Farrell und Shapiro, die Auswirkungen von Fusionen auf den Wettbewerb und die Rolle von Wettbewerbsbehörden bei der Fusionskontrolle.
- Theoretische Grundlagen horizontaler Fusionen
- Das Modell von Farrell und Shapiro
- Wettbewerbspolitische Konzeptionen
- Praxis der Fusionskontrolle
- Analyse von Kartellentscheidungen
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1 bietet eine Einführung in die Thematik und stellt die Relevanz des Themas dar.
- Kapitel 2 beleuchtet die theoretischen Grundlagen horizontaler Fusionen und stellt verschiedene Konzepte der Wettbewerbspolitik vor. Zudem wird das Bundeskartellamt und seine Rolle bei der Fusionskontrolle erläutert.
- Kapitel 3 analysiert das Modell von Farrell und Shapiro, das die Auswirkungen von Fusionen auf Preise und Wohlfahrt untersucht.
- Kapitel 4 befasst sich mit der Analyse von Kartellentscheidungen und präsentiert empirische Studien sowie Fallbeispiele der Zusammenschlusskontrolle.
Schlüsselwörter
Die Arbeit behandelt Themen wie horizontale Fusionen, Wettbewerbspolitik, Kartellrecht, Fusionskontrolle, Modell von Farrell und Shapiro, Wohlfahrtseffekte, Preiseffekte, empirische Studien, Fallbeispiele, Bundeskartellamt, und Zusammenschlusskontrolle.
- Quote paper
- Moritz Breuninger (Author), 2010, Horizontale Fusionen: Die Theorie nach Farrell und Shapiro und ihre Relevanz bei Kartellentscheidungen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/181869