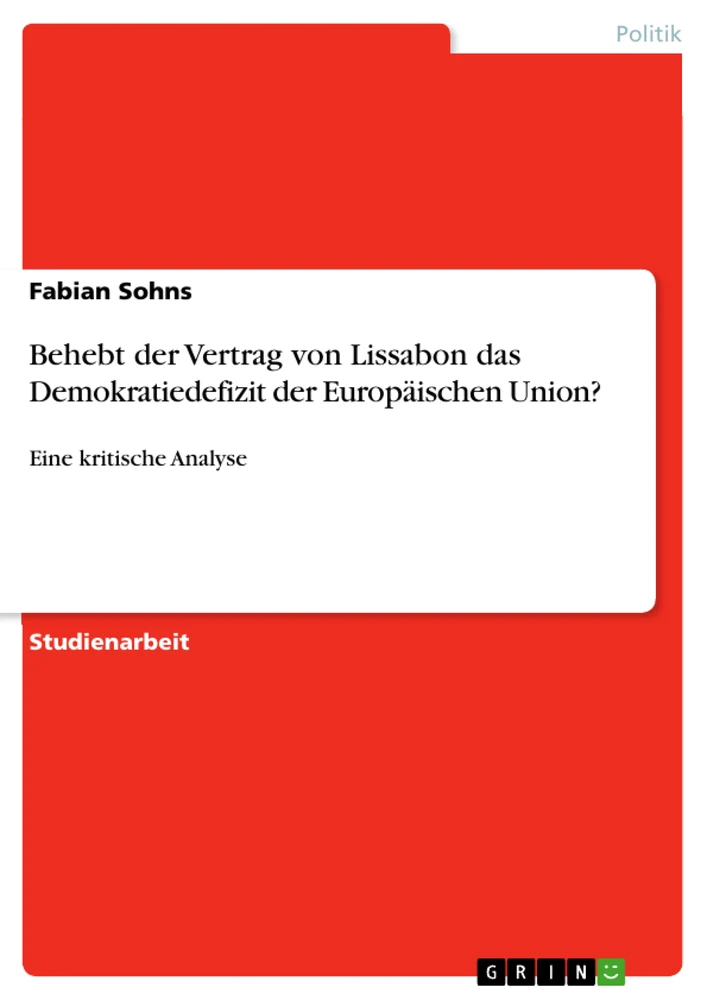Eines der faszinierenden Phänomene der europäischen Geschichte bildet der Gedanke einer
Einigung der europäischen Staaten, der über Jahrhunderte hinweg stetig auf die Agenda
gerückt ist. Die Motive für diese Vorstellung waren sehr unterschiedlich; sie begründeten sich
insbesondere im Bedürfnis, Europa gegen ‚den Feind‘ von Außen zu schützen und eine
universalistische Harmonie zu gewährleisten (vgl. Neisser/ Verschraegen, 2001, S. 1). Den
Grundstein dieser Einigung im 20. Jahrhundert legten die Staats- und Regierungschefs
Deutschlands, Frankreichs, Italiens und der Beneluxstaaten am 25. März 1957, mit dem
Vertrag zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (vgl. Leisse, 2009, S. 1).
Der Gedanke entsprang „in dem festen Willen, die Grundlagen für einen immer engeren
Zusammenschluss der europäischen Völker zu schaffen“ und „entschlossen, durch
gemeinsames Handeln den wirtschaftlichen und sozialen Fortschritt der Länder zu sichern,
indem sie die Europa trennenden Schranken beseitigen“ (Präambel EWGV). Diese Stelle des
EWG-Vertrages verdeutlicht die enorme Rolle des Prozesses der Integration. Im Mittelpunkt
steht die dichte Verknüpfung der Völker und Staaten in Europa, die sowohl ein gemeinsames
Handeln als auch eine langfristig und zukunftsoffen angelegte Verflechtung ermöglichen soll.
Sie stellen bis dato die Grundpfeiler der Integration dar (vgl. ebd., S. 1). [...]
Inhaltsverzeichnis
- DEFINITIONEN
- 1. EINLEITUNG
- 1.1 INTEGRATIONSENTWICKLUNG
- 1.2 EINFÜHRUNG: DER VERTRAG VON LISSABON
- 2. REFORMEN DES LISSABONVERTRAGS ZUR MINDERUNG DES DEMOKRATIEDEFIZITS
- 2.1 DIE KOMPETENZEN DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS (EP)
- 2.2 DIE ROLLE DER NATIONALEN PARLAMENTE
- 2.3 DIE CHARTA DER GRUNDRECHTE
- 2.4 DIE EUROPÄISCHE BÜRGERINITIATIVE (EBI)
- 6. FAZIT
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Frage, ob der Vertrag von Lissabon das Demokratiedefizit der Europäischen Union behebt. Hierzu werden die wichtigsten Reformen des Lissabon-Vertrages, die sich auf die Demokratie in der EU auswirken, analysiert. Die Arbeit untersucht, inwieweit diese Reformen eine effektivere und demokratischere Entscheidungsfindung in der EU ermöglichen.
- Die Kompetenzen des Europäischen Parlaments (EP)
- Die Rolle der nationalen Parlamente
- Die Charta der Grundrechte
- Die Europäische Bürgerinitiative (EBI)
- Das Demokratiedefizit in der EU
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Definition der zentralen Begriffe wie Demokratie, Legitimität und Verfassung. Im Anschluss wird die Entwicklung der europäischen Integration und die Motive für diese Integration dargelegt. Anschließend wird der Vertrag von Lissabon vorgestellt und die Reformen des Vertrages, die das Demokratiedefizit in der EU mindern sollen, analysiert.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Themen Europäische Union, Demokratie, Integration, Vertrag von Lissabon, Europäisches Parlament, nationale Parlamente, Charta der Grundrechte, Europäische Bürgerinitiative.
- Quote paper
- Fabian Sohns (Author), 2010, Behebt der Vertrag von Lissabon das Demokratiedefizit der Europäischen Union?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/181947