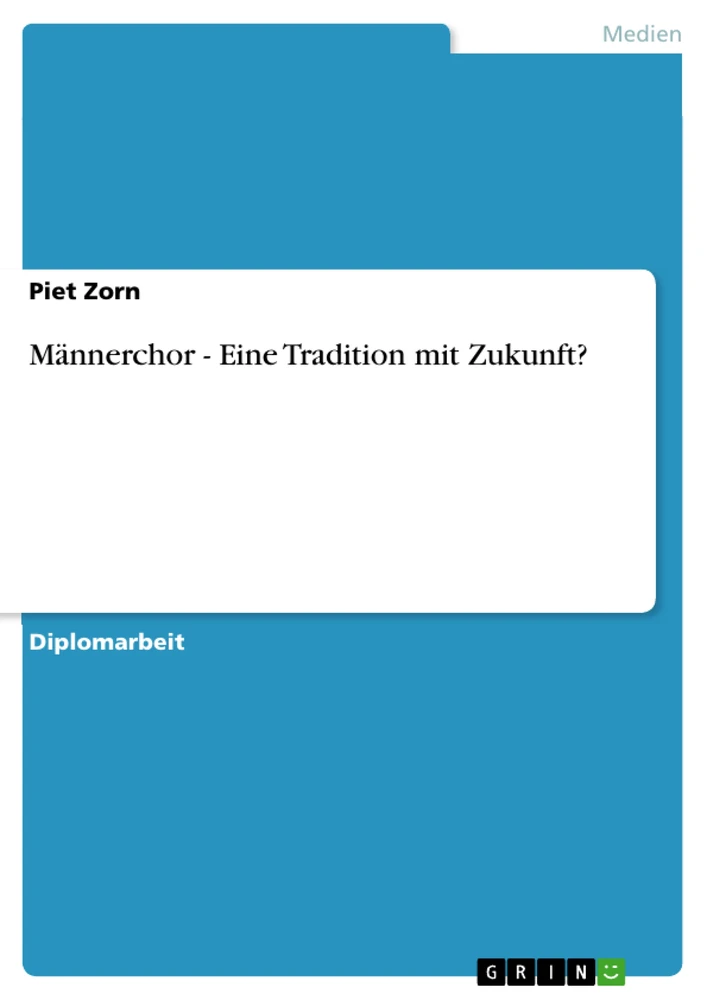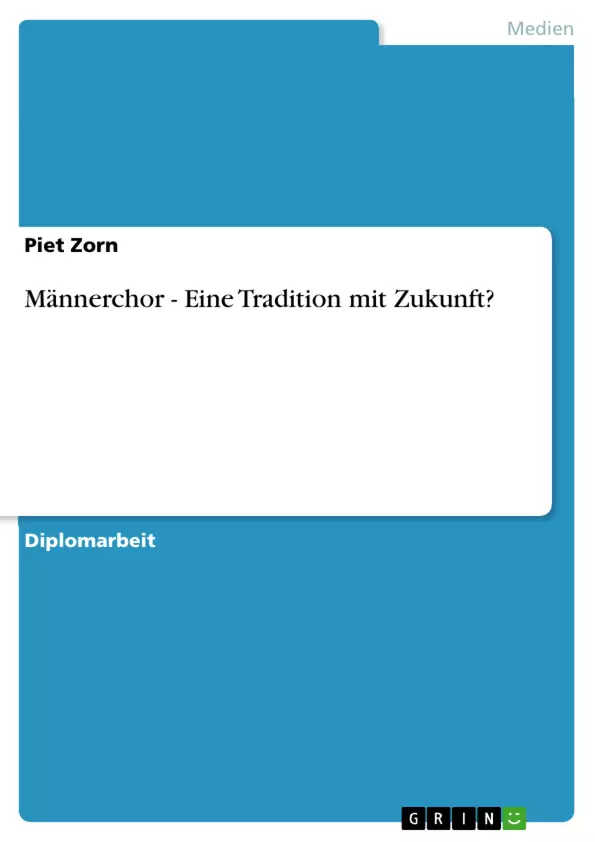"Wo man singt, da laß' dich ruhig nieder, böse Menschen haben keine Lieder..."
Diese von JOHANN GOTTFRIED SEUME erdachten Worte sind vielen von uns bekannt.
Schenkte man ihnen Glauben, so dürfte man sich singender Gesellschaft jederzeit
anschließen und würde darüber hinaus herzlichst zum Mitsingen eingeladen. Aus
heutiger Sicht entspringt diese Vorstellung zweifellos der UTOPIE, dennoch lässt sich
in Seumes Zeilen ein Stück Wahrheit finden. Es ist der Glückszustand, der einer
Gruppe singender Menschen innewohnt. Es ist das Gefühl von Gemeinschaft und
Geborgenheit, von Freude und Frohsinn, von Natürlichkeit und Nächstenliebe. Das
musikalische Miteinander hat hierbei einen besonderen ethischen Wert, der in
unserem Alltag leider zu selten wahrgenommen und dessen positive Auswirkung auf
das soziale Gefüge unserer Gesellschaft zu sehr verdrängt oder gar nicht erkannt
wird. In Anbetracht dieser Situation besteht in jedem Fall Handlungsbedarf.
Die vorliegende Arbeit widmet sich der nunmehr bald zwei Jahrhunderte währenden
Tradition der Männergesangvereine im deutschsprachigen Raum. Ein wesentliches
Ziel meiner Arbeit liegt darin, den Stellenwert dieser Tradition sowohl aus
musikalisch-ästhetischer, als auch aus gesellschaftlicher Sicht zu verdeutlichen und
das gegenwärtige Interesse daran zu vermehren. Aus verschiedenen Blickwinkeln
sollen soziale Besonderheiten und musikalische Eigenschaften beleuchtet werden, um
realisierbare Ideen und Möglichkeiten aufzuwerfen, dem bereits vor mehreren Jahren
begonnenen Prozess des Aussterbens der Männergesangvereine entgegen zu wirken
und sie wieder ins Licht des allgemeinen Musiklebens zu rücken.[...]
Inhaltsverzeichnis
- 1. GESCHICHTLICHE HINTERGRÜNDE
- ENTSTEHUNG DER MÄNNERGESANGSVEREINE
- Der romantische Volksgeist
- Namensgebung der Vereine
- Concordia
- Polyhymnia
- Frohsinn
- Liedertafel
- Gesellschaftlicher Hintergrund
- Das Vereinsleben
- 2. REPERTOIRE UND SINGLITERATUR
- EINLEITUNG
- Das Allgemeine Deutsche Kommersbuch
- Die Polyhymnia-Ausgabe
- TRADITIONELLES LIEDGUT
- Volks- und Kunstlieder
- Trinklieder und Trinksprüche
- Männerchor in der Oper
- MODERNE LITERATUR
- Der Schlager
- Die Qual der Wahl - Neue Arrangements
- 3. DIE PRAXIS
- TRADITIONELLE AUFTEILUNG DER STIMMEN
- Ambitus der Männerstimmen
- PROBENARBEIT
- Stimmbildung im Männerchor
- Einstudierung neuer Stücke
- Musikalische Qualität
- Atmen
- Artikulation
- Phrasierung
- DER SATZGESANG
- Der vierstimmige Satz
- Der dreistimmige Satz
- DER CHORKLANG
- Definition von Klang
- Einsatz der Stimmregister
- Chorgesang mit instrumentaler Begleitung
- A-Cappella Chorgesang
- DIE CHORLEITUNG
- Die Stimmgabel
- Chorleiterin oder Chorleiter?
- Kommunikative und soziale Kompetenz
- 4. PROBLEME VON HEUTE - HOFFNUNG FÜR MORGEN?
- FLUKTUATION
- Mangel an Nachwuchs
- NACHWUCHSFÖRDERUNG
- Der \"Felix\" und andere Maßnahmen
- AUFRECHTERHALTUNG DER MÄNNERGESANGSVEREINE
- Neuausrichtung des Repertoires
- Gratwanderung zwischen Tradition und Neuerung
- Auf zu neuen Ufern - Wege und Ziele
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit von Pieter Zorn befasst sich mit der Tradition der Männergesangvereine im deutschsprachigen Raum und untersucht deren Stellenwert aus musikalisch-ästhetischer und gesellschaftlicher Sicht. Die Arbeit zielt darauf ab, das gegenwärtige Interesse an dieser Tradition zu vermehren und realisierbare Ideen und Möglichkeiten aufzuwerfen, um dem Prozess des Aussterbens entgegen zu wirken und die Männergesangvereine wieder ins Licht des allgemeinen Musiklebens zu rücken.
- Die Entstehung der Männergesangvereine im 19. Jahrhundert
- Das Repertoire und die Singliteratur der Männerchöre
- Die praktische Arbeit im Männerchor, inklusive Stimmbildung, Satzgesang und Chorleitung
- Aktuelle Probleme der Männergesangvereine, wie Fluktuation und Nachwuchsmangel
- Möglichkeiten zur Neuausrichtung und zum Erhalt der Männergesangvereine
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel der Arbeit beleuchtet die Entstehung der Männergesangvereine im 19. Jahrhundert. Es werden die historischen und gesellschaftlichen Bedingungen, die zur Gründung dieser Vereine führten, sowie deren frühe Repertoire und ihre Entwicklung beschrieben. Das zweite Kapitel befasst sich mit dem Repertoire und der Singliteratur der Männerchöre. Es werden traditionelle Volks- und Kunstlieder, Trinklieder und Trinksprüche sowie moderne Literatur wie Schlager und neue Arrangements untersucht. Das dritte Kapitel analysiert die praktische Arbeit im Männerchor, einschließlich Stimmbildung, Satzgesang und Chorleitung. Hier werden die verschiedenen Aspekte der Probenarbeit, die musikalische Qualität und die kommunikative und soziale Kompetenz der Chorleitung betrachtet.
Schlüsselwörter
Männergesangverein, Tradition, Repertoire, Singliteratur, Stimmbildung, Satzgesang, Chorleitung, Fluktuation, Nachwuchsmangel, Neuausrichtung, Erhalt, Volkslied, Kunstlied, Schlager, Moderne Arrangements.
- Citar trabajo
- Piet Zorn (Autor), 2011, Männerchor - Eine Tradition mit Zukunft?, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/182139