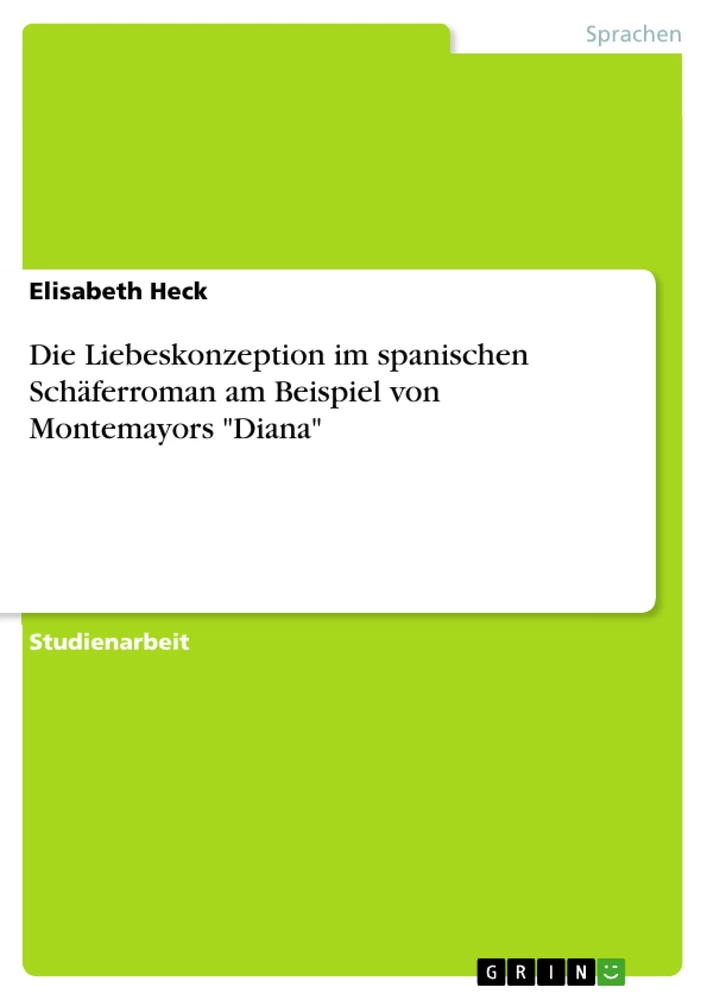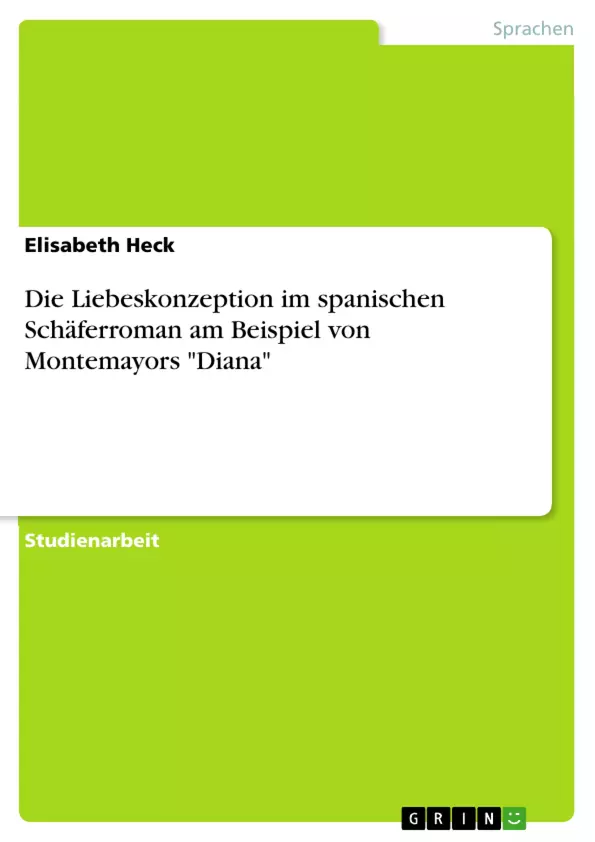In der vorliegenden Hausarbeit werde ich mich mit der Liebeskonzeption im spanischen Schäferroman am Beispiel der Diana von Montemayor beschäftigen. Dabei wird ein besonderes Augenmerk auf die Umsetzung der neuplatonischen Idee der Liebe gelegt. Zu Beginn werde ich die Liebestheorie des Neuplatonismus erläutern, die in der
Renaissance vor allem durch den Philosophen Marsilio Ficino formuliert wurde und deren Ursprung, wie der Name schon sagt, in der Lehre Platons liegt. Die Liebesphilosophie Leone Hebreos wird von mir näher beleuchtet werden, spielt diese doch in der Diana eine
so wichtige Rolle.
Im zweiten Teil der Arbeit möchte ich die Liebeskonstruktion des bedeutendsten spanischen Schäferromans analysieren. Die neuplatonische Liebe im Sinne Leone Hebreos zeigt sich hier zum Bespiel in der Differenzierung zwischen buen und falso amor, der
These der Irrationalität der Liebe und der Begründung der Liebe in der Schönheit, dem Ideal der Renaissance. Trotz der eindeutig neuplatonischen Färbung der Diana weicht Montemayor teilweise von der Theorie Hebreos ab oder führt eigene Ideen über die Liebe
an.
Das Ziel der Untersuchung besteht darin, das in der Diana vorherrschende Liebeskonzept auf Basis der neuplatonischen Philosophie darzustellen. Des Weiteren habe ich die Absicht, neben der allgemeinen theoretischen Darstellung des Liebeskonzepts der
Renaissance einen strukturierten und ausführlichen Überblick über die Liebe in Montemayors Roman zu geben. Zwar wurde dieses Thema schon von vielen Literaturkritikern erörtert, jedoch liegt meiner Meinung nach bisher noch keine zusammenhängende Darstellung der neuplatonischen Liebe in "Los siete libros de la Diana"
vor.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Das neuplatonische Liebeskonzept der Renaissance
- Die Lehre Platons als Ursprung
- Die Lehre des Marsilio Ficino und der "Accademia Platonica"
- Die Lehre des Leone Hebreo
- Die Liebeskonzeption in Montemayors Diana
- Neuplatonische Merkmale der Liebe
- buen amor und falso amor
- Irrationalität der Liebe
- Keuschheit und Treue
- Liebe und Schönheit
- Der Übergang von der sinnlichen in die intelligible Welt
- Nicht-platonische Elemente
- Neuplatonische Merkmale der Liebe
- Liebe im Kontext von Schicksal und Zeit
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die Liebeskonzeption im spanischen Schäferroman, insbesondere in Montemayors Diana. Das Hauptziel ist die Darstellung des in der Diana vorherrschenden Liebeskonzepts auf der Grundlage der neuplatonischen Philosophie. Zusätzlich soll ein strukturierter Überblick über die Liebe in Montemayors Roman gegeben werden.
- Neuplatonische Einflüsse auf die Liebesdarstellung in Montemayors Diana
- Differenzierung zwischen „buen amor“ und „falso amor“
- Die Rolle der Irrationalität in der Liebe
- Die Bedeutung von Schönheit und deren Verhältnis zur Liebe
- Abweichungen von der neuplatonischen Theorie in Montemayors Werk
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 (Einleitung): Die Einleitung stellt die zentrale Forschungsfrage nach der Liebeskonzeption in Montemayors Diana und deren Bezug zum Neuplatonismus vor. Es wird auf die Irrationalität der Liebe als zentrales Thema hingewiesen und die Bedeutung von Leone Hebreos Werk hervorgehoben.
Kapitel 2 (Das neuplatonische Liebeskonzept der Renaissance): Dieses Kapitel erläutert die neuplatonische Liebestheorie, beginnend mit Platons Lehre vom Dualismus zwischen sinnlicher und intelligibler Welt. Es werden die Beiträge von Marsilio Ficino und seiner Accademia Platonica sowie Leone Hebreos Einfluss auf die Renaissance-Liebesphilosophie detailliert dargestellt.
Kapitel 3 (Die Liebeskonzeption in Montemayors Diana): Dieses Kapitel analysiert die Liebesdarstellung in Montemayors Diana. Es untersucht die neuplatonischen Elemente wie die Unterscheidung zwischen „buen amor“ und „falso amor“, die Irrationalität der Liebe und die Rolle der Schönheit. Weiterhin werden nicht-platonische Aspekte der Liebeskonzeption in dem Roman beleuchtet.
Kapitel 4 (Liebe im Kontext von Schicksal und Zeit): [Zusammenfassung fehlt, da der Text nicht zur Verfügung steht]
Schlüsselwörter
Neuplatonismus, spanischer Schäferroman, Montemayor, Diana, Liebeskonzeption, Leone Hebreo, Marsilio Ficino, Platon, „buen amor“, „falso amor“, Irrationalität der Liebe, Schönheit, Renaissance.
- Quote paper
- Elisabeth Heck (Author), 2010, Die Liebeskonzeption im spanischen Schäferroman am Beispiel von Montemayors "Diana", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/182140