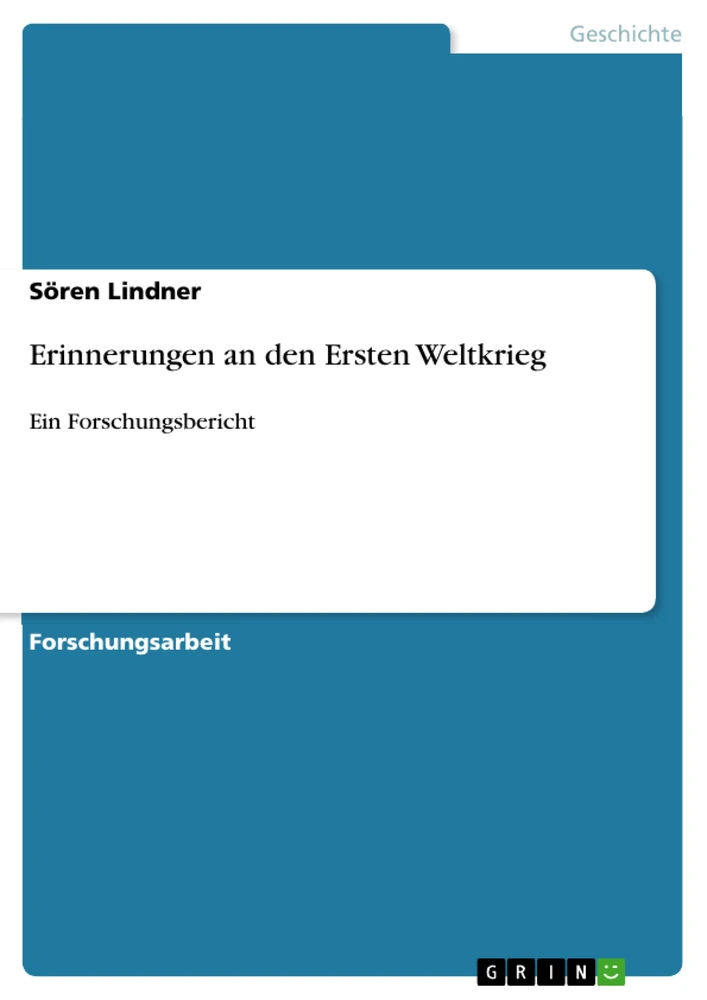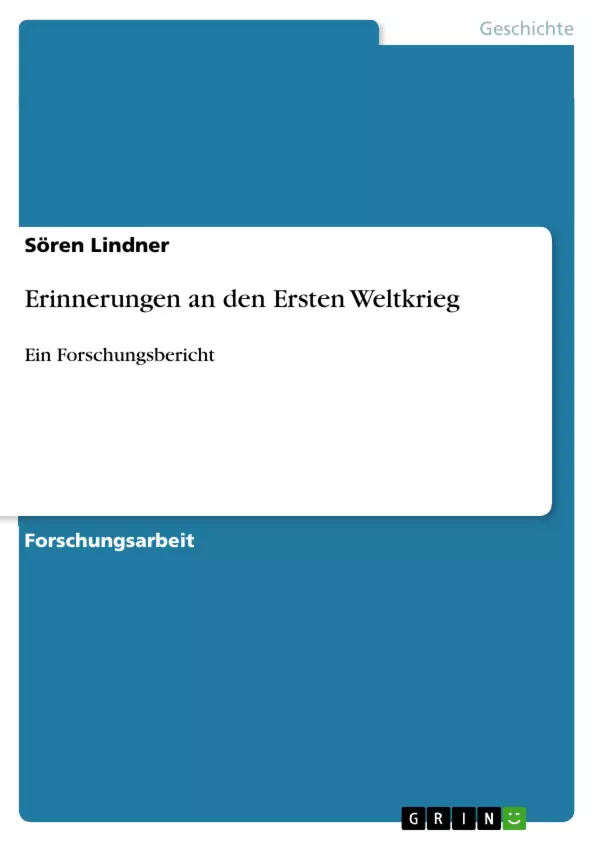Der Erste Weltkrieg war in der geschichtswissenschaftlichen Forschung und in der Erinnerung der Deutschen bis in die 1960er eher im Hintergrund zu verorten. Ein Blick in die am Krieg beteiligten europäischen Nachbarländer belegt jedoch, dass dort der Erste Weltkrieg stets präsent war und ist.
In der Forschung herrscht Einigkeit darüber, dass der Beginn des Ersten Weltkriegs 1914 eine einschneidende Zäsur in der Geschichte darstellt. Die Kampfhandlungen forderten viele Tote, Verwundete und Vermisste. Die Gesamtzahl an Toten infolge des Kriegs beläuft sich auf etwa neun Millionen. Nicht ohne Grund spricht George Kennan 1979 von der „great seminal catastrophy of this century“, der „Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts“ .
Daher drängt es sich auf, die Erinnerungen in der Weimarer Republik im Anschluss an diesen „industrialisierten Krieg“ näher zu untersuchen. Dazu bedarf es einer näheren Erläuterung von Erinnerungen. Die Literatur- und Kulturwissenschaftlerin Astrid Erll hat in ihrer Dissertation über Gedächtnisromane ein Modell zu kollektivem Gedächtnis und Erinnerungskulturen entworfen. Sie bezieht das kollektive Gedächtnis auf Kulturphänomene und bezeichnet es als ein „‚Vorrat‘ oder ‚Speicher‘“ an Informationen. Dies sei „ein prinzipiell offenes und veränderliches Gewebe mentaler, materialer und sozialer Phänomene der Kultur“ und nur durch „Akte kollektiver Erinnerung“ beobachtbar. Erinnerung ist nach Erll eine Aktivierung der Informationen aus dem Vorrat bzw. Speicher an Informationen, also dem Gedächtnis. Die Akte kollektiver Erinnerung können nur durch mediale Instrumente von mehreren Menschen getätigt und gelesen werden, sind aber genauso vom individuellen Gedächtnis als „Ausgangspunkte“ abhängig. Erinnerungskulturen sind die „Ausprägungen von kollektivem Gedächtnis“ . Sie machen kollektives Gedächtnis erst sichtbar und analysierfähig.
Ziel dieser Arbeit ist es, einen Bericht zu liefern, wie diese Erinnerungen in der wissenschaftlichen Forschung behandelt werden, welche Aspekte und Fragen diskutiert wurden und werden und welche neuen Perspektiven und Ansätze entstanden.
Im ersten Kapitel beleuchte ich die Anfänge der Forschung von 1950 bis in die 1980er Jahre, im zweiten Kapitel von den 1980er bis heute, da diese Jahre einen Zäsurcharakter haben.
Am Ende erfolgen ein Fazit, das die zentralen Ergebnisse zusammenfasst, sowie ein Ausblick, der mögliche Forschungsperspektiven für künftige Studien betrachtet.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Die Anfänge der Erinnerungsforschung: Die 1950er bis 1980er Jahre
- 1.1 Ausgangslage im Nachkriegsdeutschland 1918
- 1.2 Anfänge der Erinnerungsforschung von 1950 bis 1980
- 2. Die Erinnerungsforschung 1980 bis heute
- 2.1 Die 1980er Jahre
- 2.2 Die 1990er Jahre
- 2.3 Die 2000er Jahre bis heute
- 3. Fazit Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit den Erinnerungen an den Ersten Weltkrieg in der Weimarer Republik. Sie verfolgt dabei das Ziel, die Entwicklung der Erinnerungsforschung zu diesem Thema zu beleuchten und dabei insbesondere die verschiedenen Aspekte, Fragen und Perspektiven zu analysieren, die im Laufe der Zeit aufgekommen sind. Die Arbeit konzentriert sich dabei auf die Zeit von 1950 bis heute.
- Die Ausgangslage in der Weimarer Republik und die Rolle der Kriegsschuldfrage
- Die Entwicklung der Erinnerungsforschung von den 1950er bis in die 1980er Jahre
- Die Bedeutung des Ersten Weltkriegs im Kontext des Zweiten Weltkriegs und des Holocaust
- Die Einflussfaktoren auf die Entstehung und Wahrnehmung von Erinnerungen, wie z. B. Propaganda, Medien, Literatur und individuelle Erinnerungen
- Die verschiedenen Perspektiven und Ansätze in der Erinnerungsforschung
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung befasst sich mit der Bedeutung des Ersten Weltkriegs als „Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts“ und setzt den Fokus auf die Notwendigkeit, die Erinnerungen an den Krieg in der Weimarer Republik genauer zu untersuchen. Sie führt außerdem das Konzept des kollektiven Gedächtnisses und der Erinnerungskulturen nach Astrid Erll ein und erklärt die Relevanz dieser Konzepte für die Arbeit.
1. Die Anfänge der Erinnerungsforschung: Die 1950er bis 1980er Jahre
1.1 Ausgangslage im Nachkriegsdeutschland 1918
Dieser Abschnitt beleuchtet die verzerrte Darstellung der Kriegswirklichkeit durch die Zensur und Propaganda während des Ersten Weltkriegs. Es wird dargestellt, wie die „Kriegsschuldfrage“ in der Weimarer Republik zum zentralen Thema wurde und wie verschiedene Formen der Erinnerung, wie z. B. Unterhaltungsmedien, die Aufarbeitung des Krieges beeinflussten.
1.2 Anfänge der Erinnerungsforschung von 1950 bis 1980
Dieser Teil beleuchtet die Anfänge der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit den Erinnerungen an den Ersten Weltkrieg, die ab den 1950er Jahren in Deutschland begann. Er untersucht die Gründe für den späten Beginn der Forschung und geht auf die ersten Ansätze und Perspektiven ein, die in dieser Zeit entwickelt wurden.
2. Die Erinnerungsforschung 1980 bis heute
Dieser Abschnitt untersucht die Entwicklung der Erinnerungsforschung ab den 1980er Jahren und analysiert, wie der Fokus der Forschung sich in dieser Zeit veränderte. Es werden die verschiedenen Aspekte, Fragen und Perspektiven, die in den 1980er, 1990er und 2000er Jahren diskutiert wurden, beleuchtet.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Themen Erinnerungskultur, Erster Weltkrieg, Weimarer Republik, Kriegsschuldfrage, kollektives Gedächtnis, Erinnerungsforschung und wissenschaftliche Aufarbeitung. Sie analysiert die Entwicklung der Forschung zu diesem Thema und untersucht dabei verschiedene Perspektiven, Ansätze und Debatten, die im Laufe der Zeit entstanden sind.
- Arbeit zitieren
- B. A. Sören Lindner (Autor:in), 2011, Erinnerungen an den Ersten Weltkrieg, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/182153