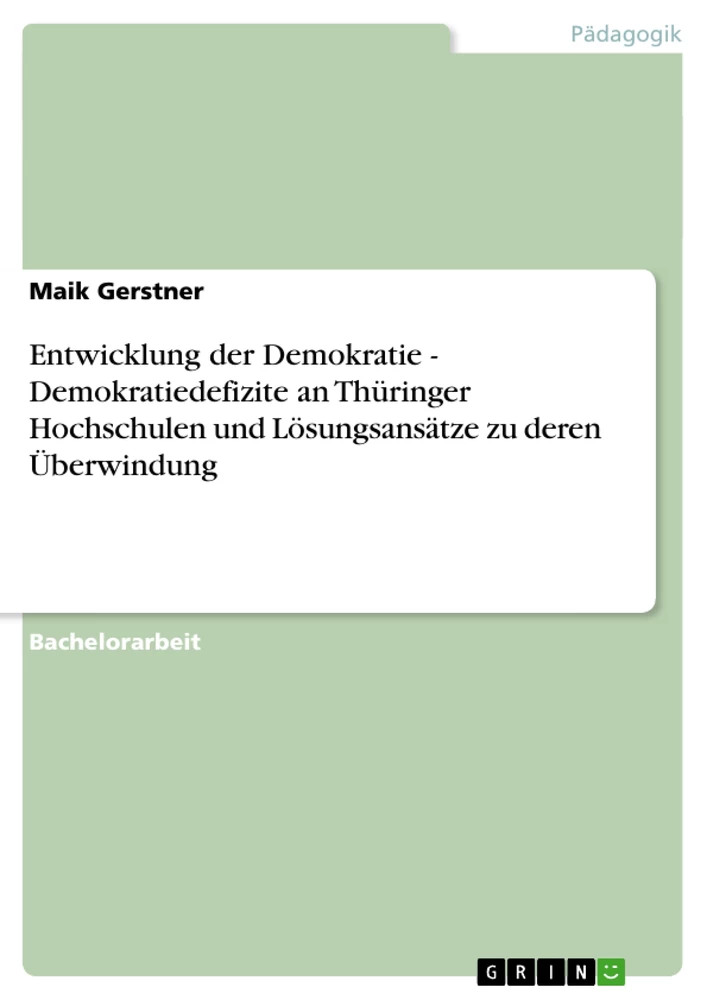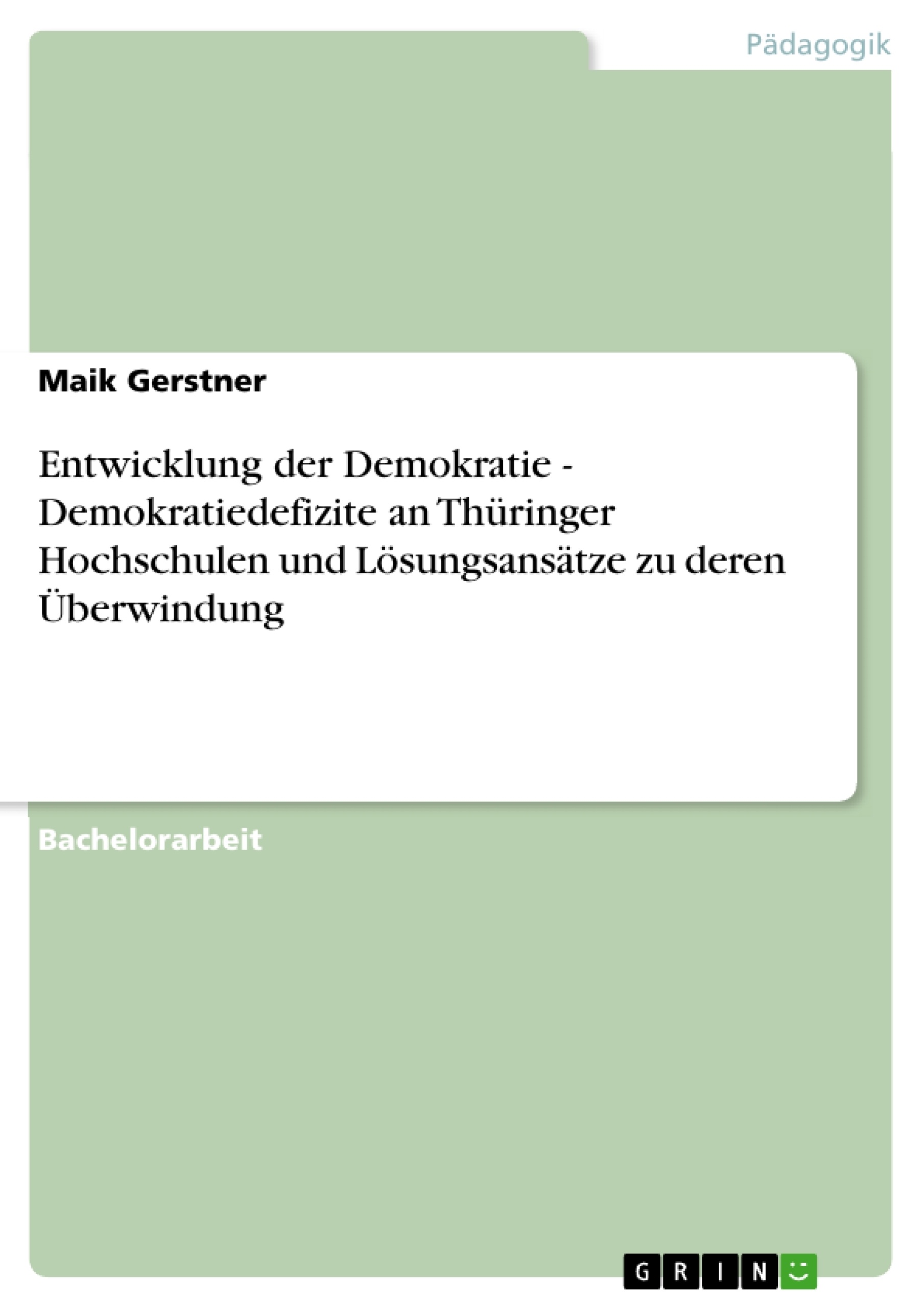Die Fakultät Wirtschaftsrecht der Fachhochschule Schmalkalden, die Studierendeninitiative
„Projekt für internationale Beziehungen“ und die Zürcher Hochschule für angewandte
Wissenschaften in Winterthur ermöglichten dem Autor der vorliegenden Arbeit im Rahmen
seines Studiums 2009 ein Auslandssemester in der Schweiz zu absolvieren, wodurch dieser
mit einer direkten Form der Demokratie in Berührung kam.
Zeitgleich begann in Deutschland ein von den Studierendenvertretern initiierter
„Bildungsstreik“, an dem sich Studierende, Professoren,1 Hochschulmitarbeiter, Schüler und
Auszubildende zu Tausenden an Aktionen wie Demonstrationen und Hörsaalbesetzungen
beteiligten. Auch die Thüringer Hochschulen nahmen innerhalb dieses hochschulübergreifenden
Netzwerkes am Bildungsstreik teil. Selbst außerhalb Deutschlands und
außerhalb Europas gab und gibt es ähnliche Bewegungen. Forderungen des Bildungsstreiks
waren und sind neben den Ausbau der Hochschulkapazitäten und Sicherstellung der
Finanzierung auch eine Demokratisierung der Hochschulstruktur.
Vom Erfolg der direkten Demokratie beeindruckt begann der Autor sich für die
Studierendenschaft seiner Hochschule zu engagieren, indem er von Oktober 2009 bis Februar
2011 als Delegierter in der Konferenz Thüringer Studierendenschaften für die
Fachhochschule Schmalkalden und während dieser Zeit auch für den Studierendenrat der
Fachhochschule Schmalkalden tätig war. Sein Ziel war und ist die Erreichung einer
demokratischeren Struktur im Hochschulsektor. Mit der Beteiligung der Studierendenschaft
der Fachhochschule Schmalkalden am bundesweiten Bildungsstreik wurden Forderungen an
Politik und Hochschulleitung aufgestellt.
Die vorliegende Arbeit soll nun die Entwicklung der Demokratie erklären, Demokratiedefizite
an Thüringer Hochschulen aufzeigen und Lösungsansätze zu deren Überwindung vorstellen.
Eröffnet wird im zweiten Teil der Arbeit mit der Darstellung der Demokratieentwicklung.
Beginnend bei ihren Anfängen im antiken Athen, über Rückschläge während des römischen
Reiches und später des europäischen Absolutismus. Das Streben nach Demokratie durch die
Aufklärer und die Entstehung der demokratischen Verfassung der Vereinigten Staaten von
Amerika, die Französischen Revolution und die Arbeiterbewegungen in England werden
erklärt.[...]
Inhaltsverzeichnis
- Neuordnung der Hochschulstruktur
- Stärkung der Hochschulautonomie
- Eine weitere Aufgabe, die bisher noch der Hochschulleitung unterliegt, ist die Bean- tragung einer Strukturänderung der Hochschule nach §4 ThurHG über die Vorgaben des Gesetzes hinaus.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die Auswirkungen der jüngsten Novellierung des Thüringer Hochschulgesetzes auf die Hochschulautonomie und die Hochschulstruktur. Sie untersucht, inwieweit die Reformziele erreicht wurden und welche Auswirkungen die Änderungen auf die Entscheidungsfindungsprozesse und die Akzeptanz innerhalb der Hochschulen haben.
- Neuordnung der Hochschulstruktur und Entscheidungsbefugnisse
- Stärkung und Einschränkungen der Hochschulautonomie
- Bewertung des Einflusses von externen Kräften auf strategische Entscheidungen
- Analyse der Auswirkungen des LUBOM-Modells auf die Hochschulfinanzierung
- Diskussion der notwendigen Spielräume für die Hochschulen
Zusammenfassung der Kapitel
Neuordnung der Hochschulstruktur: Die Zusammenfassung konzentriert sich auf die Kritik an der Zentralisierung von Entscheidungsbefugnissen im Rektorat. Die Autorin argumentiert, dass viele Entscheidungen, wie Berufungen oder Strukturplanungen, nicht die Dringlichkeit aufweisen, um sie allein der Hochschulleitung zu überlassen. Die Einbeziehung des Senats oder der Fakultätsgremien wird als wichtiger Schritt zur Stärkung der Akzeptanz und zur Vermeidung von willkürlichen Entscheidungen angesehen. Die Besetzung von Führungspositionen mit externen Managern ohne Integration in den Lehrbetrieb wird ebenfalls kritisch beleuchtet, da dies die Akzeptanz der Entscheidungen innerhalb der Hochschule weiter verringert. Die Autorin schlägt eine klare Trennung zwischen geschäftsführender Hochschulleitung und den Entscheidungsgremien vor, um die Hochschulautonomie demokratisch zu gestalten.
Stärkung der Hochschulautonomie: Die Stärkung der Hochschulautonomie wird grundsätzlich positiv bewertet, insbesondere im Bereich der Professorenberufungen und der Gestaltung von Studiengängen. Allerdings wird kritisiert, dass die Bündelung von Entscheidungsbefugnissen beim Präsidium und Hochschulrat zu einer Machtkonzentration und einem Angriff auf die demokratische Hochschulautonomie führt. Die Autorin plädiert für eine Rückverlagerung wichtiger strategischer Entscheidungen an den paritätisch besetzten Senat und für eine dezentrale, fakultätsbasierte Ausübung des Berufungsrechts.
Eine weitere Aufgabe, die bisher noch der Hochschulleitung unterliegt, ist die Bean- tragung einer Strukturänderung der Hochschule nach §4 ThurHG über die Vorgaben des Gesetzes hinaus: Dieses Kapitel thematisiert die Kritik an der Möglichkeit der Hochschulleitung, Strukturänderungen über die gesetzlichen Vorgaben hinaus zu beantragen. Die Autorin argumentiert, dass solche tiefgreifenden Entscheidungen in der Verantwortung des Senats liegen sollten und der Nutzen der bestehenden Regelung fragwürdig ist. Sie verweist auf ein Beispiel, in dem der Antrag des Hochschulrats auf Verkleinerung nur teilweise vom Ministerium genehmigt wurde, was als unzureichende Berücksichtigung der Bedürfnisse der Hochschule interpretiert wird. Abschließend fordert die Autorin eine bessere Ausgestaltung des Gesetzes, um den Hochschulen mehr Autonomie und Planungssicherheit bei der Gestaltung ihrer Strukturen zu ermöglichen.
Schlüsselwörter
Hochschulautonomie, Hochschulstruktur, Entscheidungsbefugnisse, Rektorat, Senat, Fakultätsgremien, Professorenberufungen, Hochschulmanagement, LUBOM-Modell, Mittelvergabe, Thüringer Hochschulgesetz (ThürHG), Demokratisierung der Hochschule, Wettbewerbsdruck, Planungssicherheit.
Häufig gestellte Fragen zur Analyse des Thüringer Hochschulgesetzes
Was ist der Gegenstand dieser Analyse?
Diese Arbeit analysiert die Auswirkungen der jüngsten Novellierung des Thüringer Hochschulgesetzes auf die Hochschulautonomie und die Hochschulstruktur. Im Fokus stehen die erreichten Reformziele, die Auswirkungen auf die Entscheidungsfindungsprozesse und die Akzeptanz innerhalb der Hochschulen.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Analyse untersucht die Neuordnung der Hochschulstruktur und Entscheidungsbefugnisse, die Stärkung und Einschränkungen der Hochschulautonomie, den Einfluss externer Kräfte auf strategische Entscheidungen, die Auswirkungen des LUBOM-Modells auf die Hochschulfinanzierung und die notwendigen Spielräume für die Hochschulen.
Wie wird die Neuordnung der Hochschulstruktur bewertet?
Die Zusammenfassung kritisiert die Zentralisierung von Entscheidungsbefugnissen im Rektorat. Die Einbeziehung des Senats oder der Fakultätsgremien wird als wichtig für die Akzeptanz und Vermeidung willkürlicher Entscheidungen angesehen. Die Besetzung von Führungspositionen mit externen Managern ohne Integration in den Lehrbetrieb wird ebenfalls kritisch beleuchtet. Es wird eine klare Trennung zwischen geschäftsführender Hochschulleitung und Entscheidungsgremien vorgeschlagen.
Wie wird die Stärkung der Hochschulautonomie bewertet?
Die Stärkung der Hochschulautonomie wird grundsätzlich positiv bewertet, insbesondere bei Professorenberufungen und der Gestaltung von Studiengängen. Kritisiert wird jedoch die Bündelung von Entscheidungsbefugnissen beim Präsidium und Hochschulrat, die zu Machtkonzentration und einem Angriff auf die demokratische Hochschulautonomie führt. Eine Rückverlagerung wichtiger Entscheidungen an den Senat und eine dezentrale, fakultätsbasierte Ausübung des Berufungsrechts wird gefordert.
Welche Kritikpunkte werden an der Bean- tragung von Strukturänderungen nach §4 ThürHG geäußert?
Die Möglichkeit der Hochschulleitung, Strukturänderungen über die gesetzlichen Vorgaben hinaus zu beantragen, wird kritisiert. Solche Entscheidungen sollten in der Verantwortung des Senats liegen. Die Autorin verweist auf ein Beispiel, in dem der Antrag des Hochschulrats nur teilweise genehmigt wurde. Eine bessere Ausgestaltung des Gesetzes wird gefordert, um den Hochschulen mehr Autonomie und Planungssicherheit zu ermöglichen.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Analyse?
Schlüsselwörter sind Hochschulautonomie, Hochschulstruktur, Entscheidungsbefugnisse, Rektorat, Senat, Fakultätsgremien, Professorenberufungen, Hochschulmanagement, LUBOM-Modell, Mittelvergabe, Thüringer Hochschulgesetz (ThürHG), Demokratisierung der Hochschule, Wettbewerbsdruck und Planungssicherheit.
Welche Kapitel sind im Text enthalten?
Der Text beinhaltet Kapitel zur Neuordnung der Hochschulstruktur, zur Stärkung der Hochschulautonomie und zur Bean- tragung von Strukturänderungen nach §4 ThürHG über die Vorgaben des Gesetzes hinaus.
Welche Zielsetzung verfolgt die Analyse?
Die Zielsetzung ist die Analyse der Auswirkungen der Novellierung des Thüringer Hochschulgesetzes auf die Hochschulautonomie und die Hochschulstruktur, inklusive der Bewertung der erreichten Reformziele und der Auswirkungen auf Entscheidungsfindungsprozesse und Akzeptanz innerhalb der Hochschulen.
- Quote paper
- Maik Gerstner (Author), 2011, Entwicklung der Demokratie - Demokratiedefizite an Thüringer Hochschulen und Lösungsansätze zu deren Überwindung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/182162