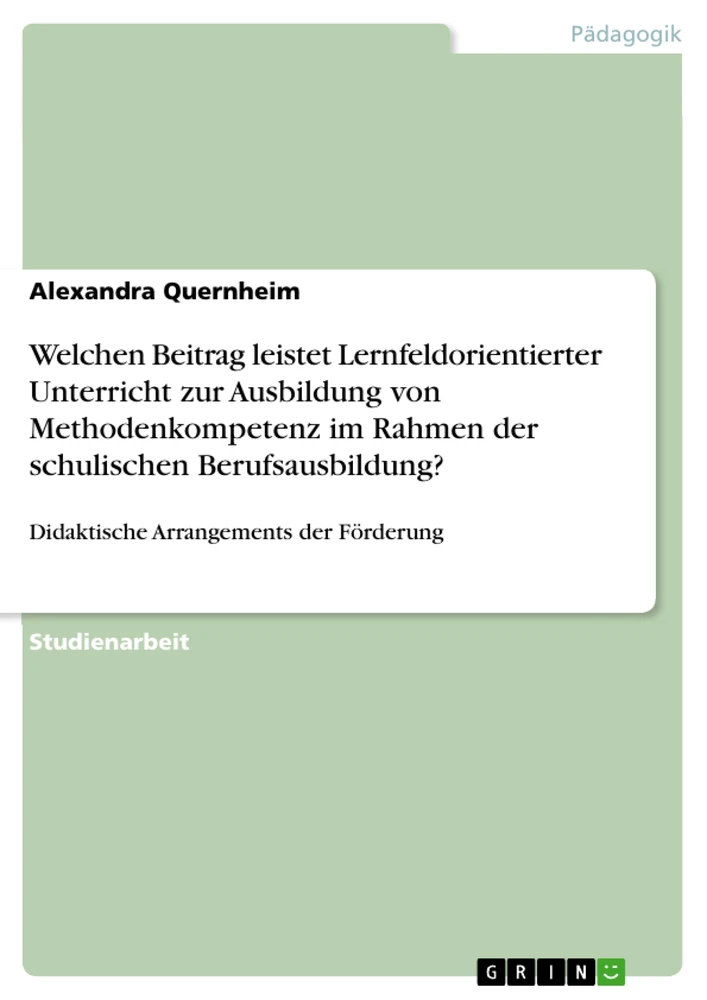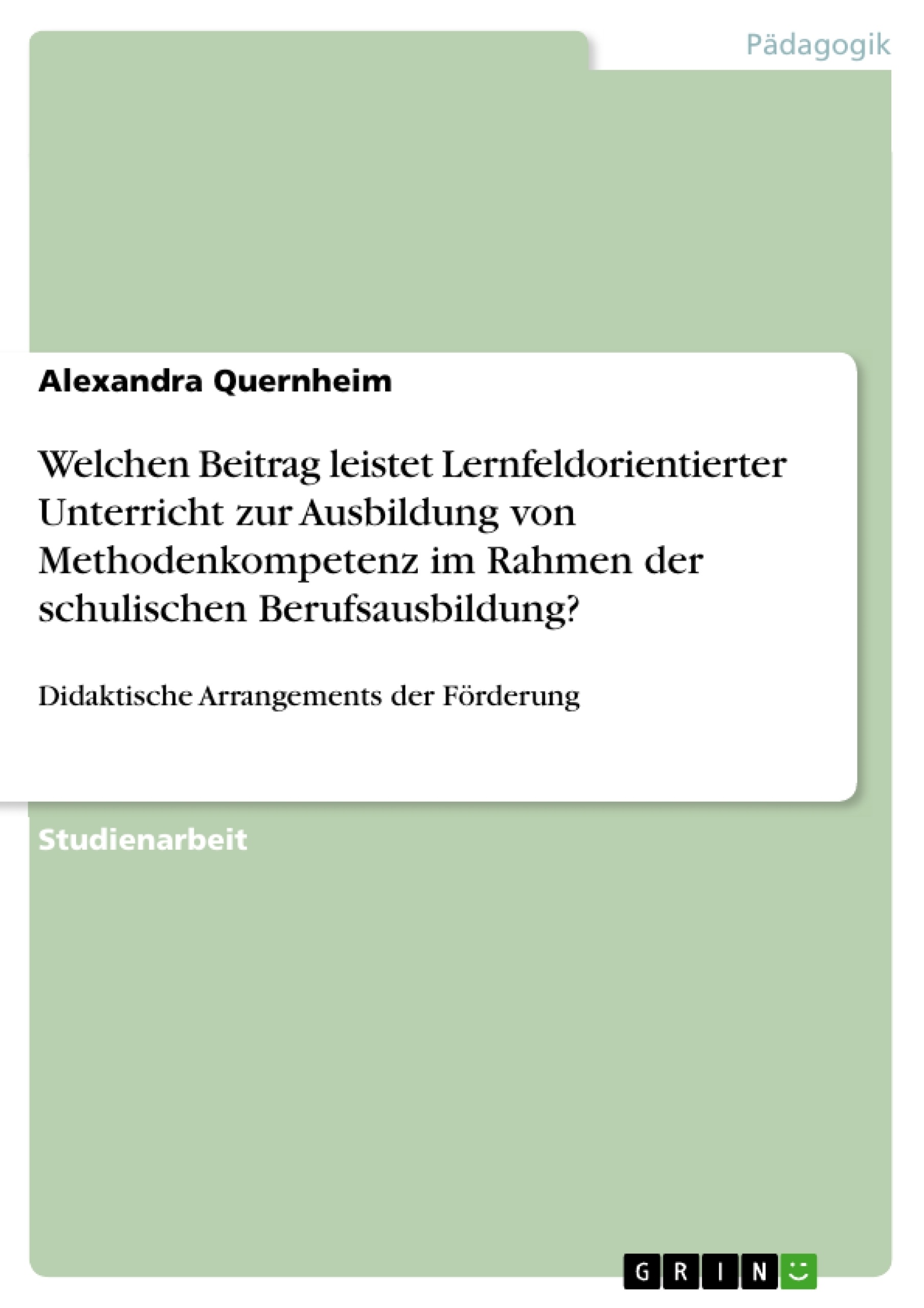Die Arbeit soll darstellen, in wie fern der lernfeldorientierte Unterricht Möglichkeiten zum Erwerb oder zur Steigerung von Methodenkompetenz der Schülerinnen und Schüler an Berufsschulen bieten kann.
Hierzu werden ausgewählte Unterrichtsmehtoden aus dem Bereich der Mirko- und Makromethoden beispielhaft betrachtet, indem ihre grundlegende Funktionsweisen und praktischen Umsetzungen im Unterricht skizziert dargestellt werden. Dabei werde die förderlichen Aspekte des Lernfeldkonzeptes zur Ausbildung von Methodenkompetenz im Rahmen der jeweiligen Methode erörtert.
Vorab werden die Grundstrukturen des Lernfeldkonzeptes und dessen Ziele herausgestellt. Als Inbegriff der Ziele gilt die Förderung von Handlungskompetenz, sowie die darin verortete Methodenkompetenz deren Indikatioren herausgestellt werden.
Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
1. Einleitung
2. Das Lernfeld-Konzept
2.1. Zielformulierungen im Lernfeldkonzept
2.2. Inhalte des Lernfeldkonzeptes
3. Die Methodenkompetenz als Teilbereich der Handlungskompetenz
3.1. Ziele und Bedeutung von Methodenkompetenz
3.2. Möglichkeiten der Förderung von Methodenkompetenz
4. Didaktische Arrangements im lernfeldorientierten Unterricht - Beispiele zur Förderung von Methodenkompetenz
4.1. Beispiel 1 -Die Schülerfirma als übergreifende Methode
4.2. Beispiel 2 - Die Mind-Mapping-Methode Mikromethode als unterstützende Methode im lernfeldorientierten Unterricht
5. Was leistet das Lernfeldkonzept zur Ausbildung von Methodenkompetenz?
5.1. Möglichkeiten bei der Methode der Schülerfirma
5.2. Möglichkeiten bei der Methode des Mind-Mapping
6. Fazit
Literaturverzeichnis
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel von lernfeldorientiertem Unterricht?
Das Hauptziel ist die Förderung der umfassenden Handlungskompetenz der Schüler, die sich in Fach-, Sozial- und Methodenkompetenz unterteilt.
Wie wird Methodenkompetenz in der Berufsschule definiert?
Methodenkompetenz ist die Fähigkeit, Arbeitsschritte selbstständig zu planen, Probleme strukturiert zu lösen und Informationen eigenständig zu beschaffen und auszuwerten.
Welche Rolle spielt die "Schülerfirma" als Methode?
Die Schülerfirma dient als Makromethode, in der berufliche Prozesse realitätsnah abgebildet werden, was den Erwerb vielfältiger Methodenkompetenzen begünstigt.
Wie unterstützt Mind-Mapping den Lernprozess?
Als Mikromethode hilft Mind-Mapping den Schülern, komplexe Inhalte in Lernfeldern zu strukturieren und Zusammenhänge visuell darzustellen.
Was sind didaktische Arrangements?
Dies sind gezielt gestaltete Lernumgebungen, die so konzipiert sind, dass Schüler aktiv und handlungsorientiert an praxisnahen Aufgaben arbeiten können.
Warum ist Methodenkompetenz für die berufliche Zukunft wichtig?
In einer sich schnell wandelnden Arbeitswelt ermöglicht sie es Fachkräften, sich neues Wissen eigenständig anzueignen und flexibel auf neue Herausforderungen zu reagieren.
- Citation du texte
- Alexandra Quernheim (Auteur), 2010, Welchen Beitrag leistet Lernfeldorientierter Unterricht zur Ausbildung von Methodenkompetenz im Rahmen der schulischen Berufsausbildung?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/182303