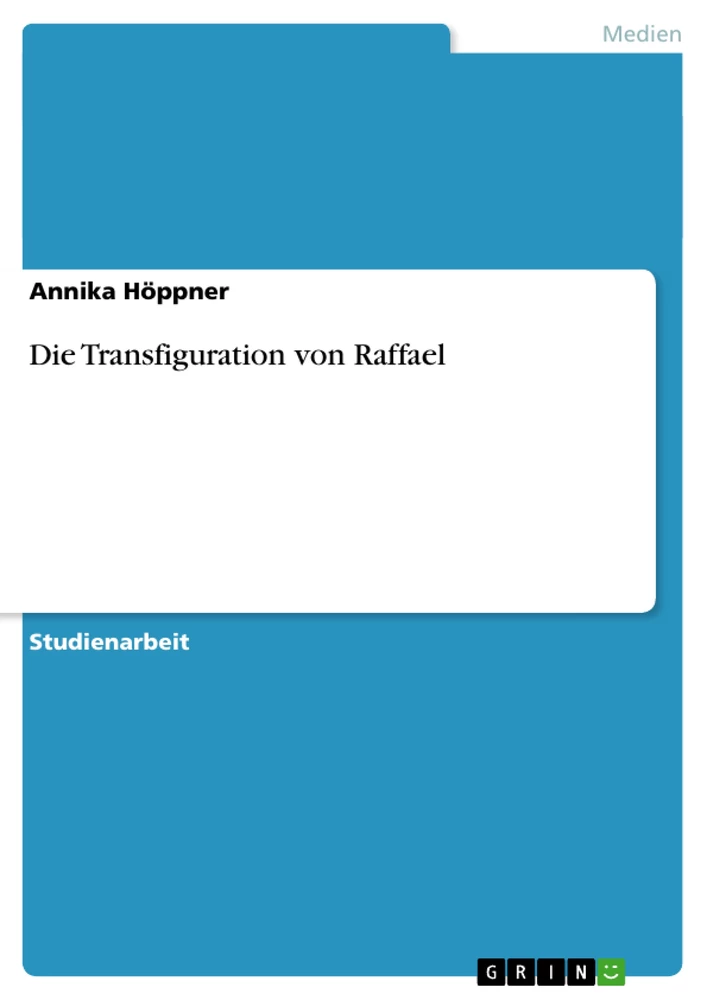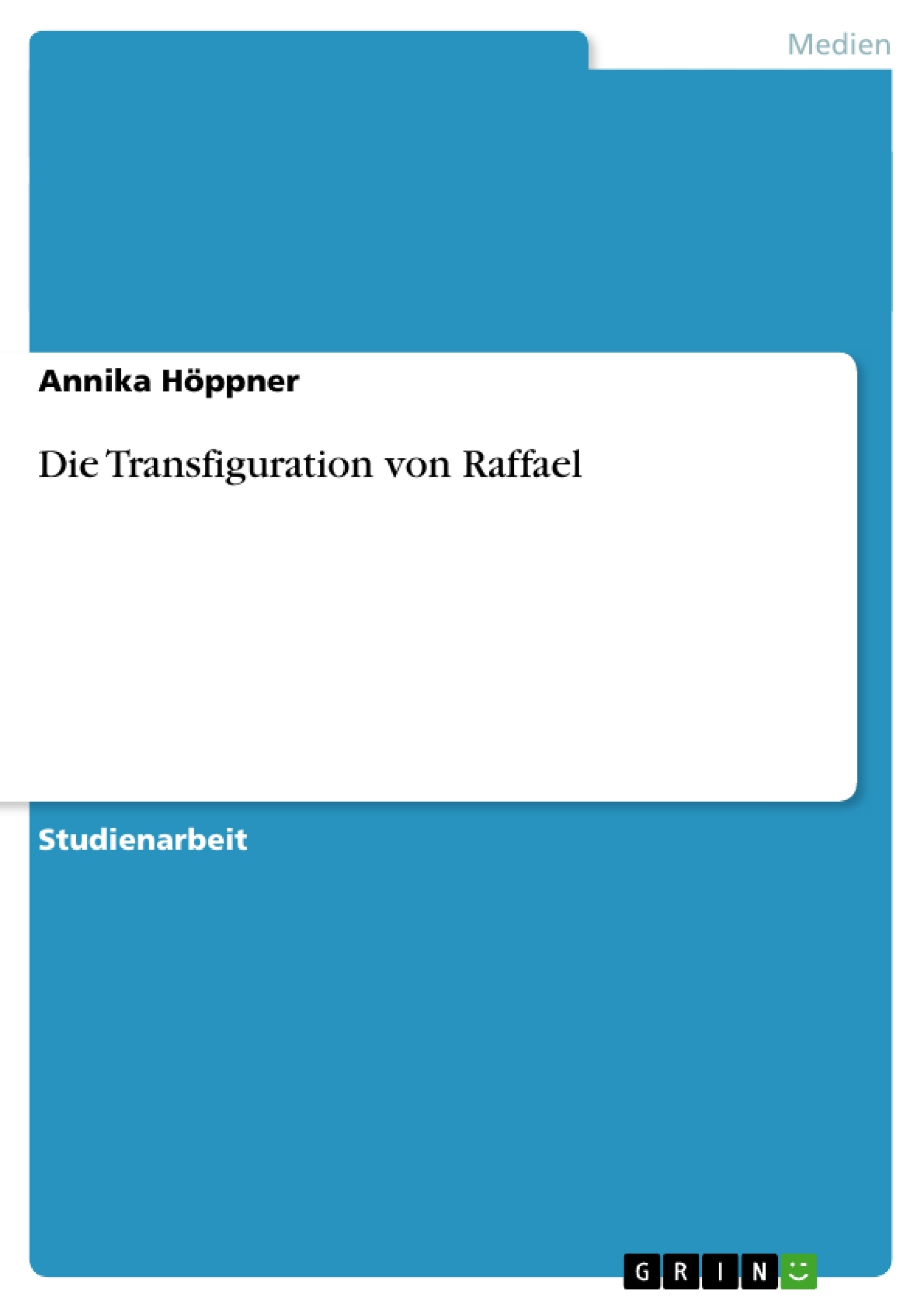[...] Hier sollte wohl laut Preimesberger mit Michelangelos
skulpturalem Figurenbegriff und seinem geistigen „disegno“ und Sebastianos
venezianischen, sinnlich schmückenden „colore“ vollkommende Malerei gegen
Raffael aufgebaut werden.2 Und Oberhuber sieht den Vorteil eines Wettbewerbes
darin, dass sich der Auftraggeber durch diesen Wettstreit eher sicher sein konnte,
dass der vielbeschäftigte Raffael die Planung und Ausführung selber übernehmen
würde, da es um seinen Ruf ging.3
Seit Januar 1517 kann man in Briefen das Rivalitätsklima, in dem die Bilder
entstanden, ablesen. Sebastiano habe im Geheimen gemalt und Raffael habe mit der
Ausführung gewartet, bis Sebastianos Werk im Oktober 1518 fertig und inoffiziell zu
besichtigen gewesen sei. Er begann also nach Sebastiano erst im Juli 1518 mit ersten
Schritten. Seine Ausführung ist wie eine offene Kritik an Sebastianos Figurenfülle
und dem kolossalen Maßstab der Hauptfiguren zu lesen. Raffaels Figuren sind
feingliedriger und entsprechen so Albertis polemischen Satz, die Aufgabe der
Malerei sei nicht der Koloss, sondern die Historie. Erst nach Raffaels Tod am 6.April
1520 konnten beide Bilder gemeinsam besichtigt werden.4
Zunächst werde ich nun einen kurzen Überblick über den aktuellen
Forschungsstand geben und im Anschluss daran eine der frühesten Quellen, Vasaris
„Le Vite“ zur „Verklärung“ und zur „Erweckung des Lazarus“ zitieren. Dann wird
es um die Frage nach dem Auftraggeber, der Datierung, des Bestimmungsortes und
der weiteren Provenienz gehen. Nach dem Zitieren der von Raffael umgesetzten
Bibelstelle, werde ich zeigen, wie sehr es Raffael um eine wahrheitsgetreue
Wiedergabe dieser ging. Dieses versucht er auch formal zu unterstreichen, wie ich
zeigen werde. Dann wird es um den Entstehungsprozess der „Verklärung“ gehen
und eine ikonographische Einordnung, die Raffaels Werk als absolute Neuheit, sowohl im Vergleich mit Vorgängern als auch in seinem eigenem Werk, zeigt. Zum
Schluss werde ich verschiedene Deutungsansätze vorstellen und am Bildmaterial
überprüfen.
2 ebenda, S. 92-93
3 Oberhuber, Konrad: Raphaels Transfiguration. Stil und Bedeutung, Stuttgart 1982, S. 43; im
Folgenden als: Oberhuber, Raffaels Transfiguration, 1982
4 Preimesberger, Tragische Motive in Raffaels Transfiguration, 1987, S. 94-95
Inhaltsverzeichnis
- A. Einleitung
- A.1. Forschungsstand
- A.2. Quellen
- A.3. Daten
- A.3.1. Bestimmungsort
- A.3.2. Auftraggeber
- A.3.3. Provenienz
- B. Beschreibung
- B.1. Bibelgeschichte
- B.2. Die Umsetzung
- B.3. Formale Struktur
- B.3.1. Kontrast der Komposition und Farben
- B.3.2. Verbindungen
- C. Werkgenese
- C.1. Modello aus der Albertina in Wien
- C.2. Modello aus dem Louvre
- C.3. Ausführung
- D. Ikonographie
- D.1. Ikonographische Tradition
- D.2. Mögliche Begründungen, warum Raffael mit der ikonographischen Tradition bricht
- D.2.1. Künstlerische Entwicklung
- D.2.2. Künstlerische Entwicklung
- D.2.2.1. Kontraste, dramatische Effekte
- D.2.2.2. Antithetische Darstellungen
- D.2.2.3. Bündelung von Narration
- E. Deutung
- E.1. Bildhafte Ebene: Poetische
- E.2. Historisch-narrative Ebene
- E.2.1. Mediceische
- E.2.2. Politische: allusiver, zeitgeschichtlicher Sinn
- E.2.3. Theologische: Primatus des Papstes
- E.2.4. Liturgische Deutung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit analysiert Raffaels Altarbild „Die Verklärung“, entstanden zwischen 1516 und 1520, unter Berücksichtigung des Entstehungskontextes, der ikonographischen Tradition und verschiedener Deutungsansätze. Es wird der Forschungsstand beleuchtet und Vasaris Bericht als wichtige Quelle herangezogen. Der Fokus liegt auf der Komposition, der formalen Struktur, und der Bedeutung des Werkes im Kontext der Kunstgeschichte.
- Die Entstehung der „Verklärung“ im Kontext eines Wettbewerbs mit Sebastiano del Piombo.
- Analyse der formalen Struktur und Komposition des Bildes.
- Ikonographische Einordnung und Vergleich mit der Tradition.
- Deutungsansätze auf bildhafter, historisch-narrativer, theologischer und liturgischer Ebene.
- Die Frage nach Raffaels Eigenhändigkeit und der Einheit der Bildkomposition.
Zusammenfassung der Kapitel
A. Einleitung: Diese Einleitung führt in das Thema der Hausarbeit ein, indem sie Raffaels „Verklärung“ als letztes und größtes Tafelbild vorstellt und den Entstehungskontext im Wettbewerb mit Sebastiano del Piombo beleuchtet. Sie skizziert den Aufbau der Arbeit, der den Forschungsstand, Quellen, Daten zum Bild, Beschreibung, Werkgenese, Ikonographie und schließlich Deutungsansätze umfasst. Die Einleitung hebt die Bedeutung des Werks und die Herausforderungen der Interpretation hervor.
A.1. Forschungsstand: Dieses Kapitel behandelt den bisherigen Forschungsstand zur „Verklärung“, insbesondere die Diskussion um Raffaels Eigenhändigkeit, die durch Restaurierungsarbeiten und röntgenologische Untersuchungen bestätigt wurde. Die unterschiedlichen Lichtverhältnisse und Farbnuancen im Bild werden nicht mehr als Zeichen von Fremdhänden, sondern als Ausdruck von Raffaels künstlerischer Meisterschaft interpretiert. Es werden offene Fragen zur genauen Aufstellung im ursprünglichen Bestimmungsort und die Schwierigkeiten der Identifizierung der dargestellten Apostel angesprochen.
A.2. Quellen: Dieser Abschnitt zitiert und analysiert Vasaris Beschreibung der „Verklärung“ in den „Le Vite“, die das Bild als Raffaels göttlichstes Werk preist und die Entstehung im Kontext des Wettbewerbs hervorhebt. Vasaris detaillierte Beschreibung der Figuren und die anekdotische Darstellung seines Todes im Zusammenhang mit dem Werk unterstreichen die Bedeutung, die Vasari dem Bild beimisst. Der Abschnitt beinhaltet auch eine Erwähnung von Sebastianos Konkurrenzbild und dem daraus resultierenden Rivalitätsklima.
B. Beschreibung: Dieses Kapitel beschreibt das Bild selbst, beginnend mit der Darstellung der biblischen Geschichte und ihrer Umsetzung durch Raffael. Es analysiert die formale Struktur, insbesondere den Kontrast der Komposition und Farben sowie die Verbindungen zwischen den beiden Hauptszenen. Die Beschreibung legt den Fokus auf die künstlerischen Mittel, die Raffael zur Darstellung des Themas einsetzt.
C. Werkgenese: Dieses Kapitel beleuchtet den Entstehungsprozess der „Verklärung“, indem es auf Vorstudien (Modelli) aus der Albertina in Wien und dem Louvre eingeht und die Ausführung des endgültigen Bildes beschreibt. Es analysiert die verschiedenen Phasen der Entstehung und die künstlerischen Entscheidungen Raffaels während des Prozesses.
D. Ikonographie: Dieser Abschnitt befasst sich mit der ikonographischen Tradition der Verklärung Christi und analysiert, inwiefern Raffael diese Tradition aufgreift und gleichzeitig bricht. Es werden mögliche Gründe für Raffaels Abkehr von traditionellen Darstellungsweisen erörtert. Das Kapitel untersucht die künstlerische Entwicklung und deren Einfluss auf die Komposition, die dramatischen Effekte und die antithetischen Darstellungen im Bild.
Schlüsselwörter
Raffael, Verklärung, Transfigurazione, Altarbild, Sebastiano del Piombo, Wettbewerb, Ikonographie, Komposition, Deutung, Medici, Renaissancemalerei, Bibelgeschichte, Forschungsstand, Vasari.
Häufig gestellte Fragen zur Hausarbeit: Raffaels "Verklärung"
Was ist der Gegenstand dieser Hausarbeit?
Die Hausarbeit analysiert Raffaels Altarbild "Die Verklärung" (1516-1520). Sie untersucht den Entstehungskontext, die ikonographische Tradition, verschiedene Deutungsansätze und den Forschungsstand zum Bild. Ein besonderer Fokus liegt auf Komposition, formaler Struktur und Bedeutung des Werks in der Kunstgeschichte.
Welche Themen werden in der Hausarbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: die Entstehung der "Verklärung" im Kontext eines Wettbewerbs mit Sebastiano del Piombo; die formale Struktur und Komposition des Bildes; die ikonographische Einordnung und der Vergleich mit der Tradition; Deutungsansätze auf bildhafter, historisch-narrativer, theologischer und liturgischer Ebene; und die Frage nach Raffaels Eigenhändigkeit und der Einheit der Bildkomposition.
Welche Quellen werden verwendet?
Eine wichtige Quelle ist Vasaris Bericht in den "Le Vite", der das Bild als Raffaels göttlichstes Werk preist und die Entstehung im Kontext des Wettbewerbs mit Sebastiano del Piombo beschreibt. Die Hausarbeit bezieht sich auch auf den bisherigen Forschungsstand, inklusive Restaurierungsarbeiten und röntgenologischer Untersuchungen.
Wie ist die Hausarbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Abschnitte: Einleitung (mit Forschungsstand, Quellen und Daten zum Bild), Beschreibung des Bildes (Bibelgeschichte, Umsetzung, formale Struktur), Werkgenese (Modelli, Ausführung), Ikonographie (ikonographische Tradition, Raffaels Bruch mit der Tradition), und Deutung (bildhafte, historisch-narrative, theologische und liturgische Ebenen).
Welche Aspekte der "Verklärung" werden im Detail analysiert?
Die Analyse umfasst die Komposition und die formale Struktur des Bildes (Kontrast von Komposition und Farben, Verbindungen zwischen den Szenen), die ikonographische Tradition und Raffaels Abkehr davon (künstlerische Entwicklung, dramatische Effekte, antithetische Darstellungen), sowie verschiedene Deutungsebenen (poetische, historisch-narrative, theologische und liturgische).
Was sind die wichtigsten Ergebnisse der Hausarbeit?
Die Hausarbeit beleuchtet den Entstehungskontext der "Verklärung", analysiert die Komposition und die ikonographischen Besonderheiten des Bildes, und untersucht verschiedene Deutungsansätze. Sie trägt zum Verständnis von Raffaels künstlerischer Entwicklung und der Bedeutung des Werkes im Kontext der Renaissancemalerei bei.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Hausarbeit?
Schlüsselwörter sind: Raffael, Verklärung, Transfigurazione, Altarbild, Sebastiano del Piombo, Wettbewerb, Ikonographie, Komposition, Deutung, Medici, Renaissancemalerei, Bibelgeschichte, Forschungsstand, Vasari.
- Quote paper
- Annika Höppner (Author), 2003, Die Transfiguration von Raffael, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/18238