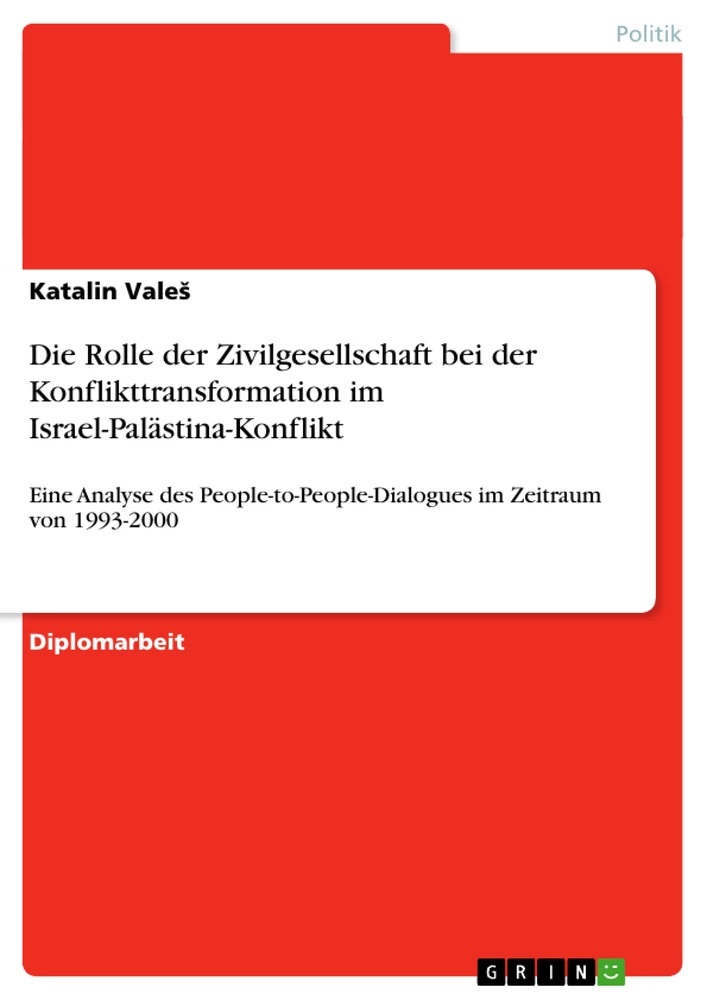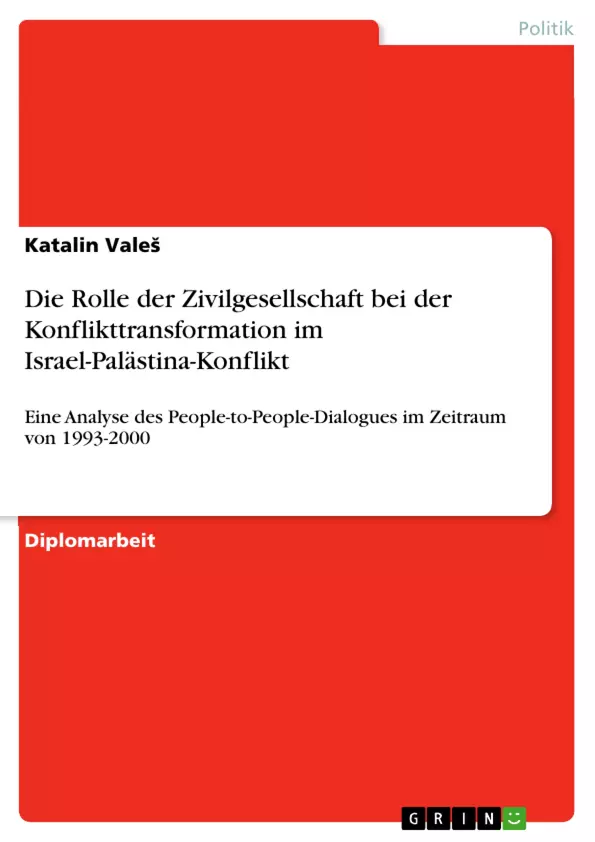Der israelisch-palästinensische Konflikt zwischen jüdischen Israelis und muslimischen Ara-bern ist tief verwurzelt. Die Fronten zwischen den Konfliktparteien sind so stark verhärtet, dass einige Autoren diesen Konflikt bereits als unlösbar eingestuft haben (vgl. Aharoni 2007, S. 264). Zahlreiche Versuche, den Konflikt zu befrieden, sind bislang gescheitert. Umso größer waren die Hoffnungen, die auf das Konfliktlösungspotenzial der Zivilgesellschaft gesetzt wurden. Durch die Osloer Friedensabkommen von 1993 und 1995 wurden Israelis und Palästinenser dazu ermuntert, einander kennenzulernen und Beziehungen zueinander aufzubauen. Die Hoffnung bestand darin, ein friedensförderndes und positives Grundklima in beiden Gesellschaften zu schaffen, das sich wiederum auf die politische Führungsebene niederschlagen sollte, um auf lange Sicht gesehen ein friedliches Miteinander zu ermöglichen.
Der Zivilgesellschaft wird in der Literatur eine nicht unbedeutende Rolle zugeschrieben, wenn es darum geht, tiefe Konflikte in eine positive Richtung zu transformieren (vgl. Kahanoff und Salem 2007, S. 10 -11. Doch Autoren, die sich mit dem Friedensprozess befassen, untersuchen oft nur die großen Meilensteine in Form offizieller Abkommen und weniger die Zivilgesellschaft (vgl. Beck 2003; Hassassian und Kaufmann o.J.; Shlaim 2005). In Anbetracht der Komplexität des Konflikts, die in der Vielschichtigkeit der Interessen, in der Dauer, in der Vielzahl der Akteure begründet liegt, ist bereits die Beantwortung der Frage nach Akteuren und Interessen eine Herausforderung und ist die Vernachlässigung der Zivilgesellschaft sehr wohl nachvollziehbar. Doch greifen Erläuterungen, die lediglich die politische Führungsebene einbeziehen, zu kurz, wenn es darum geht, einen Gesamtüberblick zu erhalten. Die vorliegende Arbeit widmet sich vor dem Hintergrund des Israel-Palästina-Konflikts der Beantwortung der Frage, welche Rolle die Zivilgesellschaft bei der Transformation des Konflikts zwischen Israel und Palästina gespielt hat. Mithilfe der Analyse des People-to-People-Dialogues soll die Untersuchung dazu beitragen, die beschriebene Forschungslücke wenn möglich zu verkleinern. Im Gegensatz zu Government-to-Government-Verhandlungen (Verhandlungen zwischen Regierungen) konzentriert sich der People-to-People-Ansatz auf die zivilgesellschaftliche Komponente in Konflikten.
Inhaltsverzeichnis
- Darstellungsverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis
- Vorwort
- Teil A EINLEITUNG
- Einleitung
- Einführung
- Fragestellung und Ziel der Arbeit
- Methode
- Begründung des Untersuchungszeitraumes
- Einleitung
- TEIL B - THEORETISCHE GRUNDLAGEN DES P2P
- Überblick über die theoretischen Konzepte des P2P
- Zugrunde liegendes Konfliktverständnis
- Allgemeine Begriffserklärung des Konfliktes
- Verhältnis der Konfliktparteien zueinander
- Zivilgesellschaft als theoretische Grundlage für den P2P
- Normative Ausrichtung von Zivilgesellschaft
- Bezugsrahmen von Zivilgesellschaft
- Nahöstliche Debatte von Zivilgesellschaft
- P2P als Werkzeug der Zivilgesellschaft
- P2P innerhalb ziviler Konfliktbearbeitung
- Peacebuilding mittels des People-to-People-Dialogues
- Bedeutung von Konflikttransformation für den P2P
- Strategien der Konflikttransformation
- Verständnis von Dialog als Methode für den P2P
- Wirkungsebenen des zivilgesellschaftlichen Dialogs
- P2P innerhalb der vorgestellten theoretischen Konzepte
- Überblick
- Kontext
- Konflikt zwischen Israel und Palästina
- Politische Meilensteine im Untersuchungszeitraum
- Zivilgesellschaft Israel
- Besonderheiten der israelischen Zivilgesellschaft in Israel
- Gesellschaftsstruktur Israels
- Entwicklung der israelischen Zivilgesellschaft
- Einstellung der Zivilgesellschaft zum Friedensprozess
- Akteure der israelischen Zivilgesellschaft
- Zivilgesellschaft in Palästina
- Besonderheiten der palästinensischen Zivilgesellschaft
- Gesellschaftsstruktur Palästinas
- Entwicklung der Zivilgesellschaft in Palästina
- Akteure der palästinensischen Zivilgesellschaft
- Zivilgesellschaftliche Akteure Israels und Palästinas im Vergleich
- People-to-People-Dialogue zwischen Israel und Palästina
- Rechtlicher Rahmen
- Ziele des zivilgesellschaftlichen Dialogs
- People-to-People-Aktivitäten im Zeitraum von 1993-2000
- Beispiele für P2P-Aktivitäten
- Zivilgesellschaftliche Aktivitäten auf Ebene von Track Two
- Zivilgesellschaftliche Aktivitäten auf Ebene von Track Three
- Zivilgesellschaftliche Aktivitäten auf Ebene von Track Four
- Zivilgesellschaftliche Aktivitäten auf Ebene von Track Five
- Zivilgesellschaftliche Aktivitäten auf Ebene von Track Six
- Zivilgesellschaftliche Aktivitäten auf Ebene von Track Seven
- Zivilgesellschaftliche Aktivitäten auf Ebene von Track Eight
- Zivilgesellschaftliche Aktivitäten auf Ebene von Track Nine
- Finanzierung der People-to-People-Dialogue-Projekte
- Allgemeines
- Kontraproduktiver Einfluss der Geldgeber
- Grundproblematik
- Fehlende Unterstützung durch die politische Führungsebene
- Fehlende übergeordnete Strategie
- Negative Auswirkungen der Besatzung auf P2P-Aktivitäten
- Auswirkungen der Besatzung auf den P2P am Beispiel der Bewegungsfreiheit
- Die Folgen asymmetrischer Machtverhältnisse für den P2P
- Der Einfluss asymmetrischer Verhältnisse auf die Umsetzung des P2P
- Einfluss asymmetrischer Verhältnisse auf P2P-Teilnehmer
- Einfluss asymmetrischer Verhältnisse auf die Motivation der Akteure
- Unterschiedliche Erwartungen und Motivation
- Palästinensische Erwartungen und Motivationen für die Teilnahme am P2P
- Israelische Erwartungen und Motivationen für die Teilnahme am P2P
- Beeinträchtigung des P2P durch mangelhafte Dialogkultur
- Sprachbarrieren
- Unüberwindbare Konfliktnarrative
- Exkurs: Konträre Narrative am Beispiel der Staatsgründung Israels
- Kontraproduktive Auswirkung des sozialen Umfeldes auf P2P
- Einfluss des sozialen Umfeldes auf palästinensische P2P-Aktivisten
- Einfluss des sozialen Umfeldes auf israelische P2P-Aktivisten
- Fehlende Breitenwirkung des P2P
- Fehlende Nachhaltigkeit der P2P-Projekte
- Fehlende mediale Öffentlichkeit
- Gründe für das Scheitern des P2P
- Fazit der Auswertung
- Ausblick auf die künftige Entwicklung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit analysiert die Rolle der Zivilgesellschaft bei der Konflikttransformation im Israel-Palästina-Konflikt. Der Fokus liegt dabei auf dem People-to-People-Dialogue (P2P) im Zeitraum von 1993 bis 2000. Die Arbeit untersucht, inwiefern der P2P als Werkzeug der Zivilgesellschaft zur Konflikttransformation beitragen konnte und welche Faktoren zu seinem Scheitern geführt haben.
- Die Rolle der Zivilgesellschaft bei der Konflikttransformation
- Der People-to-People-Dialogue als Werkzeug der Zivilgesellschaft
- Die Herausforderungen der Konflikttransformation im Israel-Palästina-Konflikt
- Die Bedeutung von Dialog und Verständigung für die Konfliktlösung
- Die Auswirkungen politischer und struktureller Faktoren auf den P2P
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Diplomarbeit ein und erläutert die Fragestellung, die Zielsetzung und die Methode der Arbeit. Des Weiteren wird der Untersuchungszeitraum begründet.
Teil B der Arbeit befasst sich mit den theoretischen Grundlagen des P2P. Es werden verschiedene Konzepte des P2P vorgestellt und das zugrunde liegende Konfliktverständnis erläutert. Die Rolle der Zivilgesellschaft als theoretische Grundlage für den P2P wird beleuchtet, wobei die normative Ausrichtung, der Bezugsrahmen und die nahöstliche Debatte von Zivilgesellschaft im Vordergrund stehen. Schließlich wird der P2P als Werkzeug der Zivilgesellschaft im Kontext der zivilen Konfliktbearbeitung betrachtet.
Teil C der Arbeit analysiert den P2P zwischen Israel und Palästina im Zeitraum von 1993 bis 2000. Es werden der Kontext des Konflikts, die Besonderheiten der israelischen und palästinensischen Zivilgesellschaft sowie die Ziele und Aktivitäten des P2P im Detail beleuchtet. Die Arbeit untersucht auch die Finanzierung des P2P und die Gründe, warum er als gescheitert gilt.
Teil D der Arbeit wertet die Analyse des P2P aus und identifiziert die Gründe für sein Scheitern. Es werden die politischen und strukturellen Beeinträchtigungen des P2P sowie die Blockierung durch die Zivilgesellschaft selbst analysiert. Die Arbeit schließt mit einem Fazit und einem Ausblick auf die künftige Entwicklung des P2P.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Rolle der Zivilgesellschaft, die Konflikttransformation, den Israel-Palästina-Konflikt, den People-to-People-Dialogue (P2P), Peacebuilding, Dialog, Verständigung, politische und strukturelle Faktoren, Zivilgesellschaftliche Akteure, Track Two Diplomacy, Track Three Diplomacy, Track Four Diplomacy, Track Five Diplomacy, Track Six Diplomacy, Track Seven Diplomacy, Track Eight Diplomacy, Track Nine Diplomacy, Finanzierung, asymmetrische Machtverhältnisse, Besatzung, Konfliktnarrative, Erwartungen, Motivation, Dialogkultur, Sprachbarrieren, soziale Umfeld, Breitenwirkung, Nachhaltigkeit, mediale Öffentlichkeit.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der People-to-People-Dialogue (P2P)?
Der P2P-Ansatz konzentriert sich auf den Dialog zwischen den Zivilgesellschaften verfeindeter Parteien, um Vorurteile abzubauen und ein friedliches Grundklima zu schaffen.
Welche Rolle spielt die Zivilgesellschaft bei der Konflikttransformation?
Die Zivilgesellschaft soll als Akteur fungieren, der durch Begegnungen und gemeinsame Projekte die politische Führungsebene indirekt zu Friedenslösungen motiviert.
Warum gilt der P2P-Dialog im Israel-Palästina-Konflikt (1993-2000) als gescheitert?
Gründe für das Scheitern waren unter anderem fehlende Unterstützung durch die Politik, asymmetrische Machtverhältnisse, Sprachbarrieren und die Auswirkungen der Besatzung.
Was versteht man unter Track-Two-Diplomatie?
Track-Two-Diplomatie bezeichnet inoffizielle Kontakte und Dialoge zwischen Vertretern gesellschaftlicher Gruppen, die parallel zu offiziellen Regierungsverhandlungen stattfinden.
Welchen Einfluss hatten die Geldgeber auf die P2P-Projekte?
Oft hatten externe Geldgeber einen kontraproduktiven Einfluss, da ihre Anforderungen nicht immer mit der Realität vor Ort oder den Bedürfnissen der lokalen Akteure übereinstimmten.
- Quote paper
- Katalin Valeš (Author), 2011, Die Rolle der Zivilgesellschaft bei der Konflikttransformation im Israel-Palästina-Konflikt, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/182426