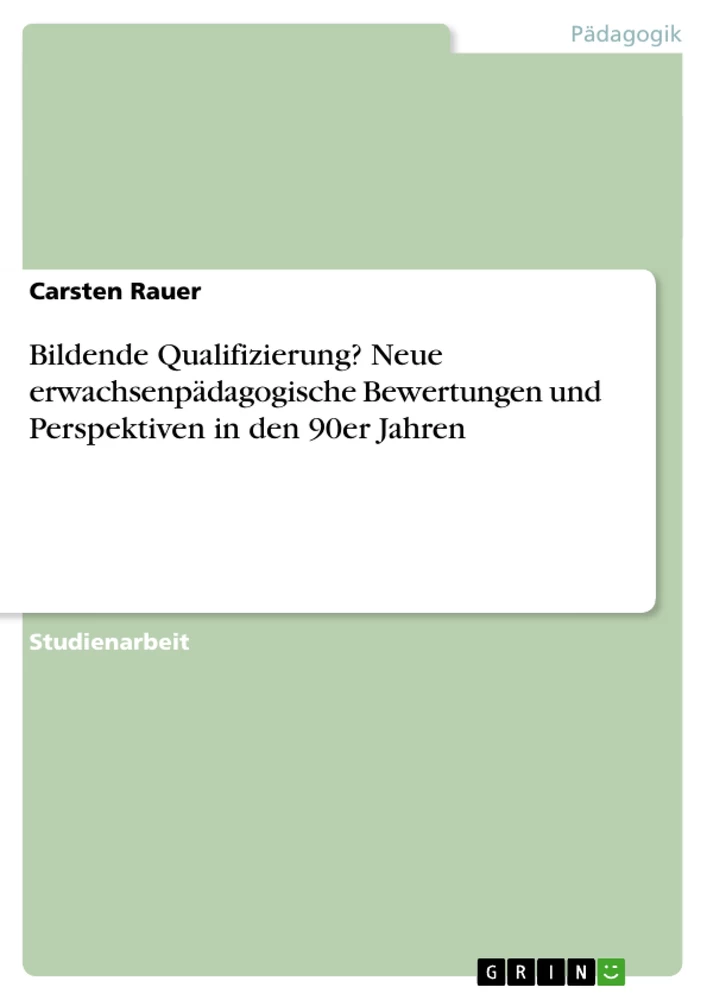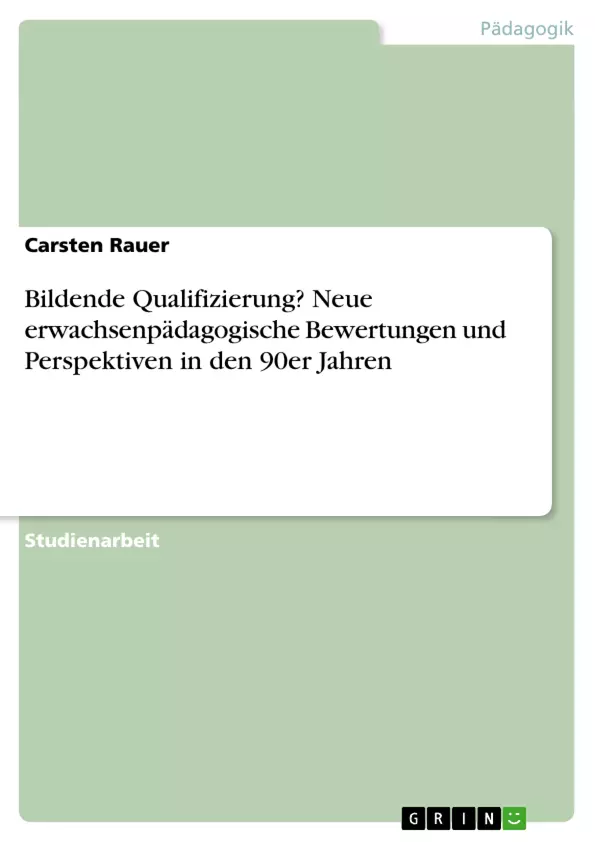In meinem Teil des zu bearbeitenden Referatsthemas beschäftigte ich mich mit dem Begriff der "Schlüsselqualifikation" in der betrieblichen Weiterbildung. Wie sieht das Konzept der Schlüsselqualifikationen aus und welche Relevanz hat es für die betriebliche Weiterbildung? In meinen Aussagen stütze ich mich auf die Ausführungen und Veröffentlichungen von Rolf Arnold. Er betrachtet die Konzepte von Mertens u.a. und bezieht hierzu kritisch Stellung. Ich werde im folgenden näher auf das genannte Konzept eingehen und sowohl die arbeitsmarktpolitischen, als auch die berufspädagogischen Begründungsansätze aufgreifen und beschreiben. Anschließend werde ich aufzeigen, wie das Konzept der Schlüsselqualifikationen umgesetzt werden kann; im letzten Teil meiner Ausführungen gehe ich auf die Bedeutung von Schlüsselqualifizierung für die Unternehmen ein.
Inhaltsverzeichnis
- Inhaltsangabe
- Einleitung
- Das Konzept der Schlüsselqualifikation
- Begründungsansätze
- arbeitsmarktpolitische Begründung
- berufspädagogische Begründung
- Umsetzungsansätze
- Begründungsansätze
- Bedeutung der Schlüsselqualifizierung für ein Unternehmen
- Zusammenfassung
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Das Referat beschäftigt sich mit dem Begriff der Schlüsselqualifikation im Kontext der betrieblichen Weiterbildung. Es untersucht, wie das Konzept der Schlüsselqualifikationen funktioniert und welche Bedeutung es für die betriebliche Weiterbildung hat.
- Definition und Konzept der Schlüsselqualifikation
- Begründungsansätze für die Schlüsselqualifikation (arbeitsmarktpolitisch und berufspädagogisch)
- Umsetzungsansätze für Schlüsselqualifikationen in der Praxis
- Bedeutung von Schlüsselqualifikationen für Unternehmen
- Kritik und Diskussion verschiedener Ansätze zur Schlüsselqualifikation
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung führt den Begriff der Schlüsselqualifikation im Kontext der betrieblichen Weiterbildung ein und skizziert die Relevanz des Themas.
Das Konzept der Schlüsselqualifikation
Dieses Kapitel beleuchtet die Definition von Schlüsselqualifikationen nach Dieter Mertens und diskutiert die Bedeutung des Konzepts als erweiterter Qualifikationsbegriff. Es werden die drei zentralen Bereiche Sachkompetenz, Selbstkompetenz und Sozialkompetenz vorgestellt und die Bedeutung einer umfassenden Qualifikation für die betriebliche Weiterbildung herausgestellt.
Begründungsansätze
Dieser Abschnitt untersucht die Begründungsansätze für die Schlüsselqualifikation in der betrieblichen Weiterbildung, wobei sowohl die arbeitsmarktpolitischen als auch die berufspädagogischen Perspektiven beleuchtet werden. Es werden verschiedene Argumente für die Bedeutung von Schlüsselqualifikationen in der modernen Arbeitswelt aufgezeigt.
Umsetzungsansätze
Dieses Kapitel behandelt verschiedene Umsetzungsansätze für Schlüsselqualifikationen in der betrieblichen Weiterbildung. Es werden konkrete Beispiele für die praktische Anwendung des Konzepts aufgezeigt und die Herausforderungen bei der Umsetzung von Schlüsselqualifikationen in Unternehmen diskutiert.
Bedeutung der Schlüsselqualifizierung für ein Unternehmen
Dieser Abschnitt behandelt die Bedeutung von Schlüsselqualifikationen für Unternehmen im Hinblick auf die Anpassungsfähigkeit an sich verändernde Arbeitsbedingungen und die Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit.
Schlüsselwörter
Schlüsselqualifikation, betriebliche Weiterbildung, Sachkompetenz, Selbstkompetenz, Sozialkompetenz, arbeitsmarktpolitische Begründung, berufspädagogische Begründung, Umsetzungsansätze, Unternehmen, Flexibilität, Wettbewerbsfähigkeit, Qualifikation, Handlungskompetenz, didaktisches Vorgehen.
Häufig gestellte Fragen
Was sind Schlüsselqualifikationen?
Es sind übergeordnete Fähigkeiten wie Sach-, Selbst- und Sozialkompetenz, die über reines Fachwissen hinausgehen und in der Arbeitswelt flexibel einsetzbar sind.
Warum sind diese Qualifikationen für Unternehmen wichtig?
Sie erhöhen die Anpassungsfähigkeit der Mitarbeiter an sich wandelnde Arbeitsbedingungen und steigern somit die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens.
Wer prägte das Konzept der Schlüsselqualifikationen?
Dieter Mertens gilt als einer der Pioniere, dessen Ansätze in der Arbeit kritisch unter Einbeziehung der Ausführungen von Rolf Arnold diskutiert werden.
Was ist die arbeitsmarktpolitische Begründung für dieses Konzept?
Angesichts instabiler Arbeitsmärkte und technologischen Wandels müssen Arbeitnehmer über Kompetenzen verfügen, die sie befähigen, neue Aufgaben schnell zu erlernen.
Wie können Schlüsselqualifikationen in der Praxis umgesetzt werden?
Die Arbeit beschreibt didaktische Vorgehensweisen und Umsetzungsansätze für die betriebliche Weiterbildung, um diese Kompetenzen gezielt zu fördern.
- Quote paper
- Carsten Rauer (Author), 2001, Bildende Qualifizierung? Neue erwachsenpädagogische Bewertungen und Perspektiven in den 90er Jahren, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/18258