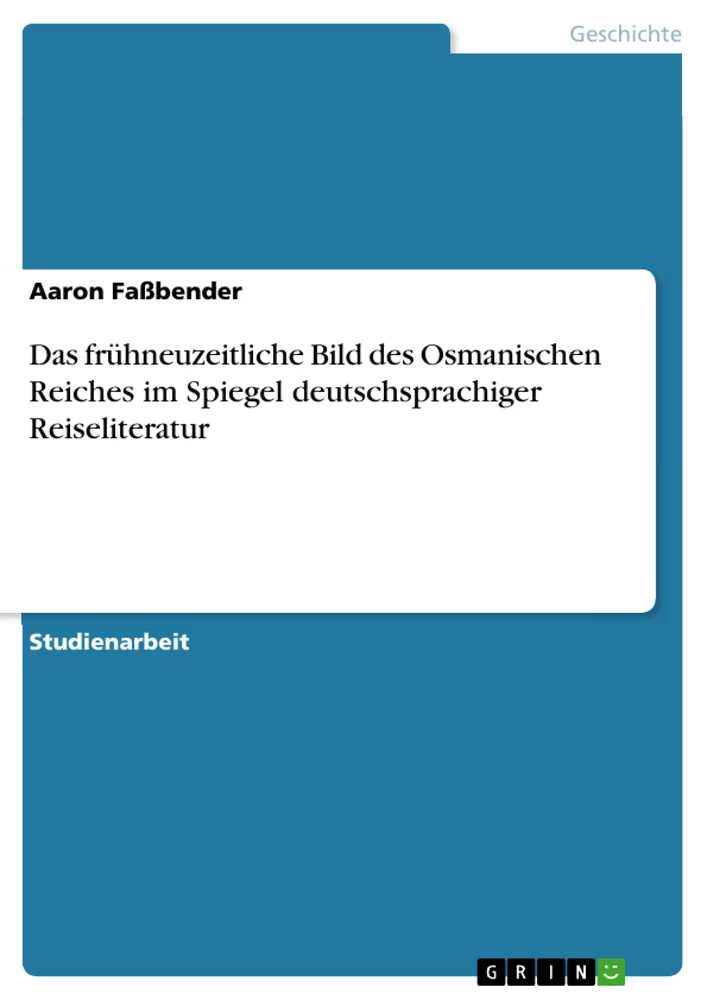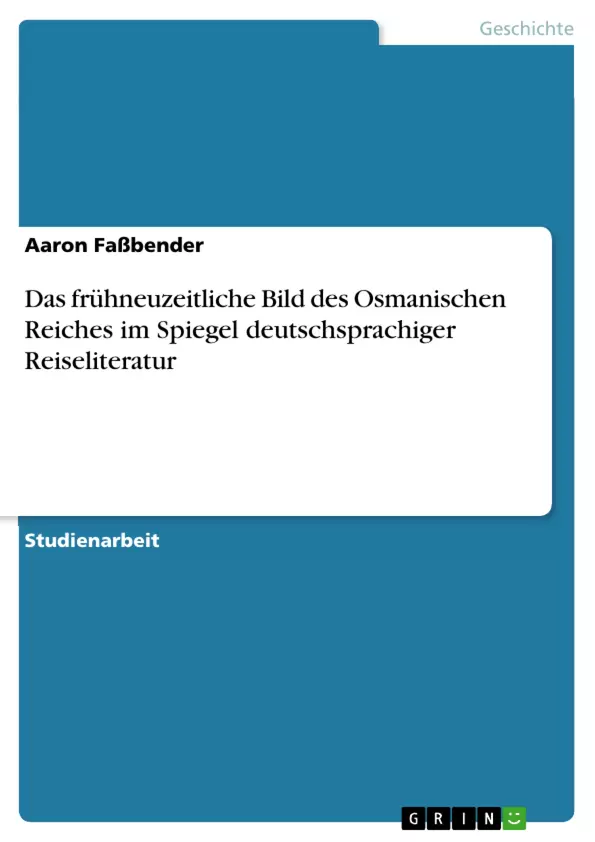"Millesimo sexcentesimo veniet Turcus totam Germaniam devastaturus"
Die Zeilen an der Wand von Luthers Studierstube in Wittenberg verdeutlichen, wie stark ihn die Türkenfrage bewegt haben muss. Die Nachrichten, die die Furcht vor dem Osmanischen Reich auslösten, basierten in erster Linie auf den Newen Zeitungen (Nova) und Reiseberichten. Dass das Interesse an solchen Informationen sehr groß gewesen sein muss, beweisen die hohen Auflagenzahlen der so genannten Turcica jener Zeit.
Die vorliegende Arbeit untersucht das Bild der Türken im Spiegel von deutschsprachigen Reiseberichten der Frühen Neuzeit. Der Grund für die räumliche Eingrenzung auf den deutschsprachigen Raum liegt in der besonderen Konkurrenz zwischen habsburgischer Monarchie und osmanischem Sultanat. [...] Neben der politischen Auseinandersetzung verbreitete sich im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation, unter anderem auf Betreiben Luthers und Melanchtons hin, die chiliastische Ansicht, dass die Türken mit Satan [...] gleichzusetzen seien und ihre Überwindung einen allgemeinen Frieden herbeiführen würde.
Gerade unter diesen konfliktbeladenen Rahmenbedingungen erscheint eine Untersuchung von Faktoren, welche die öffentliche Meinung beeinflusst haben, lohnenswert. Begibt man sich auf die Spur der Erkenntnisse, welche das allgegenwärtige Gefühl, durch das osmanische Reich bedroht zu sein, auslösten, ist es notwendig die Verfasser der Nachrichten aus dem Orient zu untersuchen. Dabei sind die Fragen entscheidend, wie ausgeprägt das Wissen der Autoren über das Osmanische Reich war und ob sie die notwendige Empathie besaßen, um Unbekanntes oder Befremdliches objektiv wiederzugeben. Um diesen Fragen nachzugehen, werden im weiteren Verlauf drei ausgewählte Reiseberichte jener Zeit, bezüglich der Charakterisierung der Osmanen und der Beurteilung des osmanischen Staatsapparates untersucht werden. Die Charakterisierung wird die Beobachtungen, welche der Autor über Wesenszüge, Tugenden und Laster der Bevölkerung gemacht hat einschließen, während die Beurteilung des Staatsapparates, das Herrschaftssystem, die Person des Sultans, sowie Aussagen über die Legitimität des osmanischen Staates einbeziehen wird. Anhand dieser Erkenntnisse werden Tendenzen und Gemeinsamkeiten, aber auch Gegensätzlichkeiten der verschiedenen Reisebeschreibungen herausgestellt werden, welche wiederum einen Einblick in das Bild des Osmanischen Reiches in der "deutschen" Öffentlichkeit der Frühen Neuzeit gewähren
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Fragestellung und historische Relevanz
- Der aktuelle Forschungsstand
- Die Reiseliteratur als historische Quelle
- Die der Arbeit zugrunde liegenden Quellen
- Johannes Schiltberger (1394-1427)
- Hans Dernschwam (1553-1555)
- Salomon Schweigger (1577-1581)
- Die Darstellung der Osmanen in den Reiseberichten
- Das Wesen der osmanischen Bevölkerung im Reisebericht
- Johannes Schiltbergers
- Hans Dernschwams
- Salomon Schweiggers
- Die Herrschaftsform des Osmanischen Reiches
- bei Johannes Schiltberger
- bei Hans Dernschwam
- bei Salomon Schweigger
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Bild des Osmanischen Reiches in deutschsprachigen Reiseberichten der frühen Neuzeit. Der Fokus liegt auf der Analyse der Darstellung der osmanischen Bevölkerung und des Herrschaftssystems in ausgewählten Reiseberichten, um Rückschlüsse auf die öffentliche Meinung im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation zu ziehen. Die Arbeit berücksichtigt den historischen Kontext des Konflikts zwischen der Habsburger Monarchie und dem Osmanischen Reich und die damit verbundene "Türkengefahr".
- Darstellung der osmanischen Bevölkerung in Reiseberichten
- Analyse der Herrschaftsform des Osmanischen Reiches in Reiseberichten
- Einfluss der Reiseberichte auf die öffentliche Meinung im Heiligen Römischen Reich
- Vergleichende Analyse der ausgewählten Reiseberichte
- Die "Türkengefahr" im Kontext der habsburgisch-osmanischen Konflikte
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung etabliert die Forschungsfrage, die sich mit dem Bild des Osmanischen Reiches in deutschsprachigen Reiseberichten der Frühen Neuzeit befasst. Sie verdeutlicht die historische Relevanz des Themas im Kontext des habsburgisch-osmanischen Konflikts und der "Türkengefahr". Der aktuelle Forschungsstand wird beleuchtet, wobei die Arbeiten von Almut Höffert und Carl Göllner hervorgehoben werden. Die Reiseliteratur als historische Quelle wird kritisch diskutiert, ihre Stärken und Schwächen als Quelle für historische Erkenntnisse werden beleuchtet, einschließlich der Problematik der Subjektivität und der potenziellen Verfälschung von Informationen. Schließlich werden die ausgewählten Reiseberichte von Johannes Schiltberger, Hans Dernschwam und Salomon Schweigger vorgestellt und die Methodik der Analyse erläutert.
Die Darstellung der Osmanen in den Reiseberichten: Dieses Kapitel analysiert die Darstellung der osmanischen Bevölkerung und des Herrschaftsystems in den ausgewählten Reiseberichten. Es untersucht, wie die Autoren die osmanische Bevölkerung charakterisierten (ihre Sitten, Tugenden und Laster) und wie sie das osmanische Herrschaftssystem, den Sultan und die Legitimität des Staates beurteilten. Der Vergleich der verschiedenen Reisebeschreibungen soll Gemeinsamkeiten und Unterschiede aufzeigen, um ein umfassendes Bild der öffentlichen Wahrnehmung des Osmanischen Reiches in der frühen Neuzeit zu erhalten.
Schlüsselwörter
Osmanisches Reich, Frühe Neuzeit, deutschsprachige Reiseliteratur, Türkengefahr, Habsburger, Johannes Schiltberger, Hans Dernschwam, Salomon Schweigger, Quellenkritik, öffentliche Meinung, Herrschaftssystem, Bevölkerung, Vergleichende Analyse.
Häufig gestellte Fragen zum Thema "Das Bild des Osmanischen Reiches in deutschsprachigen Reiseberichten der frühen Neuzeit"
Welche Quellen werden in dieser Arbeit verwendet?
Die Arbeit analysiert deutschsprachige Reiseberichte der frühen Neuzeit, insbesondere die Werke von Johannes Schiltberger (1394-1427), Hans Dernschwam (1553-1555) und Salomon Schweigger (1577-1581). Diese Quellen werden kritisch hinsichtlich ihrer Subjektivität und potenziellen Verfälschungen bewertet.
Was ist die zentrale Forschungsfrage der Arbeit?
Die Arbeit untersucht das Bild des Osmanischen Reiches, wie es in deutschsprachigen Reiseberichten der frühen Neuzeit dargestellt wird. Der Fokus liegt auf der Analyse der Darstellung der osmanischen Bevölkerung und des Herrschaftssystems, um Rückschlüsse auf die öffentliche Meinung im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation zu ziehen.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit befasst sich mit der Darstellung der osmanischen Bevölkerung in den Reiseberichten, der Analyse der osmanischen Herrschaftsform, dem Einfluss der Reiseberichte auf die öffentliche Meinung, einem Vergleich der ausgewählten Reiseberichte und der "Türkengefahr" im Kontext der habsburgisch-osmanischen Konflikte.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Hauptkapitel zur Darstellung der Osmanen in den Reiseberichten und einen Schluss. Die Einleitung beinhaltet die Forschungsfrage, den aktuellen Forschungsstand, die Quellenbeschreibung und die Methodik. Das Hauptkapitel analysiert die Darstellung der osmanischen Bevölkerung und des Herrschaftssystems in den ausgewählten Reiseberichten. Der Schluss fasst die Ergebnisse zusammen.
Welche Aspekte der osmanischen Gesellschaft werden untersucht?
Die Arbeit untersucht die Darstellung der osmanischen Bevölkerung, einschließlich ihrer Sitten, Tugenden und Laster, sowie die Darstellung des osmanischen Herrschaftssystems, des Sultans und der Legitimität des Staates in den ausgewählten Reiseberichten.
Welchen historischen Kontext berücksichtigt die Arbeit?
Die Arbeit berücksichtigt den historischen Kontext des Konflikts zwischen der Habsburger Monarchie und dem Osmanischen Reich und die damit verbundene "Türkengefahr".
Welche Methoden werden angewendet?
Die Arbeit verwendet eine vergleichende Analyse der ausgewählten Reiseberichte, um Gemeinsamkeiten und Unterschiede in der Darstellung des Osmanischen Reiches aufzuzeigen und ein umfassendes Bild der öffentlichen Wahrnehmung zu erhalten. Die Quellenkritik spielt eine wichtige Rolle bei der Bewertung der Informationen in den Reiseberichten.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Osmanisches Reich, Frühe Neuzeit, deutschsprachige Reiseliteratur, Türkengefahr, Habsburger, Johannes Schiltberger, Hans Dernschwam, Salomon Schweigger, Quellenkritik, öffentliche Meinung, Herrschaftssystem, Bevölkerung, Vergleichende Analyse.
- Citar trabajo
- M. A. Aaron Faßbender (Autor), 2005, Das frühneuzeitliche Bild des Osmanischen Reiches im Spiegel deutschsprachiger Reiseliteratur, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/182584