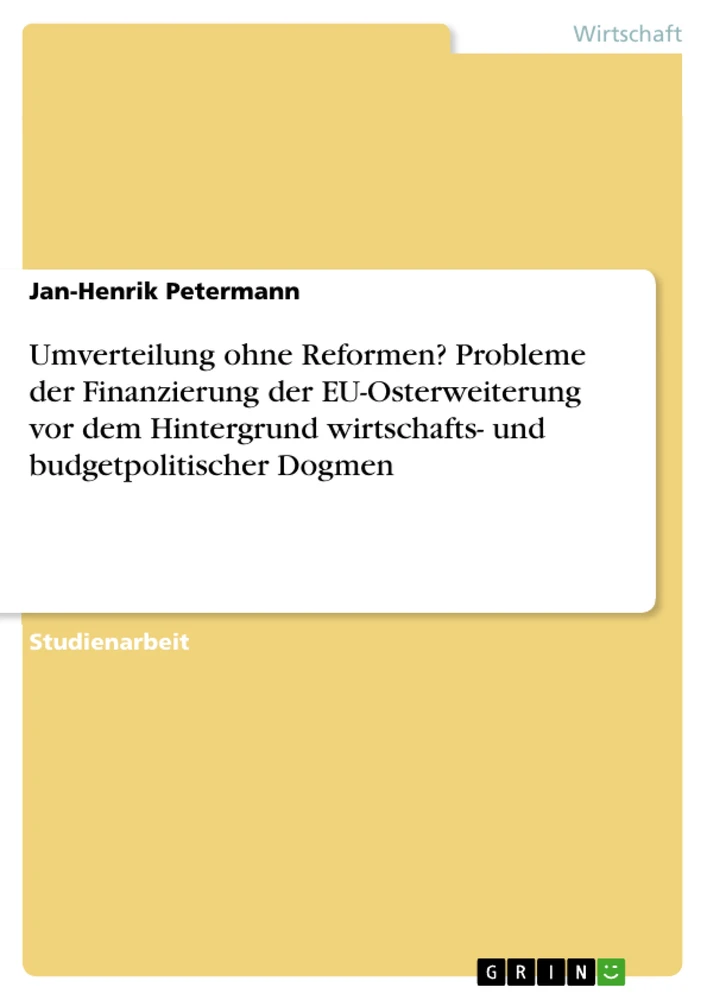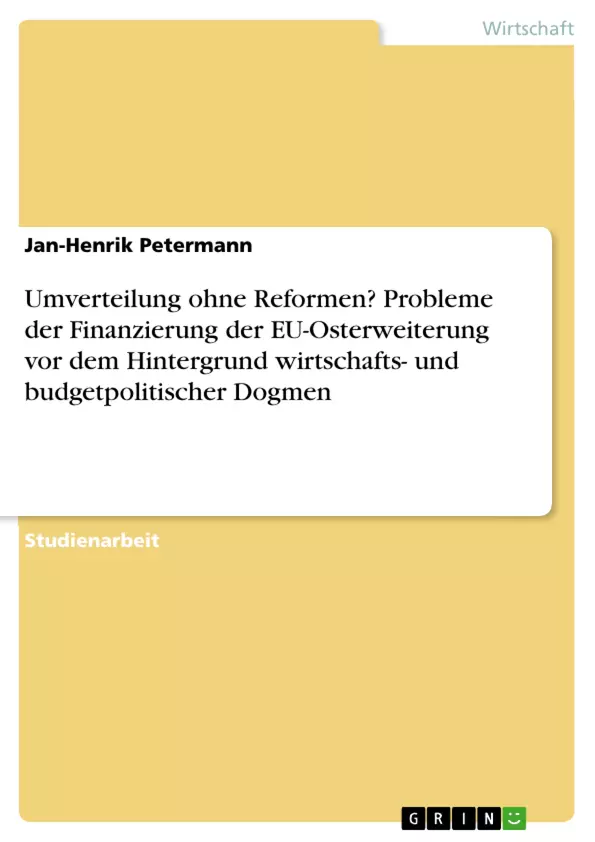Mit der Unterzeichnung der Beitrittsabkommen durch zunächst zehn Länder Mittel- und Osteuropas (MOEL) über die Mitgliedschaft in der Europäischen Union (EU) ist die erste Runde der EU-Osterweiterung am 16. April 2003 politische Realität geworden. Trotz ihrer Symbolwirkung markierten die Vertragsabschlüsse jedoch nur einen vorläufigen Zwischenschritt im Prozess der Integration der ehemaligen Warschauer-Pakt-Staaten in die wirtschaftlichen und politischen Strukturen der Union.
Angesichts der enormen finanziellen und rechtlich-institutionellen Herausforderungen, die eine Osterweiterung der EU mit sich bringt, ist die Debatte über ihre künftige Gestaltung vor allem eine Debatte über ihre Finanzierbarkeit – und über die Verteilung der Lasten auf die einzelnen Mitglieder. Gerade mit Blick auf die geplante weitere Ausdehnung des EU-Vertragsgebiets entzündete sich scharfe Kritik an institutionellen Defiziten und wurden Forderungen nach einer umfassenden Reform der redistributiven Gemeinschaftspolitiken laut: Die klassische wirtschaftspolitische Fragestellung "Who gets what and why?" gewinnt an zusätzlicher Bedeutung.
Die Osterweiterung wird sich nicht allein in makroökonomischen Globaldaten niederschlagen. Auch die direkten budgetären Kosten der Beitritte dürften auf einem hohen Niveau verharren oder sogar noch ansteigen. Eine besondere Virulenz erhält die Diskussion über die künftige Finanzierung der EU ferner dadurch, dass die bisherige Förderpraxis nach Ansicht zahlreicher Kritiker auf doktrinären Politikmodellen der Einkommensumverteilung basiert - wodurch Ineffizienzen entstanden sind, denen nur durch eine Reform der redistributiven EU-Politiken beizukommen sein dürfte.
Inwieweit lassen sich die Probleme der Finanzierung der EU-Osterweiterung durch die strukturellen Defizite sowie die ineffiziente Praxis der bisherigen Umverteilungspolitiken zur Heranführung der MOEL begründen? Eine einführende Übersicht über die Finanzierungsgrundlagen der EU stellt die Ausgestaltung ihres Haushalts nach den wichtigsten Ausgaben- und Einnahmekategorien dar. Darauf folgt eine Schilderung der Fiskaltransfers innerhalb der EU und eine kurze Diskussion der Nettozahlerposition. Abschnitt 3 benennt die konkreten finanziellen Herausforderungen, mit denen sich das EU-Finanzsystem durch die Osterweiterung konfrontiert sieht. Abschnitt 4 widmet sich schließlich der Erörterung zentraler Reformvorschläge zur Umgestaltung der EU-Finanzordnung.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Zu den Finanzierungsgrundlagen der Europäischen Union
- Der Haushalt der EU
- Ausgabenkategorien
- Die Gemeinsame Agrarpolitik
- Die Gemeinsame Strukturpolitik
- Interne Politikbereiche, externe Politikbereiche und sonstige Ausgaben
- Einnahmekategorien
- Traditionelle Eigenmittel
- Nicht-traditionelle Eigenmittel
- Fiskaltransfers innerhalb der EU und die Bedeutung der Nettozahlerposition
- Finanzielle Herausforderungen durch die EU-Osterweiterung
- Die „Agenda 2000”
- Direkte fiskalische Finanzierungsprobleme: Budgetierung, Transfers und Beihilfen
- Steigende Beihilfen aus den Agrarfonds
- Steigende Beihilfen aus den Strukturfonds
- Indirekte makroökonomische Finanzierungsprobleme: Marktrigiditäten, strukturelle Heterogenität und unsicheres Wachstum
- Vorschläge zu einer Reform der EU-Finanzordnung
- Kernpunkte der Kritik: Intransparenz und Ineffizienz durch Mehrfach-Budgetierung
- Neujustierung der nationalen Finanzbeiträge
- Der notwendige Abschied vom Dogma „Viel hilft viel“
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit analysiert die finanziellen Herausforderungen der EU-Osterweiterung im Kontext bestehender wirtschafts- und budgetpolitischer Dogmen. Sie untersucht, ob die strukturellen Defizite sowie die ineffiziente Durchführungspraxis der bisherigen EU-Umverteilungspolitiken die Finanzierungsprobleme der Erweiterung maßgeblich erklären.
- Finanzierungsmechanismen und Budgetstruktur der Europäischen Union
- Fiskaltransfers und Nettozahlerposition innerhalb der EU
- Direkte und indirekte Finanzierungsprobleme der EU-Osterweiterung
- Reformvorschläge für die EU-Finanzordnung
- Kritik an doktrinären Politikmodellen der Einkommensumverteilung und deren Auswirkungen auf die Finanzierung der EU-Osterweiterung
Zusammenfassung der Kapitel
Das zweite Kapitel beleuchtet die Finanzierungsgrundlagen der EU. Es präsentiert eine deskriptive Darstellung des EU-Haushalts, inklusive der wichtigsten Ausgaben- und Einnahmekategorien. Darüber hinaus werden die Fiskaltransfers innerhalb der EU und die Nettozahlerposition erläutert.
Im dritten Kapitel werden die finanziellen Herausforderungen der EU-Osterweiterung beleuchtet. Hierbei wird besonders auf die „Agenda 2000“ und die damit verbundenen direkten fiskalischen Finanzierungsprobleme eingegangen, die sich aus steigenden Beihilfen aus den Agrarfonds und den Strukturfonds ergeben. Außerdem werden indirekte makroökonomische Finanzierungsprobleme durch Marktrigiditäten, strukturelle Heterogenität und unsicheres Wachstum thematisiert.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Finanzierungsproblemen der EU-Osterweiterung, dem EU-Haushalt, den Ausgabenkategorien, der Gemeinsamen Agrarpolitik, der Gemeinsamen Strukturpolitik, den Fiskaltransfers, der Nettozahlerposition, den direkten und indirekten Finanzierungsproblemen, der „Agenda 2000“, der Reform der EU-Finanzordnung und den wirtschafts- und budgetpolitischen Dogmen.
Häufig gestellte Fragen
Was sind die zentralen Finanzierungsprobleme der EU-Osterweiterung?
Die Probleme liegen in den hohen direkten fiskalischen Kosten für Agrar- und Strukturfonds sowie in indirekten makroökonomischen Herausforderungen wie struktureller Heterogenität und Marktrigiditäten in den neuen Mitgliedstaaten.
Welche Rolle spielt die Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) bei der Erweiterung?
Die GAP ist eine der größten Ausgabenkategorien der EU. Die Integration der mittel- und osteuropäischen Länder (MOEL) führt zu einem massiven Anstieg der Beihilfen aus den Agrarfonds, was das EU-Budget stark belastet.
Was versteht man unter der Nettozahlerposition?
Die Nettozahlerposition beschreibt das Verhältnis zwischen den Beiträgen eines Mitgliedstaates zum EU-Haushalt und den Rückflüssen aus EU-Fördermitteln. Die Osterweiterung verschärft die Debatte über die Lastenverteilung zwischen Nettozahlern und Nettoempfängern.
Was war die "Agenda 2000"?
Die Agenda 2000 war ein Aktionsprogramm der EU, das Reformen der Gemeinschaftspolitiken und einen neuen Finanzrahmen festlegte, um die Union auf die Osterweiterung vorzubereiten.
Welche Reformvorschläge gibt es für die EU-Finanzordnung?
Diskutiert werden eine Neujustierung der nationalen Finanzbeiträge, mehr Transparenz zur Vermeidung von Mehrfach-Budgetierung und eine Abkehr von ineffizienten Umverteilungsdogmen.
Warum wird die bisherige EU-Förderpraxis kritisiert?
Kritiker bemängeln, dass sie auf veralteten Politikmodellen basiert, die Ineffizienzen fördern und nicht ausreichend auf die spezifischen Bedürfnisse einer erweiterten Union zugeschnitten sind.
- Quote paper
- Dipl.-Pol., MSc (IR) Jan-Henrik Petermann (Author), 2003, Umverteilung ohne Reformen? Probleme der Finanzierung der EU-Osterweiterung vor dem Hintergrund wirtschafts- und budgetpolitischer Dogmen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/182609