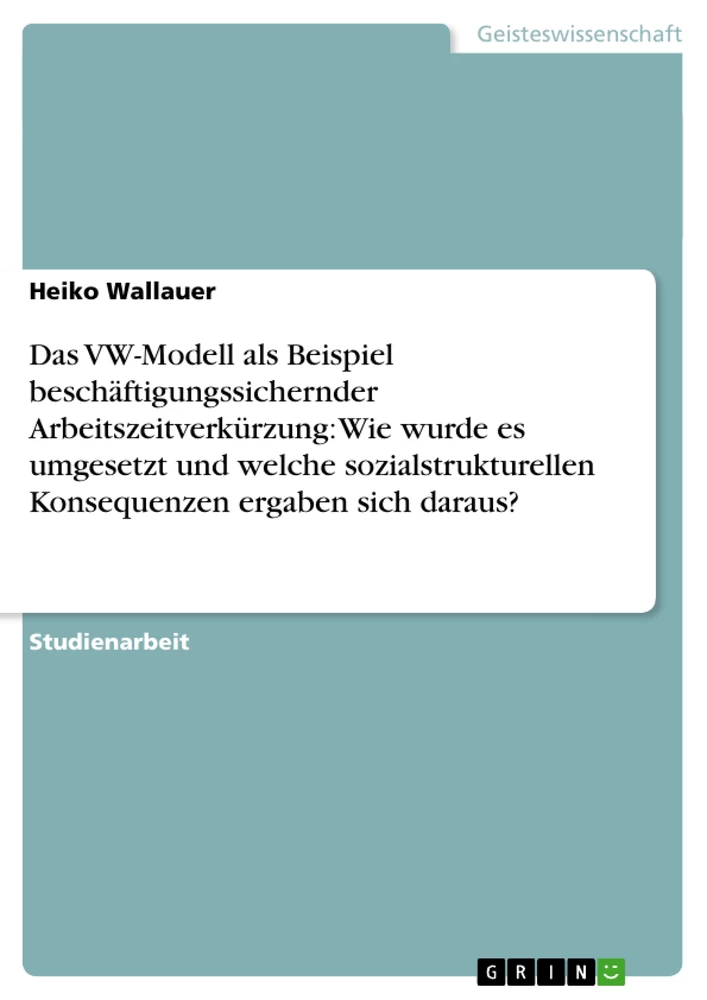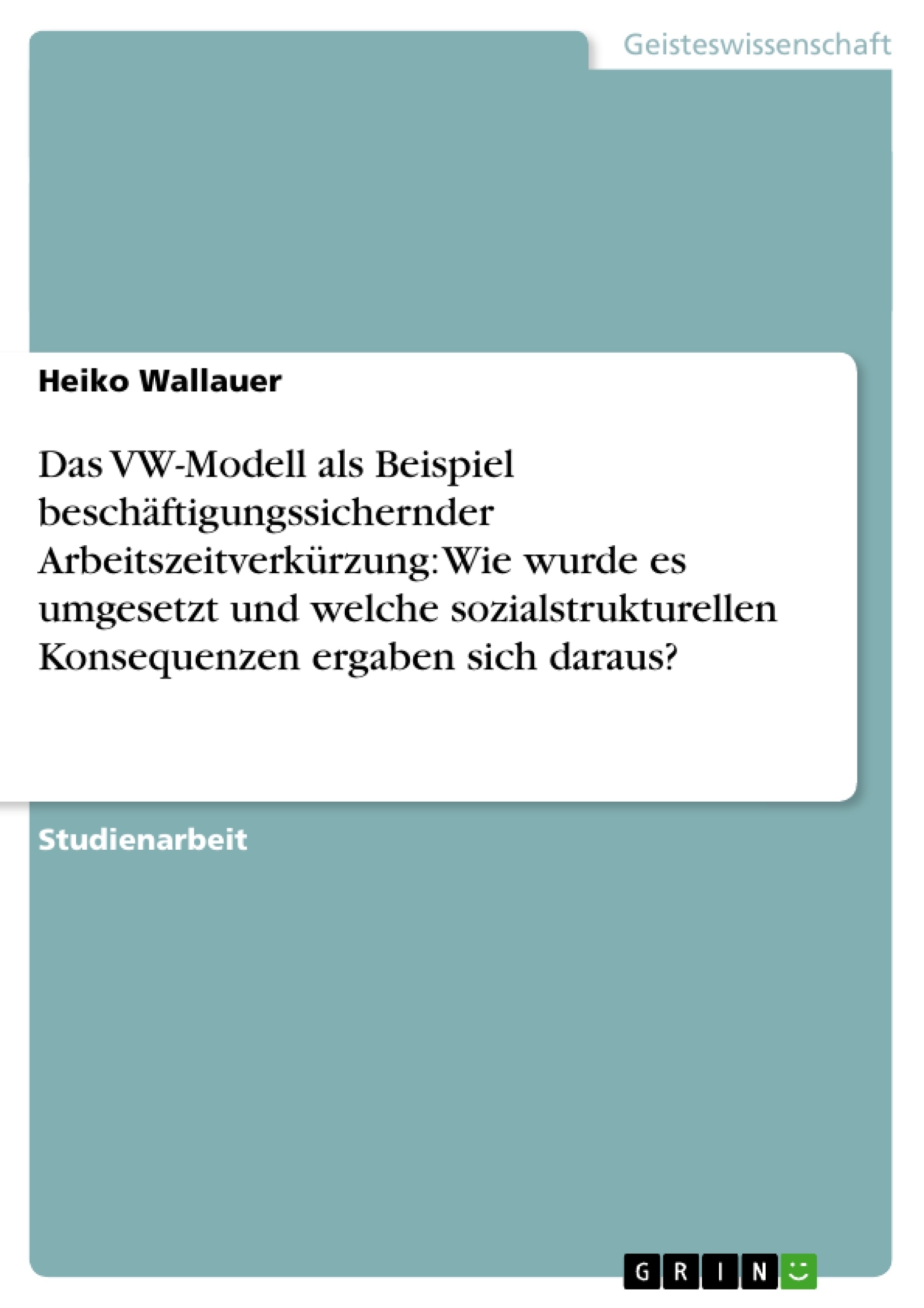Immer wieder wird die Verringerung der Arbeitszeit als Königsweg bei der Sicherung von Arbeitsplätzen und bei der Reduktion von Arbeitslosigkeit angesehen. Und so sind auch tarifliche Abkommen, wie sie zum Beispiel bei der Volkswagen AG getroffen wurden, und wie dies durch Entwicklungstendenzen des "Bündnis für Arbeit" in bestimmten Punkten bestätigt wurde, als neuer Teil der arbeitspolitischen Landschaft nicht mehr wegzudenken. Nach Markus Promberger stellen sie mitunter die "einzige unmittelbar arbeitsplatzsichernde Form solcher Bündnisse" dar. Er geht sogar soweit, den Modellen von Volkswagen, der metalverarbeitenden Industrie oder der Ruhrkohle AG Pioniercharakter zuzuschreiben.
Allerdings darf nicht vergessen werden, daß arbeitsplatzsichernde Modelle immer in eine soziale Umwelt eingegliedert sind und das somit auch immer eine Wirkung auf eben diese Umwelt, die meist nicht intendiert ist, vorliegt.
Im der vorliegenden Arbeit soll deshalb dieses Phänomen am Beispiel des sogenannten VW-Modells näher beleuchtet werden. Hierzu wird es zunächst notwendig sein, zu klären, was unter arbeitsmarktpolitischen und beschäftigungspolitischen Maßnahmen zu verstehen ist, um dann das VW-Modell als "neuen Typ" von vorangegangen Typen abzugrenzen. Kurz wird am Ende dieses Kapitel dann noch der sogenannte "Tabubruch" des VW-Modells erläutert. Im folgenden Kapitel wird dann auf die beschäftigungssichernde Arbeitszeitverkürzung am Beispiel der Volkswagen AG eingegangen, also auf die sogenannte Vier-Tage-Woche und deren Umsetzung innerhalb der Volkswagen AG. Im vierten Kapitel wird dann näher auf die sozialstrukturellen Konsequenzen der Vier-Tage-Woche eingegangen. Bedingt durch den Umstand, daß dem Einzelnen mehr Zeit, aber weniger Geld zur Verfügung stehen, erscheint es notwendig, aufzuzeigen, wie die Angestellten der Volkswagen AG mit diesen Einkommenseinbußen umgehen. Im folgenden werden dann anhand ausgewählter Beispiele (Familie/Freizeit/Eigenarbeit) der Einfluß der Vier-Tage-Woche auf bestehende soziale und sozialstrukturelle Gefüge vorgestellt. Kapitel 5 bietet dann abschließend eine Zusammenfassung der Ergebnisse.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Was versteht man unter arbeitsmarktpolitischen und beschäftigungspolitischen Maßnahmen?
- 2.1 Beschäftigungssicherung und Arbeitszeitverkürzung
- 2.2 Neuer Typ beschäftigungssichernder Arbeitszeitverkürzung
- 2.3 Beschäftigungssicherung als Tabubruch?
- 3. Beschäftigungssichernde Arbeitszeitverkürzung am Beispiel der Volkswagen AG
- 3.1 Die Vier-Tage-Woche bei VW
- 3.2 Die Umsetzung der 28,8-Stunden-Woche
- 4. Sozialstrukturelle Konsequenzen des VW-Modells
- 4.1 Mehr Freizeit – weniger Geld
- 4.1.1 Umgang mit Einkommenseinbußen
- 4.2.1 Die Auswirkungen der 28,8-Stunden-Woche auf die familiale Lebensführung
- 4.2.2 Auswirkungen der 28,8-Stunden Woche auf die Gestaltung der Freizeit
- 4.2.3 Zunehmende Eigenarbeit und Schwarzarbeit – eine Folge der 28,8-Stunden-Woche?
- 5. Zusammenfassung der gewonnen Ergebnisse
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das VW-Modell der Arbeitszeitverkürzung als Beispiel für beschäftigungssichernde Maßnahmen. Ziel ist es, die Umsetzung des Modells zu analysieren und die daraus resultierenden sozialstrukturellen Konsequenzen zu beleuchten. Die Arbeit beantwortet die Frage, wie das Modell umgesetzt wurde und welche Auswirkungen es auf die Lebensgestaltung der Mitarbeiter hatte.
- Arbeitszeitverkürzung als beschäftigungssichernde Maßnahme
- Umsetzung des VW-Modells der Vier-Tage-Woche
- Sozialstrukturelle Auswirkungen auf die Mitarbeiter (Einkommen, Freizeit, Familie)
- Auswirkungen auf die Lebensgestaltung der Betroffenen
- Potentielle negative Folgen wie zunehmende Schwarzarbeit
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung stellt die Arbeitszeitverkürzung als wichtigen Ansatz zur Arbeitsplatzsicherung dar und führt das VW-Modell als Beispiel für einen neuen Typ beschäftigungssichernder Maßnahmen ein. Sie skizziert den Forschungsansatz, der darin besteht, das VW-Modell zu analysieren und dessen soziale Auswirkungen zu untersuchen, wobei insbesondere der "Tabubruch" des Modells angesprochen wird. Die Arbeit strukturiert ihren weiteren Verlauf, indem sie die einzelnen Kapitel und deren Inhalte kurz beschreibt.
2. Was versteht man unter arbeitsmarktpolitischen und beschäftigungspolitischen Maßnahmen?: Dieses Kapitel definiert arbeitsmarkt- und beschäftigungspolitische Maßnahmen und grenzt diese voneinander ab. Es wird diskutiert, inwiefern Arbeitszeitpolitik ein Bestandteil aktiver Beschäftigungspolitik ist und welche Ziele mit solchen Maßnahmen verfolgt werden (Arbeitsplatzsicherung und Steigerung der Lebensqualität). Die komplexen Definitionen und Abgrenzungen werden erläutert, ebenso wie die aktuelle Bedeutung der Arbeitslosigkeit im Kontext beschäftigungspolitischer Strategien.
3. Beschäftigungssichernde Arbeitszeitverkürzung am Beispiel der Volkswagen AG: Dieses Kapitel beschreibt im Detail die Einführung und Umsetzung der Vier-Tage-Woche und der 28,8-Stunden-Woche bei Volkswagen. Es analysiert die praktische Anwendung des Modells innerhalb des Unternehmens und beleuchtet die damit verbundenen Herausforderungen und Erfolge. Die Darstellung konzentriert sich auf die konkrete Implementierung der Arbeitszeitverkürzung bei VW, ohne jedoch detailliert auf die einzelnen Umsetzungsschritte einzugehen.
4. Sozialstrukturelle Konsequenzen des VW-Modells: Dieses Kapitel analysiert die Auswirkungen der Arbeitszeitverkürzung auf die Sozialstruktur. Es fokussiert auf die Konsequenzen der verringerten Arbeitszeit und des damit verbundenen geringeren Einkommens. Es wird untersucht, wie die Mitarbeiter mit den Einkommenseinbußen umgehen und wie sich die zusätzliche Freizeit auf die Familienleben, die Freizeitgestaltung und die Tendenz zu Eigenarbeit oder Schwarzarbeit auswirkt. Die Analyse beleuchtet die komplexen Interaktionen zwischen den individuellen Anpassungsstrategien und den übergreifenden sozialstrukturellen Veränderungen.
Schlüsselwörter
Arbeitszeitverkürzung, Beschäftigungssicherung, VW-Modell, Sozialstrukturelle Konsequenzen, Vier-Tage-Woche, Arbeitsmarktpolitik, Beschäftigungspolitik, Einkommenseinbußen, Freizeitgestaltung, Familie, Eigenarbeit, Schwarzarbeit.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit "Arbeitszeitverkürzung bei Volkswagen: Sozialstrukturelle Konsequenzen"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Auswirkungen der Arbeitszeitverkürzung bei Volkswagen, speziell das Modell der Vier-Tage-Woche und der 28,8-Stunden-Woche, auf die Sozialstruktur der betroffenen Mitarbeiter. Im Mittelpunkt stehen die Umsetzung des Modells und die daraus resultierenden Folgen für Einkommen, Freizeitgestaltung und familiäres Leben.
Welche Ziele verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit analysiert die Implementierung des VW-Modells und beleuchtet die sozialstrukturellen Konsequenzen. Sie beantwortet die Frage, wie das Modell umgesetzt wurde und welche Auswirkungen es auf die Lebensgestaltung der Mitarbeiter hatte. Ein besonderer Fokus liegt auf der Betrachtung potenziell negativer Folgen wie zunehmender Schwarzarbeit.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Arbeitszeitverkürzung als beschäftigungssichernde Maßnahme, die detaillierte Umsetzung des VW-Modells, die sozialstrukturellen Auswirkungen auf Einkommen, Freizeit und Familie der Mitarbeiter, die Auswirkungen auf die Lebensgestaltung der Betroffenen und potentielle negative Folgen wie zunehmende Schwarzarbeit.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung, Definition arbeitsmarkt- und beschäftigungspolitischer Maßnahmen, Beschreibung des VW-Modells, Analyse der sozialstrukturellen Konsequenzen und Zusammenfassung der Ergebnisse. Die Einleitung stellt das Thema vor und skizziert den Forschungsansatz. Kapitel 2 definiert die relevanten Begriffe. Kapitel 3 beschreibt die Implementierung des VW-Modells. Kapitel 4 analysiert die sozialen Auswirkungen. Kapitel 5 fasst die Ergebnisse zusammen.
Welche konkreten Aspekte des VW-Modells werden untersucht?
Die Arbeit beschreibt detailliert die Einführung und Umsetzung der Vier-Tage-Woche und der 28,8-Stunden-Woche bei Volkswagen. Es werden die praktische Anwendung, die Herausforderungen und Erfolge des Modells analysiert. Der Fokus liegt auf den konkreten Auswirkungen auf die Mitarbeiter.
Welche sozialstrukturellen Konsequenzen werden analysiert?
Die Arbeit analysiert die Folgen der verringerten Arbeitszeit und des damit verbundenen geringeren Einkommens. Es wird untersucht, wie die Mitarbeiter mit Einkommenseinbußen umgehen und wie sich die zusätzliche Freizeit auf Familienleben, Freizeitgestaltung und die Tendenz zu Eigenarbeit oder Schwarzarbeit auswirkt.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
Die Arbeit fasst die gewonnenen Ergebnisse zusammen und zeigt die komplexen Interaktionen zwischen individuellen Anpassungsstrategien und übergreifenden sozialstrukturellen Veränderungen auf, die durch die Arbeitszeitverkürzung bei Volkswagen ausgelöst wurden.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Arbeitszeitverkürzung, Beschäftigungssicherung, VW-Modell, Sozialstrukturelle Konsequenzen, Vier-Tage-Woche, Arbeitsmarktpolitik, Beschäftigungspolitik, Einkommenseinbußen, Freizeitgestaltung, Familie, Eigenarbeit, Schwarzarbeit.
- Quote paper
- Heiko Wallauer (Author), 2003, Das VW-Modell als Beispiel beschäftigungssichernder Arbeitszeitverkürzung: Wie wurde es umgesetzt und welche sozialstrukturellen Konsequenzen ergaben sich daraus?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/18260