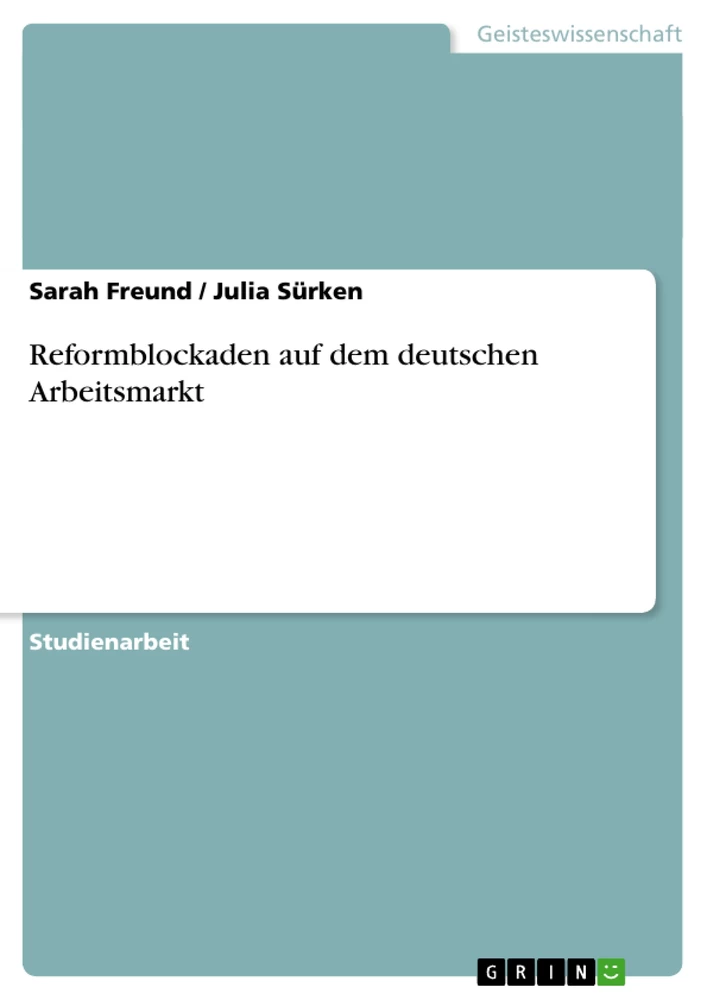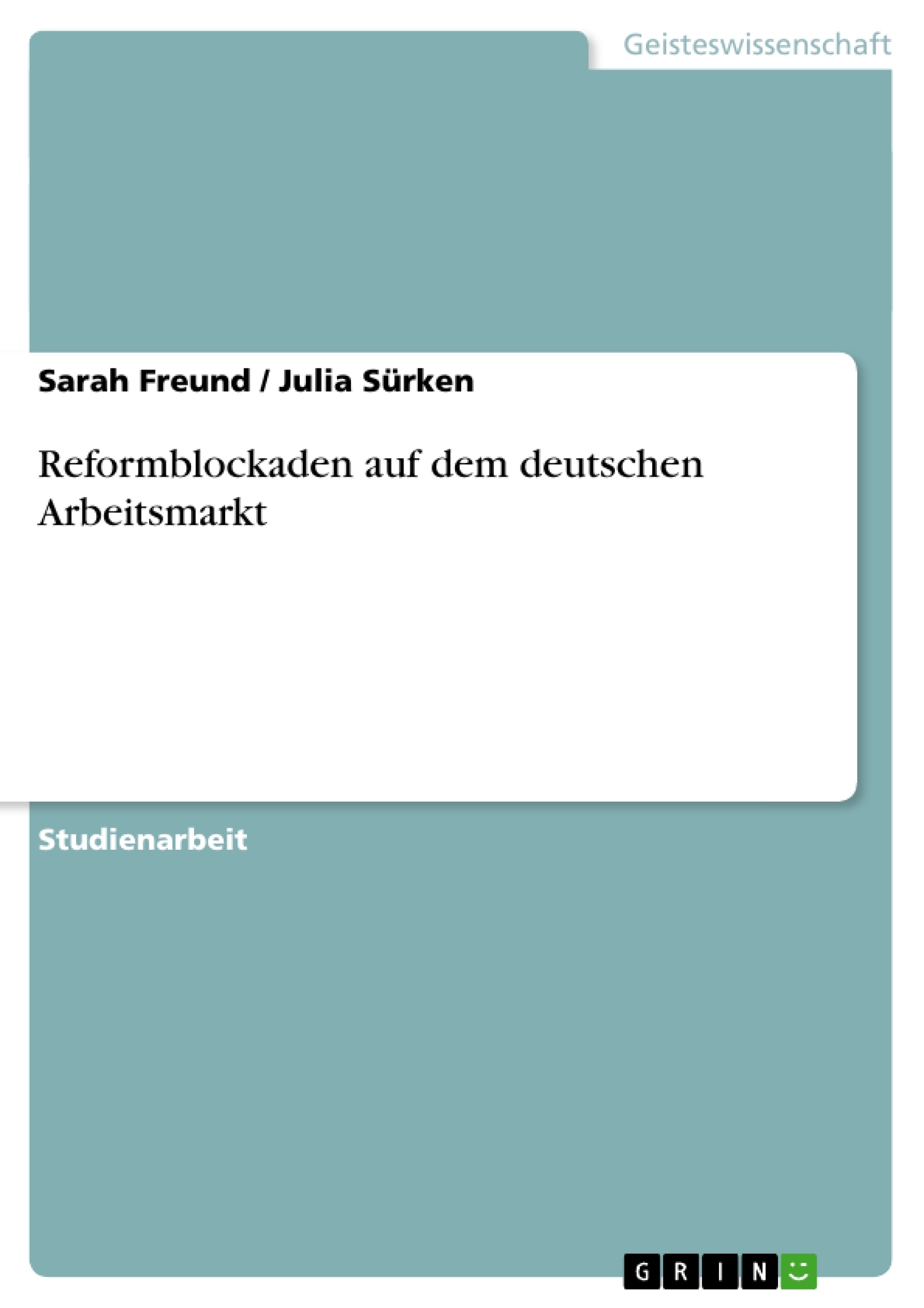[...] Sowohl die Medien, die Bürger als auch die Politiker
diskutieren lauthals über Hartz, Agenda und Co. Von allen Seiten ist eine
Unzufriedenheit mit der derzeitigen wirtschaftspolitischen Lage festzustellen.
Vom Sozialhilfeempfänger bis zum Unternehmer wissen alle, dass das „Modell
Deutschland“ krankt und die Politik mit Reformen hinterherhinkt. Doch auch die
Politiker wollen Veränderungen, sie wissen schon lange, dass man sich nicht mehr
auf den Errungenschaften der Vergangenheit ausruhen kann, doch an der
Umsetzung hapert es. Dabei scheint die Beseitigung der arbeitsmarktpolitischen
Schwächen kein Erkenntnis- sondern ein Umsetzungsproblem zu sein. Da drängt
sich die Frage nach den Gründen auf, die dafür verantwortlich sind, dass
Reformen in Deutschland nur langsam durchgesetzt werden. Genau mit dieser
Frage beschäftigt sich diese Hausarbeit, in der folgende Fragestellung beantwortet
wird: Was ist für den Reformstau in Deutschland verantwortlich? Warum lassen
sich Reformen nur schwer durchsetzen? Es wird von der These ausgegangen, dass
vor allem die institutionelle Struktur des deutschen politischen Systems für
Reformblockaden im Arbeitsmarktgefüge verantwortlich ist.
Auf dem Weg zur Beantwortung dieser Frage werden zunächst die Stärken und
Schwächen der deutschen Wirtschaft und speziell des deutschen Arbeitsmarktes
im internationalen Vergleich dargestellt (Punkt 2). Hier stehen die Ergebnisse der
Arbeitsgruppe „Benchmarking Deutschland“ im Vordergrund. Nicht vergessen
wird in dieser Arbeit die deutsche Sondersituation, die durch die
Wiedervereinigung 1989 verursacht wurde. Welche Probleme diese für die
gesamtdeutsche Wirtschaft mit sich brachte und welche Probleme es speziell auf
dem ostdeutschen Arbeitsmarkt gibt, wird in Punkt 3 geklärt.
Ausgehend von dieser Verortung Deutschlands wird nun das institutionelle
Arbeitsmarktgefüge untersucht. In verschiedenen Bereichen tauchen hier
Reformblockaden auf (Punkt 4): Die sozialstaatliche Finanzverfassung,
Arbeitsmarktrigiditäten, die Tarifautonomie, der deutsche Föderalismus, der
Bundesrat, das Bundesverfassungsgericht, die Bundesbank und die Bundesanstalt
für Arbeit hemmen Reformen auf dem Arbeitsmarkt.
Anschließend steht nicht mehr das institutionelle Arbeitsmarktgefüge im
Vordergrund, in Punkt 5 geht es um eine gesellschaftspolitische Reformblockade:
Hier wird danach gefragt, inwiefern der Wählerwille in Verbindung mit
Parteienstrategien zu Blockaden führt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Stärken und Schwächen des deutschen Arbeitsmarktes
- Sondersituation Wiedervereinigung
- Institutionelle Reformblockaden auf dem deutschen Arbeitsmarkt
- Die sozialstaatliche Finanzverfassung
- Arbeitsmarktrigiditäten
- Lohnpolitik und Tarifautonomie
- Die Politikverflechtung im deutschen Föderalismus
- Der Bundesrat als Reformbremse?
- Weitere institutionelle Reformblockierer
- Das Zusammenspiel von Wählerwille und Parteienkalkül – eine Reformblockade?
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die Ursachen für den Reformstau in Deutschland und beleuchtet die Frage, warum Reformen nur schwer durchsetzbar sind. Im Zentrum der Analyse steht die These, dass die institutionelle Struktur des deutschen politischen Systems für Reformblockaden im Arbeitsmarktgefüge verantwortlich ist.
- Stärken und Schwächen des deutschen Arbeitsmarktes im internationalen Vergleich
- Die Herausforderungen der Wiedervereinigung für die deutsche Wirtschaft und den ostdeutschen Arbeitsmarkt
- Institutionelle Reformblockaden in verschiedenen Bereichen des deutschen Arbeitsmarktgefüges
- Das Zusammenspiel von Wählerwille und Parteienstrategien als potenzielle Reformblockade
- Die Rolle des deutschen politischen Systems im Kontext von Arbeitsmarktpolitik
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 führt in das Thema ein und erläutert die Forschungsfrage der Arbeit: Was ist für den Reformstau in Deutschland verantwortlich und warum lassen sich Reformen nur schwer durchsetzen?
Kapitel 2 beleuchtet die Stärken und Schwächen der deutschen Wirtschaft und speziell des deutschen Arbeitsmarktes im internationalen Vergleich. Hierbei stehen die Ergebnisse der Arbeitsgruppe „Benchmarking Deutschland“ im Vordergrund.
Kapitel 3 analysiert die Sondersituation der Wiedervereinigung 1989 und die daraus resultierenden Probleme für die gesamtdeutsche Wirtschaft und den ostdeutschen Arbeitsmarkt.
Kapitel 4 untersucht das institutionelle Arbeitsmarktgefüge Deutschlands und identifiziert verschiedene Bereiche, in denen Reformblockaden auftreten, darunter die sozialstaatliche Finanzverfassung, Arbeitsmarktrigiditäten, die Tarifautonomie, der deutsche Föderalismus, der Bundesrat, das Bundesverfassungsgericht, die Bundesbank und die Bundesanstalt für Arbeit.
Kapitel 5 geht der Frage nach, inwiefern der Wählerwille in Verbindung mit Parteienstrategien zu Blockaden führt und damit eine gesellschaftspolitische Reformblockade darstellt.
Schlüsselwörter
Reformblockaden, deutscher Arbeitsmarkt, institutionelle Struktur, Wiedervereinigung, sozialstaatliche Finanzverfassung, Arbeitsmarktrigiditäten, Tarifautonomie, Föderalismus, Wählerwille, Parteienkalkül, Reformstau.
Häufig gestellte Fragen
Was ist die Hauptursache für den Reformstau in Deutschland?
Die Arbeit geht davon aus, dass vor allem die institutionelle Struktur des politischen Systems für die Blockaden verantwortlich ist.
Welche Institutionen wirken als Reformbremsen?
Genannt werden unter anderem der Bundesrat, das Bundesverfassungsgericht, die Tarifautonomie und die Politikverflechtung im Föderalismus.
Welche Rolle spielte die Wiedervereinigung für den Arbeitsmarkt?
Die Wiedervereinigung 1989 schuf eine Sondersituation, die die gesamtdeutsche Wirtschaft belastete und spezifische Probleme auf dem ostdeutschen Arbeitsmarkt verursachte.
Was ist die „sozialstaatliche Finanzverfassung“?
Dies bezieht sich auf die Art der Finanzierung der Sozialsysteme, die laut Arbeit ebenfalls zu den Reformblockaden auf dem Arbeitsmarkt zählt.
Inwiefern beeinflusst der Wählerwille politische Reformen?
Das Zusammenspiel von Wählerwillen und Parteienstrategien kann zu Blockaden führen, da Politiker unpopuläre Reformen aus Angst vor Stimmenverlusten scheuen.
Was war die Arbeitsgruppe „Benchmarking Deutschland“?
Diese Gruppe untersuchte die Stärken und Schwächen der deutschen Wirtschaft im internationalen Vergleich und lieferte die Datenbasis für die Reformdiskussion.
- Quote paper
- Sarah Freund (Author), Julia Sürken (Author), 2003, Reformblockaden auf dem deutschen Arbeitsmarkt, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/18261