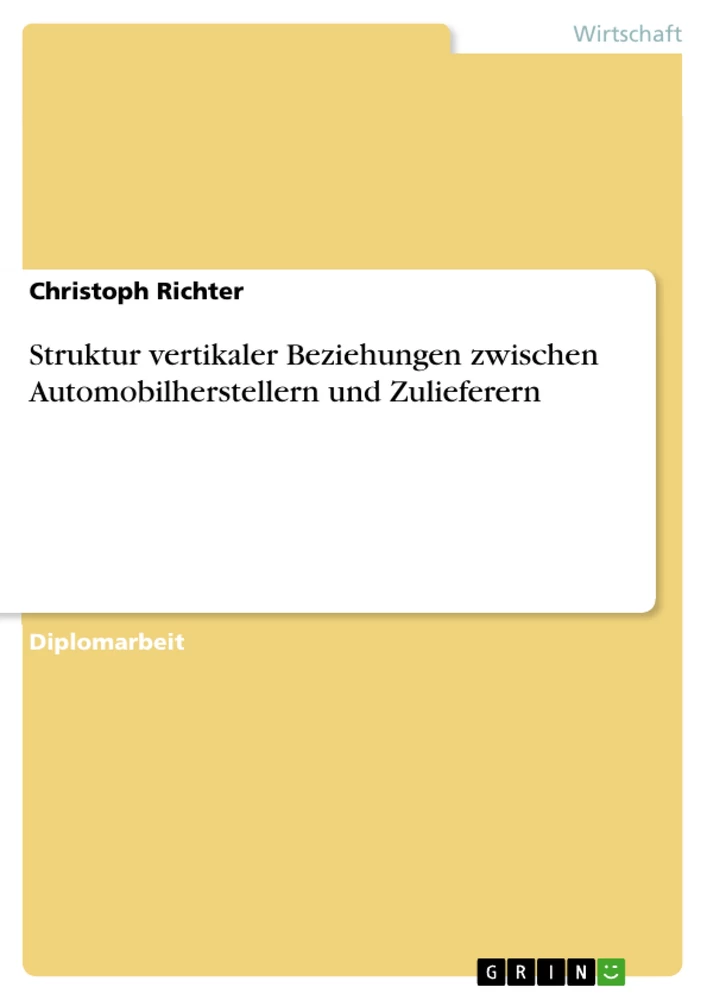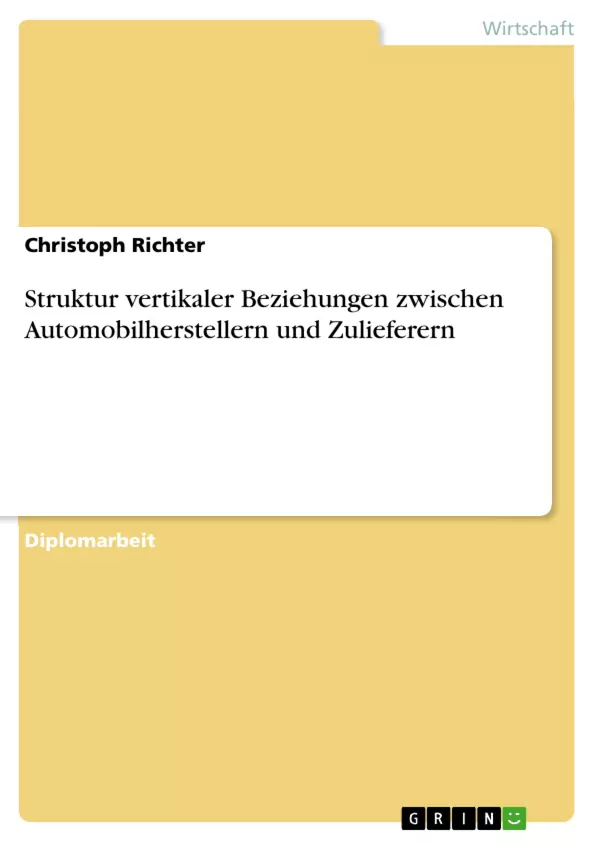Automobile werden heute nicht mehr von Unternehmen wie Porsche, BMW oder Mercedes-Benz produziert, sondern größtenteils von deren Zulieferfirmen. Die Automobilhersteller haben noch einen durchschnittlichen Anteil an der Fertigung ihrer Produkte von etwa einem Drittel. Der Großteil eines Fahrzeugs wird von externen Unternehmen hergestellt. In einem BMW X3 beispielsweise steckt mehr vom öster-reichischen Zulieferer Steyr als vom bayerischen Autobauer, betrachtet man den An-teil der Wertschöpfung (Mercer 2004). Auf der Produktionsseite der Automobilindustrie herrscht eine weit verzweigte Arbeitsteilung, bei der die Hersteller selbst nur noch einen wertmäßig geringen Anteil übernehmen. Die Frage nach den Ursachen einer solchen Arbeitsteilung wird traditionell von der Volkswirtschaftslehre beantwortet.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Fragestellung und theoretische Verortung
- 2. Die Struktur vertikaler Beziehungen in der Automobilindustrie
- 2.1 Entwicklung in der Vergangenheit
- 2.2 Heutige Struktur vertikaler Beziehungen
- 2.3 Studien zur zukünftigen Entwicklung
- 2.4 Entwicklungen innerhalb der Automobilindustrie
- 2.5 Formen der Zusammenarbeit
- 2.6 Probleme
- 2.6.1 Qualitäts-Probleme
- 2.6.2 Kostendruck
- 2.6.3 Korruption
- 2.7 Zusammenfassung
- 3. Theoretischer Rahmen der Transaktionskostenökonomik
- 3.1 Der transaktionskostenökonomische Ansatz von Williamson
- 3.1.1 Die Dimensionen von Transaktionen
- 3.1.2 Fundamentale Transformation
- 3.1.3 Wahl des Kontrollmechanismus
- 3.1.4 Dynamisches Modell der Wahl des Kontrollmechanismus
- 3.1.5 Zusammenfassung und Bezug zur „Make-or-Buy“-Entscheidung
- 3.2 Weiterentwicklungen des Ansatzes
- 3.2.1 Hintergrund vertikaler Integrationen
- 3.2.2 Einfluss spezifischen Know-hows
- 3.3 Fallbeispiel General Motors / Fisher Body
- 3.4 Zusammenfassung und Darstellung des theoretischen Rahmens
- 4. Anwendung des Rahmens auf die aktuelle Struktur der Automobilindustrie
- 4.1 Kriterium der Spezifität von Investitionen
- 4.2 Kriterium der Existenz von Quasi-Renten und des Hold-up-Potentials
- 4.3 Kriterium der Spezifität von Anlagen und Know-how
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die vertikalen Beziehungen zwischen Automobilherstellern und Zulieferern. Ziel ist es, die Ursachen der starken Arbeitsteilung in der Automobilindustrie zu beleuchten und zu analysieren, ob diese Beziehungen mit dem Ansatz der Transaktionskostenökonomik erklärt werden können. Die Arbeit beschäftigt sich mit der „Make-or-Buy“-Entscheidung und den Faktoren, die diese beeinflussen.
- Vertikale Integration und Outsourcing in der Automobilindustrie
- Anwendungsbereich der Transaktionskostenökonomik
- Analyse der Kostenstrukturen bei verschiedenen Organisationsformen
- Einfluss von Spezifität von Investitionen und Know-how
- Das Phänomen der Arbeitsteilung in der Automobilproduktion
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 führt in die Fragestellung ein und verortet die Arbeit theoretisch im Kontext der Transaktionskostenökonomik und der „Make-or-Buy“-Entscheidung. Kapitel 2 beschreibt die Struktur vertikaler Beziehungen in der Automobilindustrie, von der historischen Entwicklung bis zur heutigen Situation, einschließlich der Probleme, die sich dabei ergeben. Kapitel 3 erläutert den theoretischen Rahmen der Transaktionskostenökonomik nach Williamson, inklusive Weiterentwicklungen des Ansatzes und einem Fallbeispiel. Kapitel 4 wendet diesen Rahmen auf die aktuelle Struktur der Automobilindustrie an.
Schlüsselwörter
Transaktionskostenökonomik, Make-or-Buy-Entscheidung, vertikale Integration, Outsourcing, Automobilindustrie, Zulieferer, Spezifität von Investitionen, Quasi-Renten, Hold-up-Problem, Arbeitsteilung, Williamson.
- Citation du texte
- Christoph Richter (Auteur), 2006, Struktur vertikaler Beziehungen zwischen Automobilherstellern und Zulieferern, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/182654