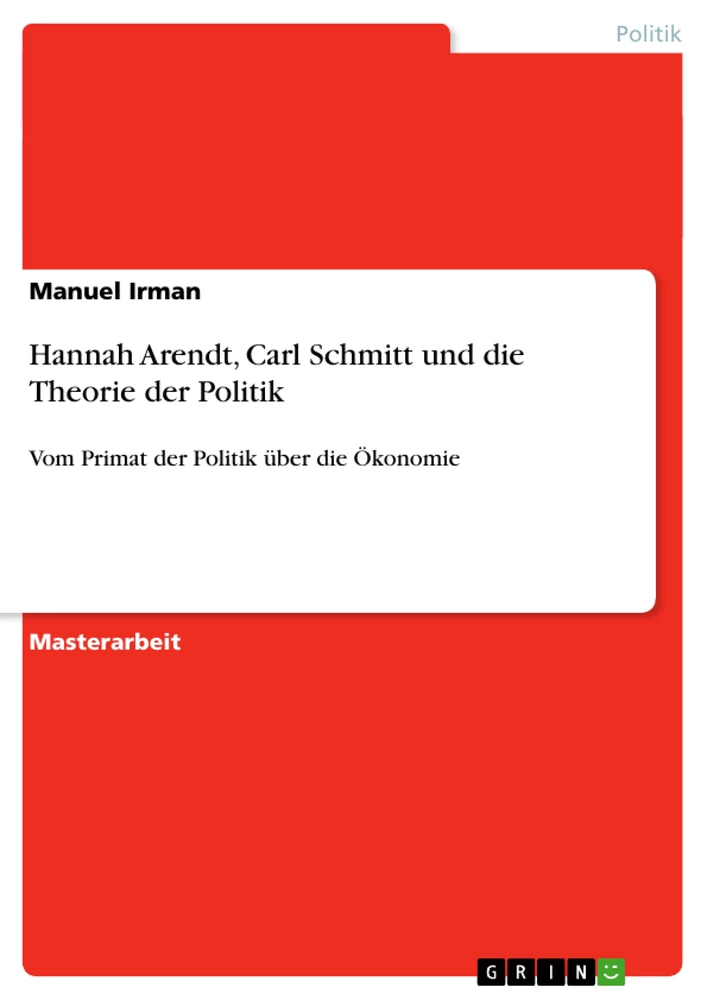Anhand der doch sehr gegensätzlichen politischen Philosophien von Hannah Arendt und Carl Schmitt wird hier dargelegt, inwiefern ein Primat der Politik über die Ökonomie gerechtfertigt werden kann. Eine Frage, die aufgrund der gegenwärtigen Finanz- und Wirtschaftskrise wieder an Aktualität gewonnen hat.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Schmitts Theorie der Politik
- 2.1 Schmitts Politikverständnis
- 2.1.1 Unterscheidung zwischen Freund und Feind
- 2.1.2 Anthropologie, Staat und Politik
- 2.1.3 Internationale Ordnung
- 2.1.4 Souveränität und Dezisionismus
- 2.2 Schmitts Liberalismuskritik
- 2.2.1 Theorie der Zentralgebiete und deren Neutralisierungen
- 2.2.2 Die Auflösung des Politischen
- 2.2.3 Demokratie, Parlamentarismus und Diktatur
- 2.2.4 Schmitts Leviathan
- 2.3 Fazit
- 2.1 Schmitts Politikverständnis
- 3 Arendts Theorie der Politik
- 3.1 Arendts Politikverständnis
- 3.1.1 Was ist Politik (nicht)?
- 3.1.2 Vorurteil und Urteil
- 3.1.3 Die Kriegsfrage und die Rolle von Macht und Gewalt in der Politik
- 3.1.4 Revolution und Rätesystem
- 3.2 Arendts Liberalismuskritik
- 3.2.1 (Markt-)Liberaler Imperialismus
- 3.2.2 Arendts Kritik an Hobbes' politischer Theorie
- 3.2.3 Kapital und Mob und der Charakter des Imperialismus
- 3.2.4 Revolution, die soziale Frage und das öffentliche Glück
- 3.3 Fazit
- 3.1 Arendts Politikverständnis
- 4 Schlussfolgerungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Masterarbeit untersucht die politischen Theorien von Carl Schmitt und Hannah Arendt, um Argumente für die Legitimation eines Primats der Politik vor der Ökonomie zu finden. Das Ziel ist kein Vergleich der beiden Philosophien, sondern eine Analyse ihrer jeweiligen Argumente im Hinblick auf die Fragestellung. Die Arbeit konzentriert sich auf deren Kritik am Liberalismus und deren jeweiliges Verständnis von Politik.
- Primat der Politik über die Ökonomie
- Kritik am Liberalismus bei Schmitt und Arendt
- Schmitts Politikverständnis und dessen zentrale Konzepte
- Arendts Politikverständnis und deren zentrale Konzepte
- Vergleich der Argumente von Schmitt und Arendt
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 (Einleitung): Die Einleitung beschreibt die Ausgangssituation der Arbeit, die sich aus der Finanzkrise 2008 und der damit verbundenen Debatte um den Primat der Ökonomie über die Politik ergibt. Sie formuliert die Forschungsfrage und die Ziele der Arbeit.
Kapitel 2 (Schmitts Theorie der Politik): Dieses Kapitel präsentiert Schmitts Politikverständnis, seine Unterscheidung von Freund und Feind, seine Anthropologie, seine Kritik am Liberalismus und seine Konzepte von Souveränität und Dezisionismus. Es beleuchtet seine Auseinandersetzung mit Demokratie, Parlamentarismus und Diktatur.
Kapitel 3 (Arendts Theorie der Politik): Dieses Kapitel beschreibt Arendts Politikverständnis, ihre Kritik am Liberalismus, und beleuchtet ihre Auseinandersetzung mit zentralen Begriffen wie Macht, Gewalt, Revolution und dem öffentlichen Glück. Es analysiert ihre Kritik an Hobbes und den (Markt-)Liberalismus.
Schlüsselwörter
Primat der Politik, Ökonomie, Liberalismuskritik, Carl Schmitt, Hannah Arendt, Freund-Feind-Unterscheidung, Souveränität, Dezisionismus, Macht, Gewalt, Revolution, öffentliches Glück, (Markt-)Liberalismus, Hobbes.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet der "Primat der Politik"?
Die Idee, dass politische Entscheidungen und Gemeinwohlinteressen Vorrang vor rein ökonomischen Logiken haben sollten.
Wie definiert Carl Schmitt das Politische?
Schmitt definiert das Politische durch die spezifische Unterscheidung zwischen Freund und Feind.
Was ist Hannah Arendts Verständnis von Politik?
Für Arendt ist Politik ein Raum der Freiheit, des gemeinsamen Handelns und des Sprechens unter Gleichen.
Warum kritisieren beide Autoren den Liberalismus?
Beide sehen im Liberalismus die Gefahr, dass das Politische durch ökonomische Interessen oder bürokratische Verwaltung aufgelöst wird.
Was versteht Arendt unter "öffentlichem Glück"?
Es ist die Freude und Erfüllung, die Bürger erfahren, wenn sie aktiv am politischen Geschehen und an der Gestaltung der Welt teilnehmen.
- Quote paper
- M.A. Manuel Irman (Author), 2011, Hannah Arendt, Carl Schmitt und die Theorie der Politik, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/182716