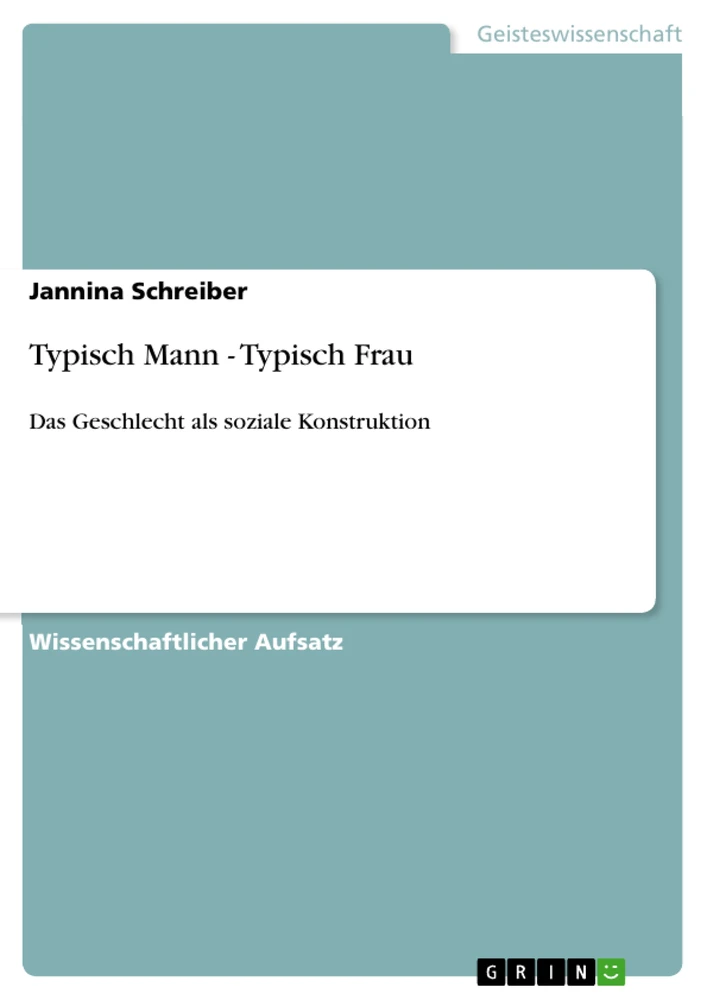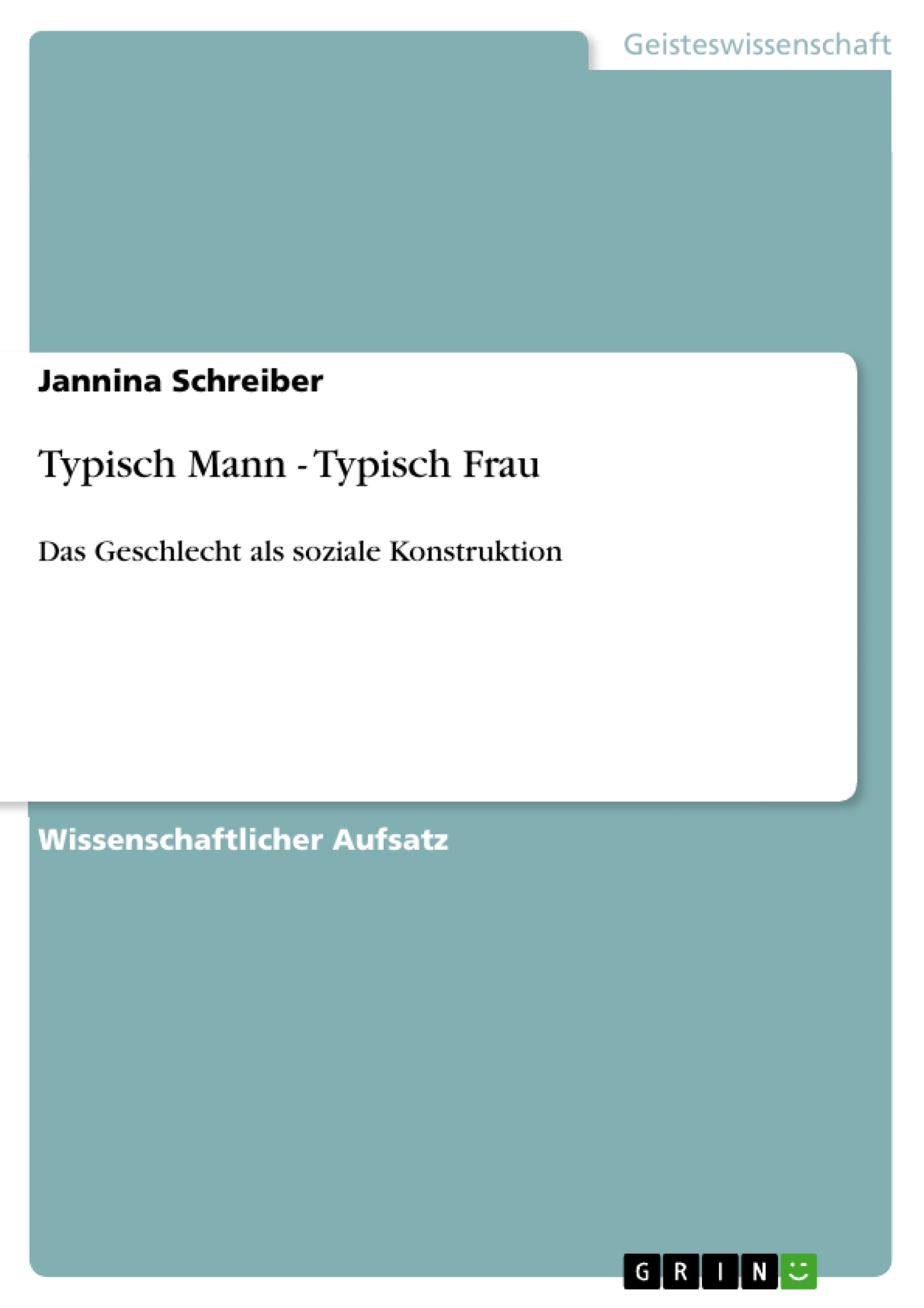„Fussball macht Spass, ist einfach und fair. Wenn Du fit, gesund und cool sein willst, ist Fussball genau das Richtige!“, heißt es in einem Werbeslogan der Kampagne “Live Your Goals!“ Man könnte nun meinen, es handle sich hierbei um Maßnahmen der FIFA zur Nachwuchsgewinnung von jungen, sportlichen Männern, die schon immer davon träumen, Fußballprofi zu werden…
Jedoch geht dieser Slogan mit folgenden Worten weiter: ,,Fußball ist ein Sport für Dich – Du und Deine Freundinnen, macht mit, damit es noch mehr werden! Such Dir ein Team, und wer weiß, vielleicht bist Du bei der nächsten FIFA Frauen-Weltmeisterschaft™ 2015 in Kanada schon mit dabei!“
Mit dieser Kampagne möchte die FIFA im Zuge der Frauenweltmeisterschaft 2011 die Chance nutzen, noch mehr junge Mädchen und Frauen dafür zu begeistern, die sonst durch die Männer bekannte Domäne des Fußballs zu erobern.
Doch wie kommt dieses gesellschaftliche Bild zu Stande, dass Fußball ein „typischer“ Männersport sei?
Der Frauenfußball schreibt heutzutage in Deutschland eine einzigartige Erfolgsgeschichte, obwohl es eine relativ junge Historie darstellt. Erst ab 1970 hat die Satzung des Deutschen Fußball-Bundes die Förderung des Frauenfußballs aufgenommen. Doch seit die Frauen-Nationalmannschaft 1982 ihr erstes Länderspiel bestritt, lieferten die Fußballerinnen viele Gründe zur Freude und begeisterten immer mehr Fans, sowohl national als auch international.
Doch nicht nur der Fußball wird „vergeschlechtlicht“, sondern auch zahlreiche andere soziale Bereiche in unserer Gesellschaft.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Begrifflichkeiten
- Geschlecht vs. Gender
- Sex vs. Gender
- Die soziale Konstruktion der Zweigeschlechtlichkeit
- Folgen der Geschlechterdifferenz in modernen Gesellschaften
- Geschlechterverschleierung
- Androgynie als Metapher für personale Vielfalt
- Intersexualität als Genderparadoxie
- Transsexualität als Geschlechtsmetamorphose
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der sozialen Konstruktion des Geschlechts und untersucht, wie sich dieses Konzept auf die Geschlechterrollen und die Geschlechterdifferenz in modernen Gesellschaften auswirkt. Sie analysiert die Entstehung des Zweigeschlechtermodells und dessen Folgen für die Individuen und die Gesellschaft.
- Der Unterschied zwischen Geschlecht und Gender
- Die soziale Konstruktion des Zweigeschlechtermodells
- Die Folgen der Geschlechterdifferenz in modernen Gesellschaften
- Geschlechterverschleierung durch Androgynie, Intersexualität und Transsexualität
- Die Herausforderungen und Möglichkeiten der Geschlechterkonstruktion
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel führt in die Thematik der Geschlechterkonstruktion ein und präsentiert die zentrale Frage: Wie gestaltet sich das Geschlecht sozial und wie verändert diese Thematik die Perspektive auf die Geschlechter? Das zweite Kapitel beleuchtet die Begriffsdifferenzierung von Geschlecht und Gender und thematisiert den Unterschied zwischen dem biologischen Geschlecht (sex) und dem sozialen Geschlecht (gender). Das dritte Kapitel analysiert die soziale Konstruktion der Zweigeschlechtlichkeit und die Auswirkungen dieser Konstruktion auf die Geschlechterrollen und die Geschlechterdifferenz in modernen Gesellschaften. Das vierte Kapitel behandelt das Konzept der Geschlechterverschleierung und stellt anhand von Beispielen wie Androgynie, Intersexualität und Transsexualität die Komplexität des Geschlechts und die Grenzen des Zweigeschlechtermodells in Frage.
Schlüsselwörter
Geschlecht, Gender, Geschlechterkonstruktion, Zweigeschlechtermodell, Geschlechterdifferenz, Geschlechterrollen, Androgynie, Intersexualität, Transsexualität, Geschlechterverschleierung
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Unterschied zwischen „Sex“ und „Gender“?
„Sex“ bezeichnet das biologische Geschlecht, während „Gender“ das soziale Geschlecht und die damit verbundenen gesellschaftlichen Rollenerwartungen beschreibt.
Wie entsteht das Zweigeschlechtermodell?
Es handelt sich um eine soziale Konstruktion, die Menschen in zwei Kategorien (männlich/weiblich) einteilt und Abweichungen oft unsichtbar macht oder stigmatisiert.
Was versteht man unter Geschlechterverschleierung?
Konzepte wie Androgynie, Intersexualität und Transsexualität fordern die traditionelle binäre Geschlechterordnung heraus und machen die Vielfalt geschlechtlicher Identität sichtbar.
Welche Rolle spielt Fußball in der Geschlechterdebatte?
Fußball galt lange als „typischer Männersport“. Die Arbeit untersucht, wie solche Bilder entstehen und wie sich der Frauenfußball als Erfolgsgeschichte dagegen behauptet.
Was sind die Folgen der Geschlechterdifferenz?
Sie führt zu festgeschriebenen Rollenbildern, die individuelle Entfaltung einschränken und soziale Ungleichheiten in vielen Lebensbereichen zementieren können.
- Quote paper
- Jannina Schreiber (Author), 2011, Typisch Mann - Typisch Frau, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/182789