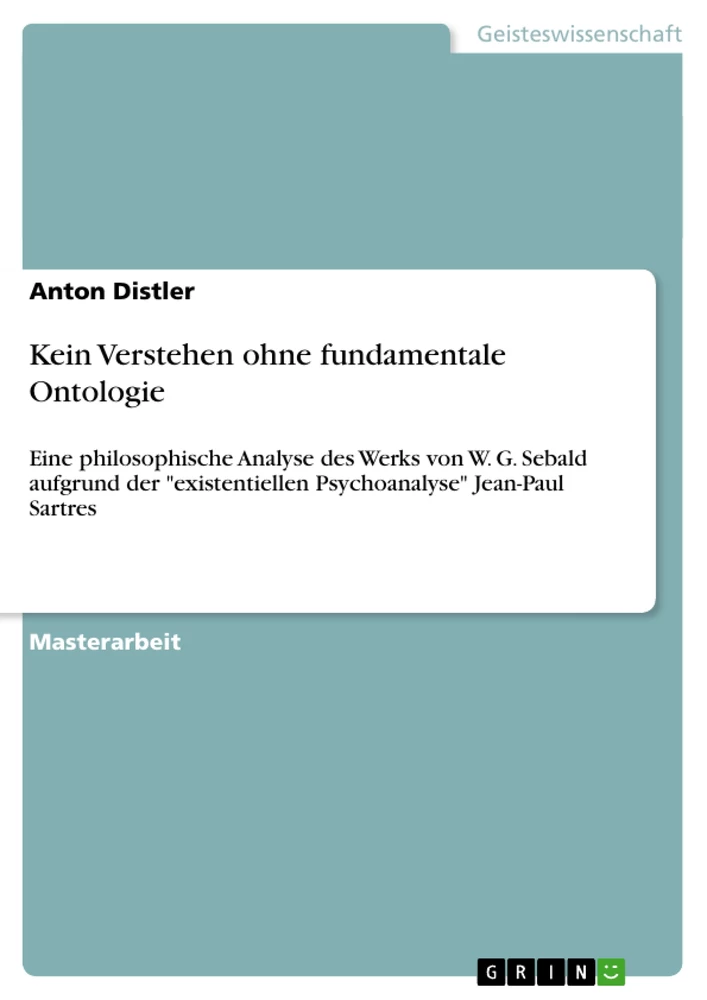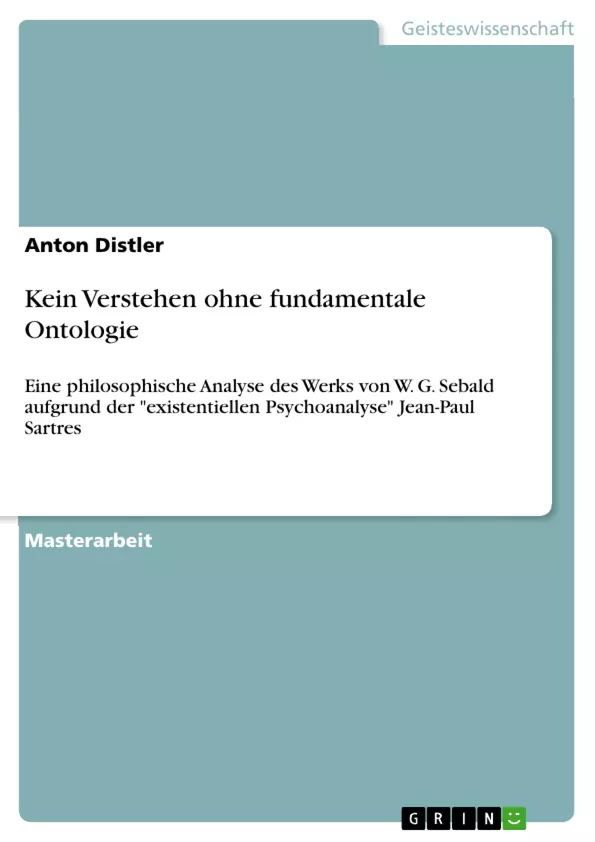Der Literaturwissenschaftler und Schriftsteller Winfried Georg Sebald ist vor allem nach seinem Tode im Jahre 2001 zu einem hochdiskutierten, deutschsprachigen Autor avanciert. Er geniesst nicht im deutschen Sprachraum allein, sondern auch in Großbritannien und insbesondere in den Vereinigten Staaten von Amerika als dort meistdiskutierter, zeitgenössischer deutscher Autor grosses Ansehen. Als Autor ragt W.G. Sebald vor allem mit seinen späten prosaischen Texten heraus, gefolgt von seinen literaturwissenschaftlichen Werken, insbesondere zur österreichischen Literatur und zu randständigen Protagonisten. Sein literaturwissenschaftliches Frühwerk hingegen, das heisst seine Magisterarbeit über Carl Sternheim aus dem Jahre 1969 und seine Dissertation über Alfred Döblin von 1973, die 1980 in Druck ging, wird dabei in der deutsch- und englischsprachigen Rezeption grösstenteils vernachlässigt. Zu Unrecht, wenn man beachtet, wie sehr philosophiegeschichtlich fundiert und durchdacht seine sämtlichen Arbeiten sind. Nur aufgrund seiner wissenschaftlichen Sozialisation in jungen Jahren aber – die verbunden ist mit seinem Studienbeginn an der Universität Freiburg im Breisgau – wird sich das Spätwerk W.G. Sebalds, das heisst vor allem seine prosaischen Arbeiten seit den 90iger Jahren, angemessen einordnen lassen. Des weiteren wird sich daran der Stellenwert der vielseitig verwendeten, typisch anmutenden Bildlichkeit Sebalds (unter anderem durch „Wort-Bilde“ und des ambivalenten Einsatzes von Schwarz-Weiß-Fotographien), bemessen lassen.
Die literaturwissenschaftliche und philosophische Einordnung in ein Genre, insbesondere der Prosawerke, fällt schwer, vor allem wegen des autobiographischen Vermischens von (oftmals halluzinatorischer) Fiktion und (zum Teil authentischer) Dokumentation. Der Versuche gibt es viele, wobei die einen dazu tendieren, Sebalds Texte, die, so Claudia Albes, „gegenwärtig unter dem Schlagwort „postmodernes Schreiben“ gehandelt“ werden, „mit kunstvoller Oberflächlichkeit und Redundanz gleich[zusetzen].“ „Deutsche Berufskollegen wie Georg Klein“ hingegen, hält Rüdiger Görner fest, werfen ihm unter anderem „ein problematisch leidensselig-masochistisches Verhältnis zur Vergangenheit und eine unzulässige Intimität mit den Toten“ vor.
Es steht wohl ausser Frage, dass W.G. Sebald ein bekennender, erkenntniszweifelnder, zutiefst melancholischer und sich dennoch um stete Selbstvergewisserung bemühender Mensch war.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Thema
- Untersuchungsgegenstand
- Methodik
- Erstes Kapitel: Fundierung
- Sartres philosophisches Konzept
- Transzendenz des Ego
- Präreflexives Bewusstsein und Bewusstsein
- An-sich-sein
- Für-sich-sein
- Der Andere
- Zur Freiheit verurteilt
- Sartres Geschichtsverständnis: Zerstörung
- Phänomenologisch-ontologisch
- Dialektisch
- Sartres Konzeption der „existentiellen Psychoanalyse“
- Sartres Auffassung
- Sartres Ablehnung
- Sartres Alternative
- Sartres Aspekt des Verstehens des Unsagbaren: die gelebte Erfahrung
- Konsequenzen
- Sartres Philosophie in seiner Literatur
- Sartres philosophisches Konzept
- Zweites Kapitel: Analyse
- Sebalds der Zerstörung gewidmete, geschichtswissenschaftliche Sozialisation und sein Geschichtsverständnis in Anlehnung an
- Walter Benjamin
- Theodor W. Adorno
- Max Horkheimer
- Existentielle Psychoanalyse auf das Sebaldsche Werk angewendet
- Analyse des literaturwissenschaftlichen Werks
- Falsches Bewusstsein und Verhalten
- Sebalds „Finte“
- „Lehre vom richtigen Leben“
- Analyse des schriftstellerischen Werks
- Schwindel, Ekel: eine Grundstimmung
- Bildlichkeit: ein permeables Verknüpfungselement
- Kontingenz oder die Krux mit dem Leben und dem Tod
- „Bessere Sehnsucht“ als Mittler zwischen der „Metaphysik der Geschichte“ und der „Metaphysik der Koinzidenz“
- Versuch der Restitution
- Analyse des literaturwissenschaftlichen Werks
- Sebalds der Zerstörung gewidmete, geschichtswissenschaftliche Sozialisation und sein Geschichtsverständnis in Anlehnung an
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Werk von Winfried Georg Sebald unter Anwendung der existentiellen Psychoanalyse Jean-Paul Sartres. Ziel ist es, Sebalds literaturwissenschaftliche und schriftstellerische Arbeiten in ihrer philosophischen Fundierung zu verstehen und seine Auseinandersetzung mit Geschichte und Erinnerung zu analysieren.
- Sartres existentielle Psychoanalyse als analytisches Werkzeug
- Sebalds Geschichtsverständnis und seine Auseinandersetzung mit der Vergangenheit
- Die Rolle von Bildlichkeit und Erinnerung in Sebalds Werk
- Analyse von Sebalds literaturwissenschaftlichen und schriftstellerischen Texten
- Sebalds „Metaphysik der Koinzidenz“
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema ein und beschreibt den Untersuchungsgegenstand und die Methodik. Das erste Kapitel beleuchtet Sartres philosophisches Konzept, insbesondere seine existentielle Psychoanalyse und sein Geschichtsverständnis. Das zweite Kapitel wendet diese Konzepte auf Sebalds Werk an, analysiert sowohl seine literaturwissenschaftlichen als auch seine schriftstellerischen Arbeiten und untersucht Aspekte wie Bildlichkeit und Sebalds Verständnis von Geschichte und Erinnerung.
Schlüsselwörter
Winfried Georg Sebald, Jean-Paul Sartre, Existentielle Psychoanalyse, Geschichtsverständnis, Erinnerung, Bildlichkeit, Literaturwissenschaft, Schriftstellerei, Metaphysik der Koinzidenz, Holocaust.
Häufig gestellte Fragen
Welchen philosophischen Ansatz nutzt die Arbeit zur Analyse von W.G. Sebald?
Die Arbeit verwendet Jean-Paul Sartres Konzept der "existentiellen Psychoanalyse" und seine fundamentale Ontologie als analytisches Werkzeug.
Was ist das Besondere an Sebalds Bildlichkeit?
Sebald nutzt Schwarz-Weiß-Fotografien und "Wort-Bilder" ambivalent, um eine Verbindung zwischen Fiktion, Dokumentation und Erinnerung herzustellen.
Warum wird Sebalds Frühwerk oft vernachlässigt?
Die Rezeption konzentriert sich meist auf seine späten Prosawerke der 90er Jahre, obwohl seine Dissertation über Alfred Döblin die philosophische Basis für sein Schaffen legte.
Wie steht Sebald zum Thema Geschichte?
Sein Geschichtsverständnis ist stark von der Kritischen Theorie (Adorno, Horkheimer) geprägt und thematisiert oft Zerstörung, Melancholie und das Leiden der Vergangenheit.
Was bedeutet "Metaphysik der Koinzidenz" bei Sebald?
Es beschreibt das geheimnisvolle Zusammentreffen von Ereignissen und Erinnerungen, die Sebalds Protagonisten bei ihrer Suche nach Selbstvergewisserung begegnen.
- Quote paper
- MA bzw. lic. phil. Anton Distler (Author), 2007, Kein Verstehen ohne fundamentale Ontologie, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/182859