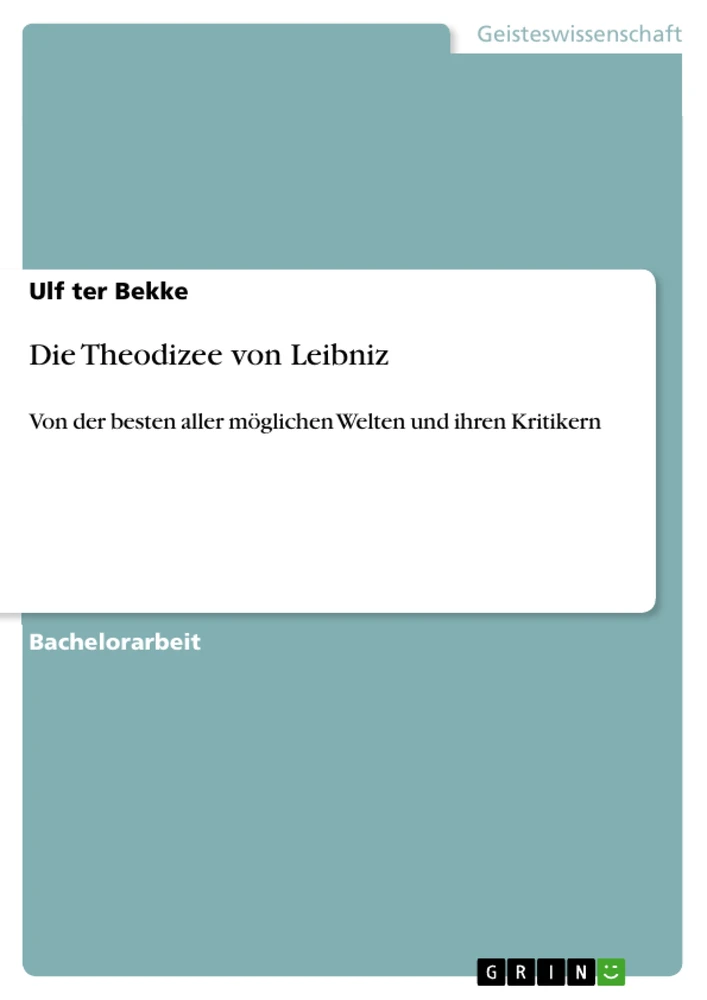1. Einleitung
Für das moderne Bewusstsein ist es „kaum noch des Denkens und Sagens wert: dass überhaupt kein Gott ist, weder ein glaubwürdiger, noch ein denkwürdiger, noch ein abwesender“ – solche Aussagen sind angesichts des Leids in der Welt durchaus häufig und nachvollziehbar. Wie kann ein gütiger Gott all die Übel zulassen? Ist nicht die einzig vernünftige Antwort „Es ist kein Gott“? In der Theodizee-Debatte wurde vieles behauptet, kritisiert und versucht, um Gott zu rechtfertigen. Diese Arbeit behandelt die Lehre Leibniz’, die die faktische als die bestmögliche, von Gott geschaffene Welt beschreibt.
Die Wahl des Themas fiel auf Leibniz, da dieser in herausragender Stellung den Übergang in der Theodizee vom traditionellen zum neuzeitlichen Denken vollzieht. Trotz heftigster Kritik zeigt sich seine Lehre als überaus plausibel mit Argumenten, die auch in modernen Betrachtungen weiterhin benutzt und diskutiert werden. Gerade deswegen bietet sich Leibniz an, um, auf seinen speziellen Thesen aufbauend, allgemeine Lösungs- und Widerlegungsversuche zu diskutieren. Die Möglichkeit dieser Arbeit erweitert sich dadurch, um nicht nur aufzuzeigen, welchen Wert Leibniz’ Lehre hat, sondern darüber hinaus auch aktuell relevante Diskussionen darzustellen und deren Stichhaltigkeit zu prüfen. Zudem besteht das Anliegen, die Aussage, dass die Theorie Leibniz’ nicht mehr wiederholbar ist, als unbegründet zurückzuweisen.
Diese Arbeit soll sich also nicht allzu genau auf die Lehre der besten aller möglichen Welten beschränken, sondern greift sich die Grundargumente Leibniz’ heraus, um sie im Lichte neuzeitlicher Lösungsversuche neu zu betrachten und ihre Aktualität zu beleuchten. Hierzu wird zuerst in Leibniz’ Lehre eingeführt, um die Grundlage für die folgende Diskussion zu gewährleisten. Darauf folgen generelle Einwände der Kritiker, die widerlegt werden sollen. Die anschließende Behandlung der privatio boni und redutio in mysterium wird den Bedarf zeigen, die Übel in der Welt auf eine andere Weise zu rechtfertigen. Dies geschieht vor allem in Bezug auf die im großen Maße theodizee-relevante Thematik der Willensfreiheit, weswegen ihr in dieser Arbeit ein herausragen-der Stellenwert zugesprochen wird. Es wird sich jedoch weiter zeigen, dass auch das Freiheitsargument für Leibniz’ Theodizee nicht ausreicht. Der Schluss dieser Arbeit bezieht sich deswegen, leider nur in kurzer Form, auf eine Diskussion der Naturgesetze.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Theodizee von Leibniz
- Einführung und Hintergrund
- Die beste aller möglichen Welten
- Unterscheidung zwischen Vernunft- und Tatsachenwahrheiten
- Die Zielgerichtetheit Gottes
- Das metaphysische Übel
- Die Freiheit des menschlichen Willens
- Zusammenfassungen der Argumente
- Grundlegende Kritik an Leibniz' Lehre
- Vorwurf der „petitio principii“
- Die Absurdität einer „bestmöglichen Welt“
- Journet I: Unmöglichkeit einer bestmöglichen Welt
- Journet II: Unendl. Vollkommenheit vs. endliche Schöpfung
- Russel: Die Welt im natürlichen Untergang
- Die These von der „privatio boni“
- Erklärung der Privationsthese
- Kritik an der Privationsthese
- Die These von der „reductio in mysterium“
- Erklärung und Vergleich mit Leibniz
- Kritik an Leibniz' Variation der „reductio in mysterium“
- Das Argument der Willensfreiheit
- Aufbau des Arguments
- Die Definition der Willensfreiheit
- Die Leugnung der Willensfreiheit
- Die Leugnung des Werts der Freiheit
- Die Leugnung der Möglichkeit leidverursachender Freiheit
- Die Leugnung des notwendigen Freiheitsmissbrauchs
- Eine kurze Zusammenfassung
- Das Allmachtsparadoxon
- Allmacht und Willensfreiheit
- Der ohnmächtige Gott
- Das Problem der Allwissenheit
- Klassische Lösungen
- Die Lösung durch das Vorherwissen aller Möglichkeiten
- Die natürlichen Übel
- Naturgesetze als Ursache der Übel
- Abschließende Gedanken
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Theodizee von Leibniz und untersucht seine Lehre von der besten aller möglichen Welten. Ziel ist es, die Hauptargumente von Leibniz im Lichte neuzeitlicher Lösungsversuche zu betrachten und deren Aktualität zu beleuchten. Dabei werden sowohl die zentralen Argumente der Lehre von Leibniz als auch Kritikpunkte an dieser dargelegt und diskutiert.
- Das Verhältnis von Vernunft- und Tatsachenwahrheiten in Leibniz' Theodizee
- Die Freiheit des menschlichen Willens und deren Rolle in Leibniz' Argumentation
- Die Kritik an der These von der „privatio boni“ und der „reductio in mysterium“
- Die Problematik des Allmachtsparadoxons und der Allwissenheit Gottes
- Die Rolle der Naturgesetze als Ursache für Übel in der Welt
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Diese Einleitung erläutert die Relevanz der Theodizee-Debatte und stellt Leibniz' Lehre im Kontext der neuzeitlichen Philosophie dar.
- Die Theodizee von Leibniz: Dieses Kapitel führt in die zentralen Argumente von Leibniz' Lehre ein, darunter die Vorstellung der besten aller möglichen Welten, die Unterscheidung zwischen Vernunft- und Tatsachenwahrheiten sowie die Zielgerichtetheit Gottes.
- Grundlegende Kritik an Leibniz' Lehre: Hier werden verschiedene Einwände gegen Leibniz' Theodizee vorgestellt, wie den Vorwurf der „petitio principii“ und die Absurdität der Annahme einer bestmöglichen Welt.
- Die These von der „privatio boni“: Dieses Kapitel erklärt die Privationsthese und analysiert die Kritik an ihr.
- Die These von der „reductio in mysterium“: Hier wird Leibniz' Variation der „reductio in mysterium“ vorgestellt und kritisiert.
- Das Argument der Willensfreiheit: Dieses Kapitel behandelt das zentrale Argument der Willensfreiheit in der Theodizee und beleuchtet die Definition, Leugnung und verschiedene Aspekte dieses Arguments.
- Das Allmachtsparadoxon: Dieses Kapitel untersucht das Allmachtsparadoxon und sein Verhältnis zur Willensfreiheit.
- Das Problem der Allwissenheit: Dieses Kapitel beleuchtet das Problem der Allwissenheit Gottes und verschiedene Lösungsansätze.
- Die natürlichen Übel: Dieses Kapitel betrachtet die Rolle der Naturgesetze als Ursache für Übel in der Welt.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter und Themenbereiche dieser Arbeit sind: Theodizee, Leibniz, beste aller möglichen Welten, Willensfreiheit, Übel, privatio boni, reductio in mysterium, Allmacht, Allwissenheit, Naturgesetze.
- Citar trabajo
- Ulf ter Bekke (Autor), 2011, Die Theodizee von Leibniz, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/182945