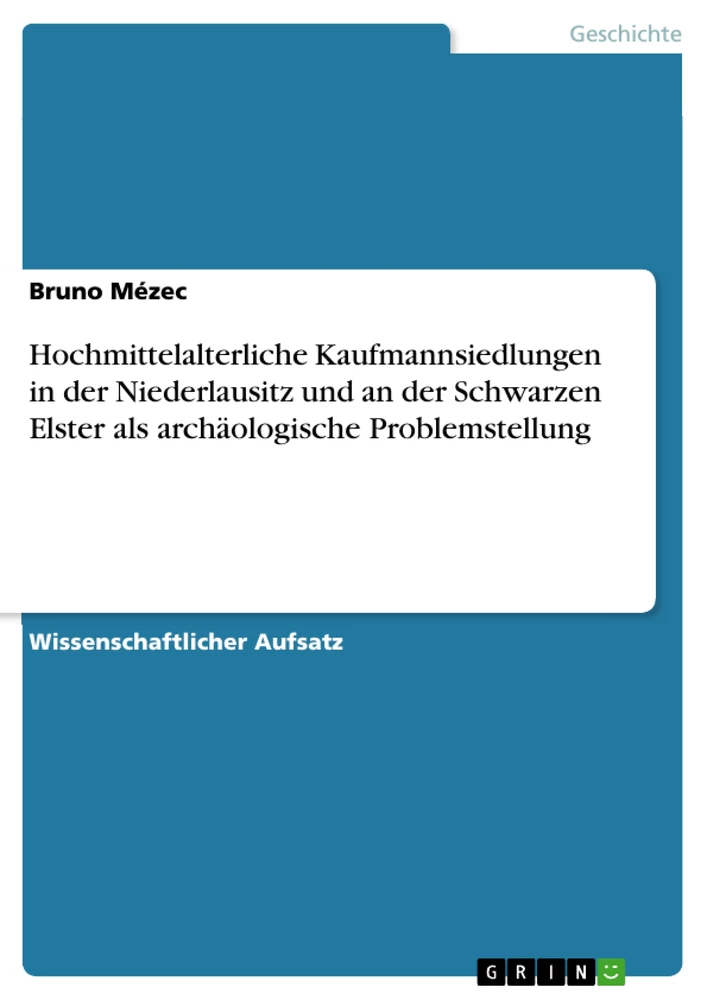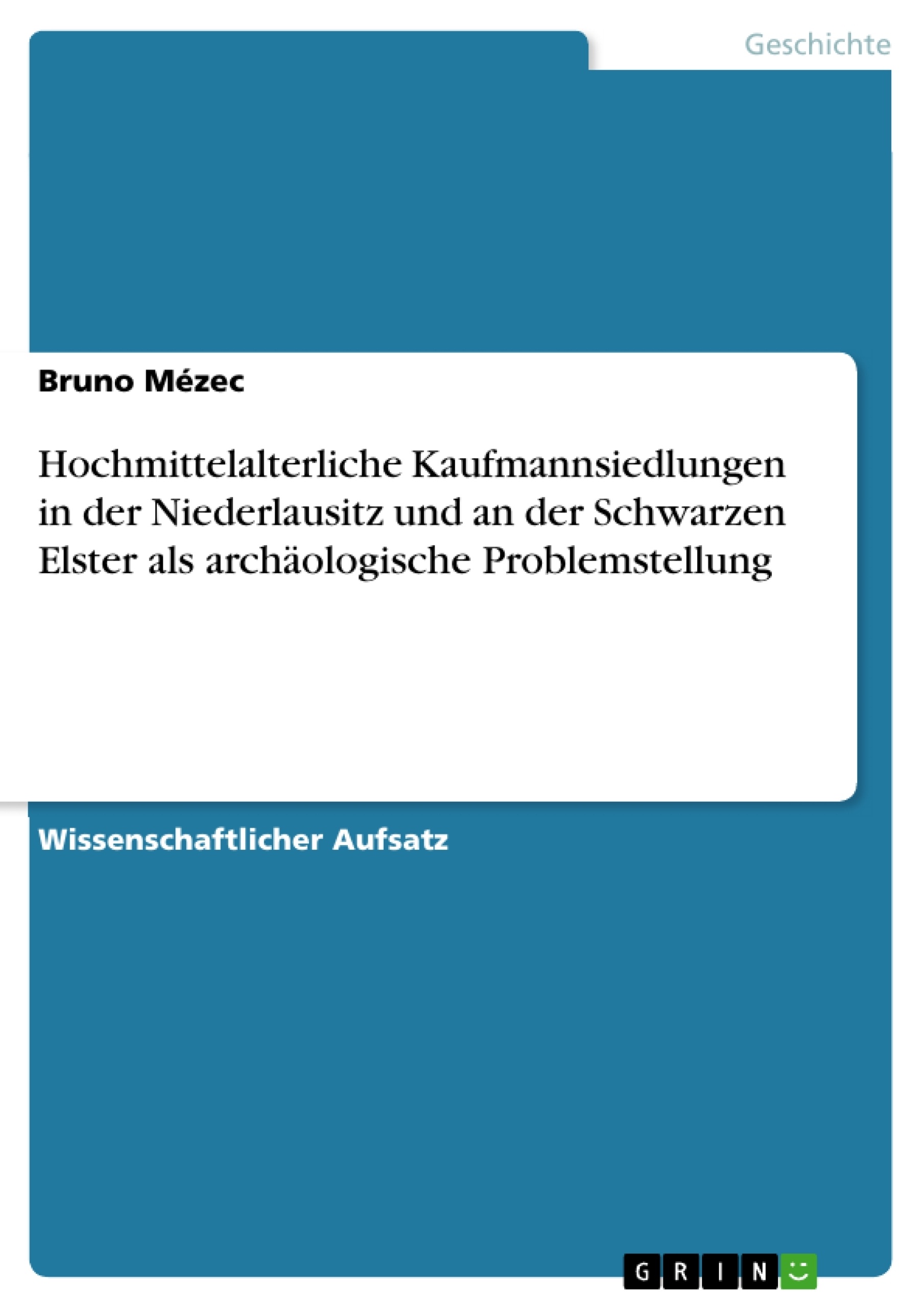Bisherige Äußerungen zur Stadtgenese in der Niederlausitz und im westlich davor liegenden Abschnitt der Schwarzen Elster gingen teilweise von kaufmännischen Impulsen aus. Vor allem das Vorhandensein von Kaufmannsiedlungen wird in allen publizistischen Genres bis hin zu wissenschaftlichen Publikationen gern suggeriert. Dies betrifft in den Arbeiten von Blaschke besonders die Städte Forst, Lübben, Herzberg, Luckau und Cottbus, wo sich diese Annahme in einem breiten Spektrum weiterer Veröffentlichungen widerspiegelt. Auch Uebigau und Bad Liebenwerda an der Schwarzen Elster wurden in Anlehnung an diese Anregung als Kaufmannsiedlung angesprochen. Einige in diesem Zusammenhang verwendete Formulierungen, beispielsweise „Marktsiedlung der Kaufleute „Kaufmannsstadt“, oder „Bürgerstädte mit zur Kaufmannsiedlung gehörendem Markt“ schießen über orthodoxe Vorstellungen hinaus und verraten eine anscheinend weit verbreitete Unkenntnis in Bezug auf Vorgänge der Stadtgenese. In diesem Beitrag folgen zunächst einige Erläuterungen zu diesem bis dato eminent wichtigen stadtgenetischen Ansatz, bevor durch Hinweise auf archäologische Quellen gefragt wird, ob überhaupt noch Platz für Kaufmannsphantasien bleibt.
Inhaltsverzeichnis
- Wandel durch Handel
- Kaufmannsiedlungen als Fertigbaustein?
- Kaufmannsiedlungen: Historische Perspektive
- Kaufmannsiedlungen und der mittelalterliche Fernhandel
- Kaufmannsiedlungen: Ein Modell für die Niederlausitz?
- Kaufmannsiedlungen im Osten: Aktuelle Diskussion
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Autor analysiert die wissenschaftliche Annahme, dass im Hochmittelalter sogenannte „Kaufmannsiedlungen“ die Stadtentstehung in der Niederlausitz und an der Schwarzen Elster prägten. Er hinterfragt die Relevanz dieser These und beleuchtet den historischen Kontext, die Rolle des Handels und die Bedeutung archäologischer Quellen für die Untersuchung dieser Frage.
- Die Rolle von Kaufmannsiedlungen in der Stadtgenese der Niederlausitz
- Die Gültigkeit des Konzepts „Kaufmannsiedlung“ in Bezug auf den mittelalterlichen Fernhandel
- Die Bedeutung archäologischer Befunde für die Überprüfung der „Kaufmannsiedlung“-These
- Die historische und wissenschaftliche Entwicklung des Begriffs „Kaufmannsiedlung“
- Die Diskussion um Kaufmannsiedlungen im Kontext der Stadtgeschichte des Ostens
Zusammenfassung der Kapitel
- Wandel durch Handel: In diesem Kapitel setzt sich der Autor kritisch mit dem Konzept der „Kaufmannsiedlung“ auseinander. Er beleuchtet die unterschiedlichen Definitionen und die historische Entwicklung des Begriffs, wobei er besonders auf die Arbeiten von Blaschke verweist.
- Kaufmannsiedlungen als Fertigbaustein?: Der Autor stellt die These auf, dass die Annahme von Kaufmannsiedlungen als „Fertigbaustein“ für die Stadtentstehung in der Niederlausitz und an der Schwarzen Elster problematisch ist. Er kritisiert die Verwendung des Begriffs und die mangelnde empirische Grundlage dieser Annahme.
- Kaufmannsiedlungen: Historische Perspektive: Dieses Kapitel untersucht die historische Entwicklung des Fernhandels und die Rolle von Kaufleuten in der mittelalterlichen Stadtentwicklung. Der Autor beleuchtet die unterschiedlichen Formen des Handels im Hochmittelalter und die Beziehung zwischen Kaufleuten und herrschaftlichen Strukturen.
- Kaufmannsiedlungen und der mittelalterliche Fernhandel: In diesem Kapitel setzt sich der Autor mit der Vorstellung auseinander, dass sich Kaufleute gezielt an günstigen Straßenkreuzungen niederließen. Er widerlegt diese Annahme anhand der historischen Erkenntnisse über den mittelalterlichen Fernhandel und betont dessen herrschaftsgebundenen Charakter.
- Kaufmannsiedlungen: Ein Modell für die Niederlausitz?: Dieses Kapitel hinterfragt die Übertragbarkeit des „Kaufmannsiedlung“-Modells auf den Osten der Elbe. Der Autor argumentiert, dass die Bedingungen des kolonialen Siedlungsrahmens anders waren und die Existenz von nachhaltigen Kaufmannsiedlungen unwahrscheinlich ist.
- Kaufmannsiedlungen im Osten: Aktuelle Diskussion: Dieses Kapitel diskutiert die aktuellen Debatten über die Existenz von Kaufmannsiedlungen im Osten. Der Autor stellt die Argumentationslinien für und gegen die Kaufmannsiedlungsthese dar und hinterfragt die Beweislage für konkrete Fälle wie Alt-Lübeck, Brandenburg a.d. Havel und Frankfurt a.d. Oder.
Schlüsselwörter
Kaufmannsiedlung, Stadtgenese, Hochmittelalter, Niederlausitz, Schwarze Elster, Fernhandel, archäologische Quellen, historische Quellenkritik, Stadtforschung, mittelalterliche Wirtschaftsgeschichte, urbaner Raum, historische Geographie.
Häufig gestellte Fragen
Was ist eine „Kaufmannsiedlung“ im mittelalterlichen Kontext?
Es ist die These, dass Städte durch Ansiedlungen von Fernhändlern an strategischen Orten (z.B. Straßenkreuzungen) entstanden sind.
Wird die Existenz von Kaufmannsiedlungen in der Niederlausitz archäologisch bestätigt?
Der Autor hinterfragt dies kritisch und argumentiert, dass viele dieser Annahmen eher „Kaufmannsphantasien“ ohne ausreichende archäologische Belege sind.
Welche Städte in der Niederlausitz werden oft als Kaufmannsiedlungen genannt?
In der Literatur (z.B. Blaschke) werden oft Forst, Lübben, Herzberg, Luckau und Cottbus in diesem Zusammenhang erwähnt.
Warum ist der herrschaftliche Charakter des Fernhandels wichtig?
Fernhandel im Hochmittelalter war kein freies Unternehmertum, sondern oft eng an herrschaftliche Strukturen und Schutzrechte gebunden, was gegen spontane Siedlungsgründungen spricht.
Was kritisiert der Autor an der bisherigen Stadtgeschichtsforschung?
Er kritisiert die unkritische Übernahme des Modells der Kaufmannsiedlung als „Fertigbaustein“ für die Stadtgenese im Osten Deutschlands.
- Arbeit zitieren
- Bruno Mézec (Autor:in), 2011, Hochmittelalterliche Kaufmannsiedlungen in der Niederlausitz und an der Schwarzen Elster als archäologische Problemstellung, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/183016