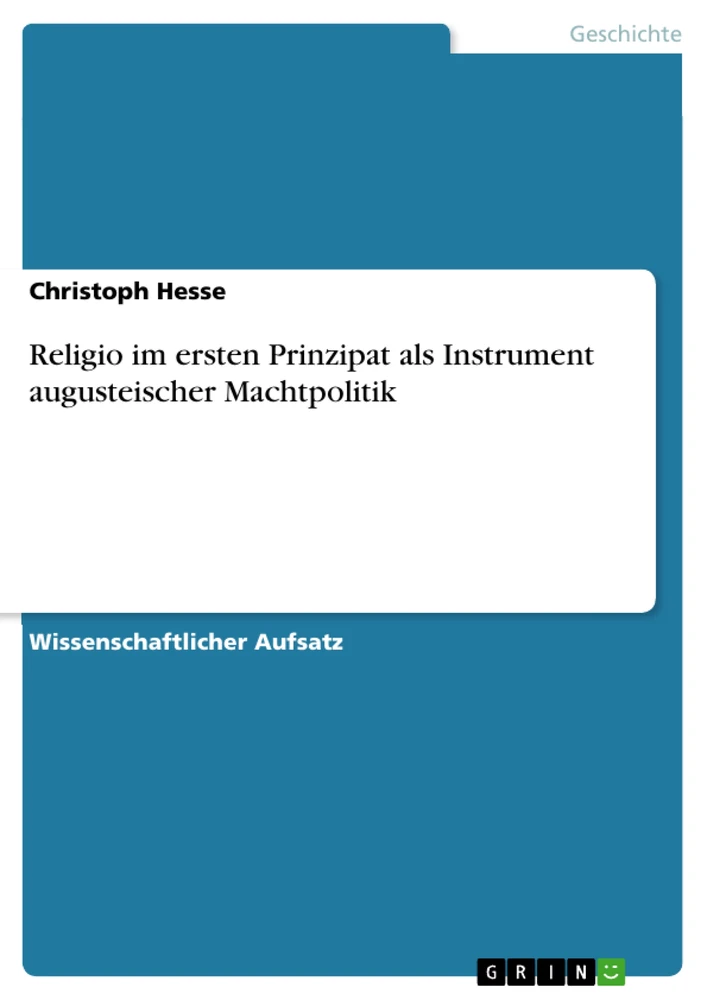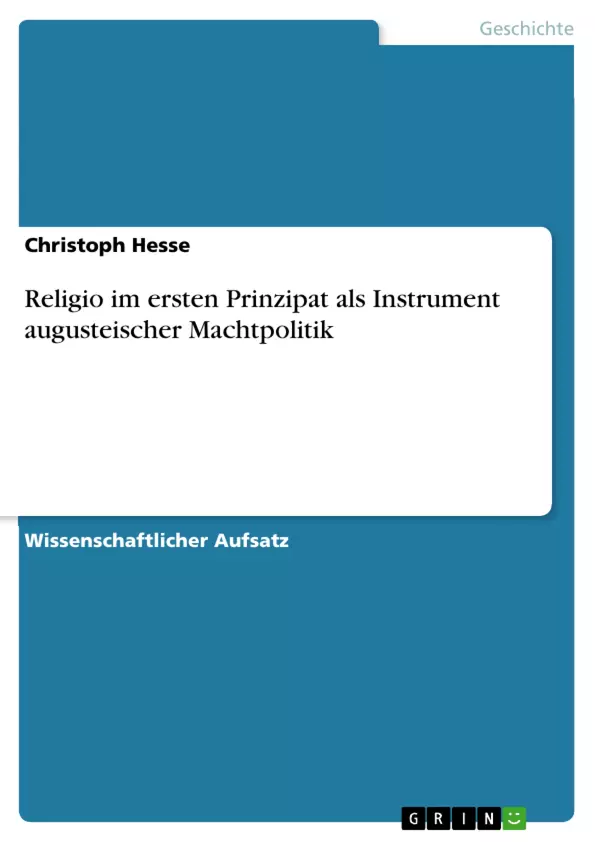War Augustus im religiösen Bereich ein politischer Pragmatiker? Ein kalkulierender Stratege auf dem Weg zur unumschränkten Autokratie? Gar ein „genialer Heuchler“ , der religio und pietas nur als Instrumente seiner Machtpolitik verstand? Oder war er doch der gottesfürchtige Friedensbringer, der sich nur zum Wohl und Erhalt des Staates wegen gegen die Mörder seines Vaters stellte und dem langen Bürgerkrieg durch den Sieg gegen Antonius ein Ende bereitete? Augustus also als konservativer Traditionalist, der nicht nur die Republik restaurierte, sondern auch den in Vergessenheit geratenen mos maiorum, die Sitten und Gebräuche der Älteren, die nebst der besonderen Gottesfürchtigkeit, einst den Aufstieg Roms ermöglicht hatten? Letzteres Bild propagiert der erste Princeps vor allen Dingen von sich selbst in der einzigen, uns von ihm übermittelten Schrift, dem „Index Rerum gestarum.“ Diesen Taten- und Rechenschaftsbericht hatte Augustus an sein Testament angefügt, und er sollte nach seinem Tod zwei Pfeiler vor dem - ebenfalls von ihm selbst - erbauten Mausoleum schmücken. Durch Sueton erfahren wir an anderer Stelle, was Augustus damit ursprünglich bezweckte: „Ich trachte danach, dass ich, solange ich lebe, von den Bürgern gemäß dem Vorbild dieser großen Männer beurteilt werde und ebenso die Kaiser der folgenden Generationen.“ Auch bei Tacitus findet sich, wenn auch indirekt, der Tatenbericht des Augustus wieder, so lässt er im ersten Buch seiner Annalen Befürworter und Gegner des Princeps, während dessen Leichenbegräbnis, beim „Totengericht“ zu Wort kommen. Genau dort finden wir auch den Vorwurf, es sei „nichts für die Verehrung der Götter übrig geblieben, da er [Augustus] in Tempeln durch flamines und im Götterbild verehrt werden wollte.“ In der Tat fällt das religiöse Phänomen des Herrscherkults, der im Laufe der Kaiserzeit an Intensität und Zulauf gewinnt , in die Zeit der augusteischen Restauration. Die Quellenlage zum frühen Kaiserreich, vor allem für den Zeitraum der iulisch-claudischen Dynastie und damit über die Errichtung des Prinzipats unter Augustus, ist vergleichsweise üppig und so stehen neben dem durch eine Abschrift erhaltenen Tatenbericht „Res Gestae (Divi Augusti)“, die Werke von Historikern wie Tacitus, Cassius Dio, Livius, aber auch leider nur fragmentarisch erhaltenen Arbeiten, wie die des Appian oder Nikolaos von Damaskus, zur Verfügung. Dazu kommen(...)
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Religio im ersten Prinzipat als Instrument augusteischer Machtpolitik
- Religio im Dienste der augusteischen Propaganda – Der Aufstieg des Octavian
- Religio als „,Monopol“ des Prinzeps – Eine letzte Metamorphose
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Rolle der Religio im ersten Prinzipat unter Augustus und analysiert, inwiefern diese als Instrument seiner Machtpolitik eingesetzt wurde. Die Arbeit beleuchtet die bewusste Instrumentalisierung der Religio durch Augustus für seine politische Agenda, sowohl im Hinblick auf die innenpolitische Stärkung seiner Position in Rom als auch die Legitimation seiner Herrschaft.
- Die bewusste Instrumentalisierung der Religio durch Augustus für seine Machtpolitik
- Die Rolle der Religio bei der Legitimation des blutigen Befreiungskrieges gegen die Antonius-Partei
- Die Restauration der religio romana als Stützpfeiler der augusteischen Herrschaft
- Die Entwicklung der Hofreligion im ersten Prinzipat
- Die politische Bedeutung des Herrscherkults in der augusteischen Epoche
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Das erste Kapitel beleuchtet die Debatte um die Rolle des Augustus in der religiösen Sphäre: War er ein politischer Pragmatiker, ein kalkulierender Stratege oder ein „genialer Heuchler“, der die Religio instrumentalisierte? Oder war er doch der gottesfürchtige Friedensbringer, der den mos maiorum wiederherstellte? Die Arbeit stellt dar, dass Augustus in seinen „Res Gestae“ ein konservatives, traditionalistisches Bild von sich selbst propagierte, das auf die Wiederherstellung der römischen Werte und Traditionen fokussiert. Der Vergleich mit den Quellen von Sueton und Tacitus zeigt jedoch, dass Augustus die Religio gezielt für seine politische Agenda nutzte.
Religio im ersten Prinzipat - Instrument augusteischer Machtpolitik
Das zweite Kapitel untersucht die Instrumentalisierung der Religio durch Augustus im ersten Prinzipat. Es wird die These aufgestellt, dass Augustus von Beginn an ein „religiöses Programm“ verfolgte, das auf die Stärkung seiner Macht und die Legitimation seiner Herrschaft zielte. Die Arbeit analysiert die Restauration der religio romana als Stützpfeiler der augusteischen Herrschaft und die Entwicklung der Hofreligion als Ausdruck des neu einsetzenden Friedenszeitalters. Die Arbeit beleuchtet zudem die politische Bedeutung des Herrscherkults in der augusteischen Epoche.
Schlüsselwörter
Religio, Augustus, Prinzipat, Machtpolitik, Propaganda, Restauration, Hofreligion, Herrscherkult, mos maiorum, Res Gestae, Sueton, Tacitus, Annalen, Monumentum Ancyranum.
Häufig gestellte Fragen
Wie nutzte Augustus die Religion für seine Machtpolitik?
Augustus instrumentalisierte Begriffe wie „religio“ und „pietas“, um seine Herrschaft zu legitimieren, die Republik scheinbar zu restaurieren und sich als gottesfürchtiger Friedensbringer darzustellen.
Was ist der „Index Rerum Gestarum“?
Es ist der Tatenbericht des Augustus (Res Gestae), in dem er sein politisches und religiöses Wirken für die Nachwelt dokumentierte und sich als Bewahrer des „mos maiorum“ inszenierte.
Was versteht man unter dem „mos maiorum“?
Es bezeichnet die „Sitten der Vorfahren“, also die traditionellen römischen Werte und Gebräuche, deren Wiederherstellung Augustus als zentrales Ziel seiner Politik deklarierte.
Welche Kritik übte Tacitus an Augustus' Religionspolitik?
Tacitus warf Augustus vor, die Götterverehrung für sich selbst missbraucht zu haben, indem er sich in Tempeln durch eigene Priester (flamines) und Götterbilder verehren ließ.
Was war die politische Bedeutung des Herrscherkults?
Der Herrscherkult diente der religiösen Überhöhung und Festigung der autokratischen Stellung des Princeps innerhalb des neu geschaffenen Prinzipats.
- Arbeit zitieren
- Christoph Hesse (Autor:in), 2011, Religio im ersten Prinzipat als Instrument augusteischer Machtpolitik, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/183041