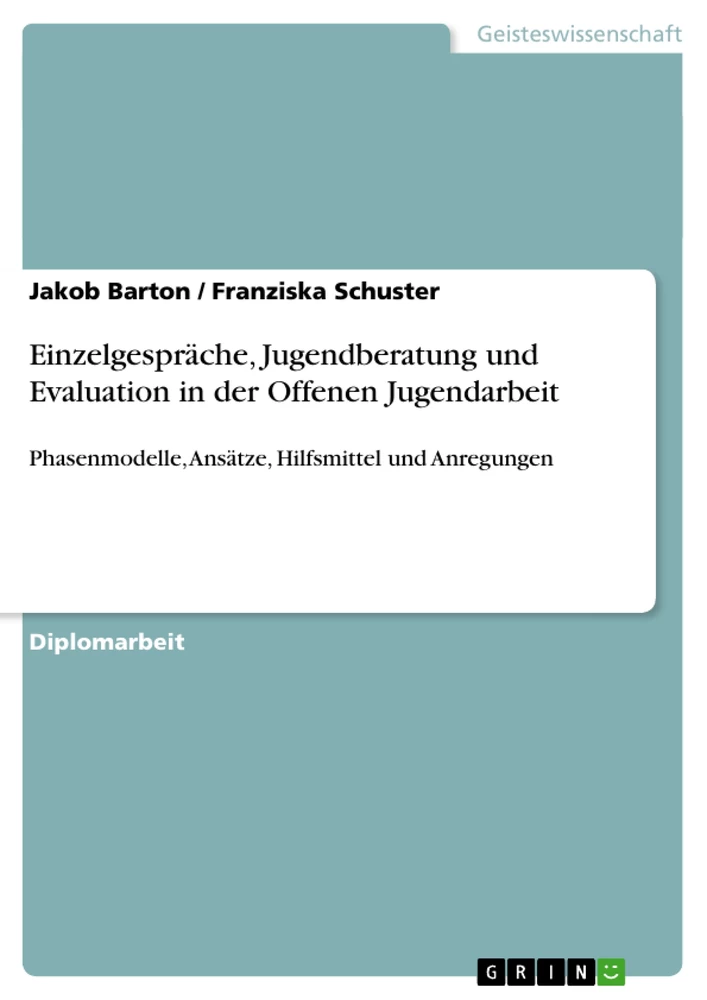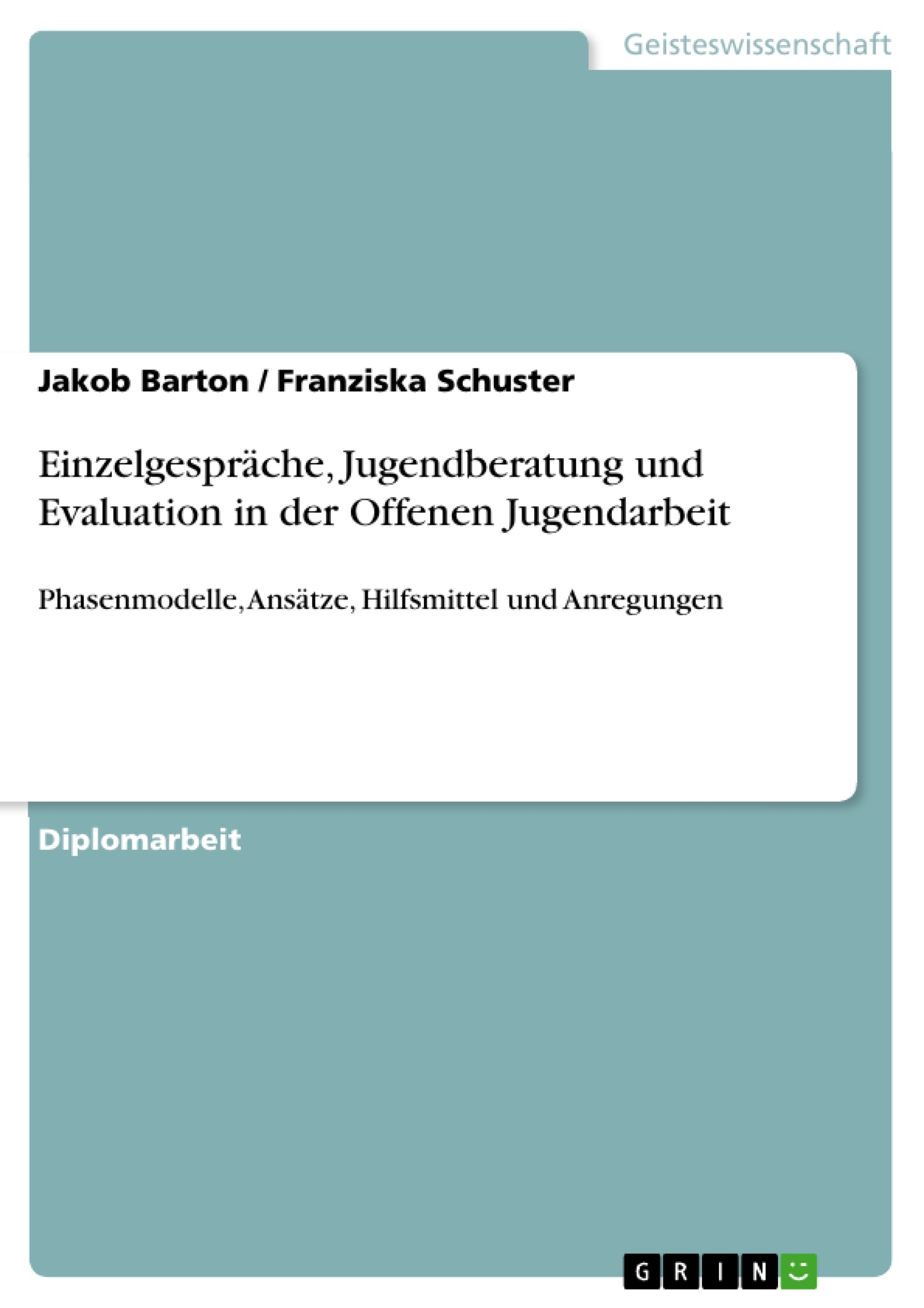Als wir vor und während unseres Studiums in Offenen Jugendeinrichtungen lernten und halfen, viel uns auf, dass Einzelgespräche und Jugendberatung eher spontan erfolgten, ohne dass es in den Einrichtungen Regelungen oder geeignete Orientierungsgrundlagen gab. Selbige hätten uns jedoch bei der Einarbeitung in diese Themenbereiche sehr geholfen.
Ähnlich stand es um die Beteiligung der BesucherInnen bei neuen Anschaffungen, der konkreten Angebotsgestaltung und der Weiterentwicklung bzw. Ausrichtung der Einrichtungen. Besonders in Phasen, in denen BesucherInnenzahlen und NutzerInnenakzeptanz sanken, wurde die Meinung der BesucherInnen zu selten gezielt erfragt.
Diese Erfahrungen motivierten uns zu der vorliegenden Ausarbeitung. Wir haben Beratung und Evaluation in der Offenen Jugendarbeit ins Zentrum gerückt und konkrete Orientierungshilfen erarbeitet. Alles was wir zusammengestellt haben, ist durch eine eigene quantitative Erhebung und gezielte Literaturrecherchen fundiert. Die Ergebnisse der Forschung und die Erkenntnisse aus der Fachliteratur haben wir um eigene Ideen und Vorschläge ergänzt.
Unserer Diplomarbeit soll…
• …einen Einblick geben, wie Einzelgespräche, Beratung und Evaluation in Offenen Jugendeinrichtungen derzeit praktiziert werden.
• …Wissenswertes und Anregendes zu Einzelgesprächen, Beratung und Evaluation in Offenen Jugendeinrichtung zusammenfassen und dabei Möglichkeiten und Potentiale aufzeigen.
• …Phasen von Beratung und Evaluation herausarbeiten und konkrete Vorschläge unterbreiten, wie ein Willkommensgespräch und ein Erhebungsbogen aufgebaut sein können.
• …dazu beitragen, die Bekanntheit der Angebote Offener Jugendeinrichtungen unter den BesucherInnen zu erhöhen, NutzerInnen in Angebotsgestaltung und Einrichtungsevaluation einzubeziehen und gezielt Beziehungsarbeit zu fördern.
• …für Fachkräfte der Offenen Jugendarbeit nützlich sein. Unsere Ausführungen sollen es geübten Fachkräften ermöglichen, ihre Handlungspraxis zu überprüfen, aber auch NeueinsteigerInnen bei der Einarbeitung behilflich sein.
• …über weiterführende Literaturempfehlungen eine tiefere Einarbeitung in die Materie erleichtern.
• …praxisnah, praxisrelevant und umsetzbar sein.
Ein Großteil unserer Arbeit wurde von Fachkräften der Offenen Jugendarbeit vor der Veröffentlichung gelesen und kommentiert.
„Das ist eine sehr gut geschriebene und inhaltsreiche Arbeit geworden, die einen echten Gewinn für Theorie und Praxis bringen wird.“ (Klaus Hurrelmann)
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Unsere Erfahrung und Motivation
- 1.2 Ziele unserer Arbeit
- 1.3 Die Diplomarbeit: Gliederung und Arbeitsschritte
- 1.4 Lizenz, Download und Verbreitung unserer Arbeit
- 2. Begriffsbestimmungen
- 2.1 Begriff Offene Jugendarbeit
- 2.2 Begriff Jugend
- 2.3 Begriff JugendarbeiterInnen
- 3. Einzelgespräche und Beratung in der Offenen Jugendarbeit
- 3.1 Die Möglichkeiten von Einzelgesprächen und Jugendberatung in der Offenen Jugendarbeit
- 3.1.1 Einzelgespräche und Jugendberatung als zentrale Begriffe
- 3.1.1.1 Einzelgespräche
- 3.1.1.2 Jugendberatung
- 3.2 Einzelgespräche und Beratungen aus der Situation heraus - von unseren Forschungsergebnissen zu einem Phasenmodell
- 3.2.1 PHASE EINS: Die Vorarbeit (Besonderheiten und Voraussetzungen - Einzelgespräche und Jugendberatung in der Offenen Arbeit)
- 3.2.1.1 Jugendberatung als Trend in Offenen Jugendeinrichtungen?
- 3.2.1.2 Jugendberatung in den Konzeptionen Offener Jugendeinrichtungen
- 3.2.1.3 Anforderungen an beratende Fachkräfte
- 3.2.2 PHASE ZWEI: Der Einstieg in Einzelgespräche
- 3.2.2.1 Informationsbeschaffung als Aufhänger, Leidensdruck als Ansporn
- 3.2.2.2 Gelegenheiten schaffen und nutzen
- 3.2.3 PHASE DREI: Vom Einzelgespräch zur Beratung
- 3.2.3.1 Rahmenbedingungen für Beratungsgespräche
- 3.2.3.1.1 Die Notwendigkeit geeigneter Räume für Beratungen
- 3.2.3.1.2 Die Anspannung vor und während den Gesprächen
- 3.2.3.1.3 Ruhe und Zeit für und in Beratungen
- 3.2.3.2 Themen von Beratungen in der Offenen Jugendarbeit
- 3.2.3.3 Ziele von Beratungen in der Offenen Jugendarbeit
- 3.2.4 PHASE VIER: Beraten (Hilfreiche Ansätze, Konzepte und Methoden für die Praxis von Beratungen - eine Auswahl)
- 3.2.4.1 Der Kommunikationsprozess - Grundlegendes und Beachtenswertes in Beratungskontexten
- 3.2.4.2 Die Beratungshaltung der Fachkräfte
- 3.2.4.3 Gesprächstechniken und Beratungskonzepte
- 3.2.4.3.1 Klientenzentrierte Gesprächsführung nach Carl Rogers
- 3.2.4.3.2 Motivierende Gesprächsführung
- 3.2.4.3.3 Das Transtheoretische Modell - Sensibilisierung für die Stadien der Veränderung
- 3.2.4.3.3.1 Widerstand als Zeichen
- 3.2.4.3.3.2 Die Stadien der Veränderung
- 3.2.4.3.3.3 Bestimmung der Stadien
- 3.2.4.3.3.4 Ein ‚Rückfall‘ als möglicher Bestandteil der Veränderung
- 3.2.4.3.3.5 Dokumentation und Wirksamkeitsdialog
- 3.2.4.3.4 Techniken der Systemischen Beratung
- Phasenmodell für Einzelgespräche und Beratung
- Analyse verschiedener Beratungsansätze
- Hilfsmittel und Methoden für die Praxis
- Anforderungen an beratende Fachkräfte
- Evaluation von Einzelgesprächen und Beratung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit untersucht Einzelgespräche, Jugendberatung und Evaluation in der offenen Jugendarbeit. Ziel ist es, Phasenmodelle, Ansätze, Hilfsmittel und Anregungen für die Praxis zu entwickeln und zu präsentieren. Die Arbeit basiert auf empirischen Daten und liefert praktische Handlungsempfehlungen.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung beschreibt die Motivation der Autoren und die Ziele der Arbeit. Der zweite Teil definiert zentrale Begriffe wie Offene Jugendarbeit und Jugendberatung. Der Hauptteil analysiert Einzelgespräche und Beratung in der offenen Jugendarbeit, präsentiert ein Phasenmodell und beschreibt verschiedene Beratungsansätze (z.B. klientenzentrierte Gesprächsführung, motivierende Gesprächsführung, systemische Beratung). Es werden praktische Hilfsmittel und Anforderungen an Fachkräfte thematisiert.
Schlüsselwörter
Offene Jugendarbeit, Einzelgespräch, Jugendberatung, Evaluation, Phasenmodell, Beratungsansätze, Gesprächstechniken, Fachkräfte, Kommunikation, Praxis, Handlungsempfehlungen.
Häufig gestellte Fragen
Wie unterscheiden sich Einzelgespräche von Jugendberatung?
Einzelgespräche finden oft spontan im Alltag der Jugendarbeit statt, während Jugendberatung meist zielgerichteter ist und einen festeren Rahmen sowie methodisches Vorgehen erfordert.
Welche Phasen hat ein Beratungsgespräch in der Jugendarbeit?
Die Arbeit stellt ein Modell vor, das von der Vorarbeit über den Einstieg bis hin zum eigentlichen Beratungsprozess und der Dokumentation reicht.
Was ist die klientenzentrierte Gesprächsführung nach Carl Rogers?
Es ist ein Beratungsansatz, der auf Empathie, Wertschätzung und Echtheit der Fachkraft basiert, um dem Jugendlichen bei der Selbsthilfe zu unterstützen.
Wie können Jugendliche an der Evaluation beteiligt werden?
Durch gezielte Erhebungsbögen und Beteiligung an der Angebotsgestaltung können Fachkräfte die Nutzerakzeptanz messen und die Qualität der Einrichtung verbessern.
Welche Anforderungen werden an Fachkräfte in der Jugendberatung gestellt?
Neben Fachwissen benötigen sie eine reflektierte Beratungshaltung, kommunikative Kompetenz und die Fähigkeit, eine vertrauensvolle Beziehung aufzubauen.
- Quote paper
- Jakob Barton (Author), Franziska Schuster (Author), 2011, Einzelgespräche, Jugendberatung und Evaluation in der Offenen Jugendarbeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/183065